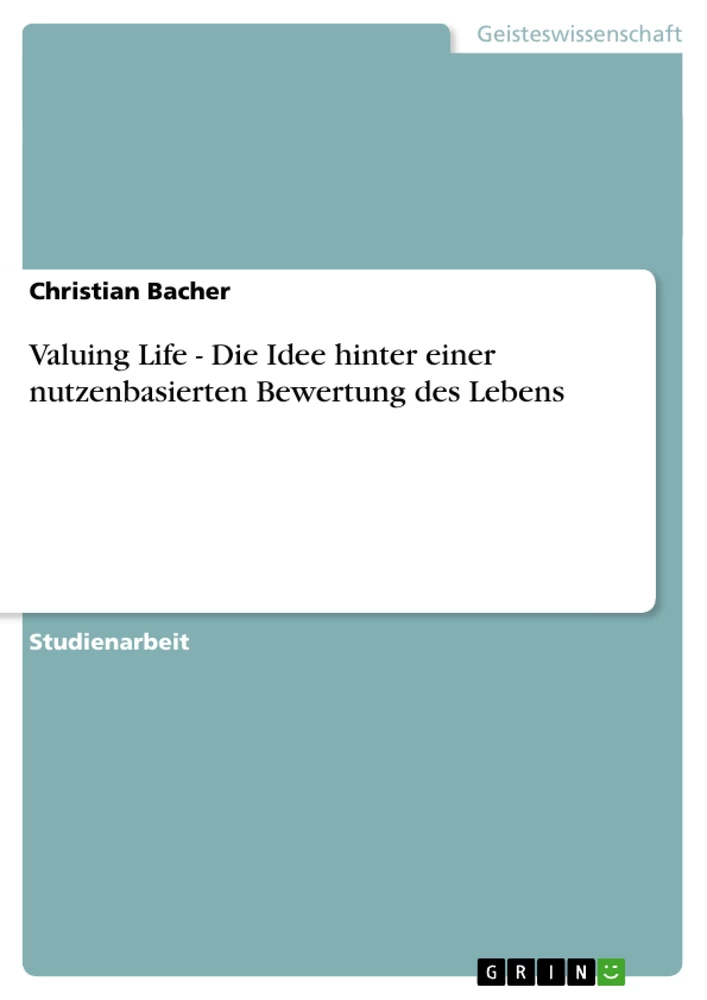Als ich zum ersten Mal von der Bewertung des Lebens in quantitativen, sogar monetären Maßstäben las, ließ es mich aufhorchen. Ich selbst besaß bisher die Weltanschauung, dass ein Menschenleben mehr "wert" sei, als ein Vermögen und überhaupt Menschenleben und Geld nicht zusammenpassen. Dass dies nicht hinterfragt ist, zeigt das Faktum, dass in vielen Regionen der Erde Menschen für weit weniger an "Gegenwert" getötet werden. Auch im Gesundheitswesen wird "der Tod in Kauf genommen", allein dadurch, dass Mittel, die Leben retten, zu knapp sind um sie jedem Bedürftigen zuteil werden zu lassen. Darunter fällt beispielsweise ein begrenztes Kontingent an transplantierbaren Organen. Eine Entscheidungsfindung über die Verteilung dieser knappen Ressourcen kann auch mit quantitativen Methoden unterstützt werden. Diese Methoden haben aber Grenzen, genauso wie die ihnen zugrunde liegenden ethischen Überzeugungen, Grenzen, die ich selbst intuitiv richtig oder wenigstens für bedenkenswert halte. Dennoch soll hier hinterfragt werden, welche Idee hinter dieser Art der Lebensbewertung stehen mag und wo Konfliktgebiete auszumachen sind.
Um dem nachzukommen wird im ersten Kapitel zunächst die "Szene gesetzt", d.h. die Rahmenbe-dingungen einer quantitativen Lebensbewertung, mit zwei grundlegenden Prinzipien der Medizin-ethik, "Wohltätigkeit" und "Gerechtigkeit", wie sie im einflussreichen Werk von BEAUCHAMP und CHILDRESS dargestellt sind, und einem Abriss über die Verwendung des Utilitarismus im Gesund-heitswesen. Das zweite Kapitel dreht sich um das "Stück", vom Allgemeinen zum Speziellen werden Allokationsproblem, Kosten-Nutzen-Analysen und das Warum und Wie der Lebenswertbe-stimmung geklärt, um dann im letzten Kapitel die Kritiker sprechen zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorraussetzungen für eine nutzenbasierte Lebensbewertung
- Wohltätigkeit
- Gerechtigkeit
- Utilitarismus in der Gesundheitsfürsorge
- Umsetzung einer nutzenbasierten Lebensbewertung
- Allokation
- Rationierung und ihre Gründe
- Cost-Benefit- und Cost-Effectiveness-Analysen
- Wert und Qualität des Lebens
- QALYs
- Kritik einer nutzenbasierten Lebensbewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bewertung des menschlichen Lebens im Kontext der Medizinethik, insbesondere mit der Idee einer nutzenbasierten Lebensbewertung. Sie analysiert die ethischen und praktischen Implikationen dieses Ansatzes und untersucht seine Anwendung in der Gesundheitsfürsorge.
- Die konfligierenden medizinethischen Prinzipien Wohltätigkeit (Beneficence) und Gerechtigkeit (Justice) als Grundlage für die Notwendigkeit einer Lebensbewertung.
- Die Rolle des Utilitarismus im Gesundheitswesen und seine Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung.
- Die Herausforderungen der Ressourcenallokation in der Medizin und die Frage nach der gerechten Verteilung von knappen Ressourcen.
- Die Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen und anderen quantitativen Methoden zur Lebensbewertung.
- Die Kritik an einer nutzenbasierten Lebensbewertung und die ethischen Bedenken, die damit verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lebensbewertung im Gesundheitswesen ein und stellt die Notwendigkeit einer ethischen Reflexion in diesem Kontext dar.
Das erste Kapitel analysiert die beiden zentralen medizinethischen Prinzipien Wohltätigkeit und Gerechtigkeit und zeigt deren konfliktreiche Beziehung auf. Dabei wird der Utilitarismus als ethische Grundlage für eine nutzenbasierte Lebensbewertung vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung einer nutzenbasierten Lebensbewertung im Gesundheitswesen. Es diskutiert die Herausforderungen der Ressourcenallokation, die Bedeutung von Kosten-Nutzen-Analysen und die Konzepte des Lebenswertes und der QALY (Quality Adjusted Life Year).
Das dritte Kapitel analysiert die Kritik an einer nutzenbasierten Lebensbewertung. Es beleuchtet die ethischen Bedenken, die mit diesem Ansatz verbunden sind, und diskutiert alternative Perspektiven auf die Lebensbewertung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Lebensbewertung, Medizinethik, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Utilitarismus, Ressourcenallokation, Kosten-Nutzen-Analyse, QALYs, Kritik, ethische Bedenken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer nutzenbasierten Lebensbewertung?
Ziel ist es, knappe Ressourcen im Gesundheitswesen (wie Organe oder Medikamente) mithilfe quantitativer Methoden gerecht und effizient zu verteilen.
Was bedeutet QALY in der Medizinethik?
QALY steht für „Quality Adjusted Life Year“ (qualitätskorrigiertes Lebensjahr). Es ist eine Kennzahl, die sowohl die zusätzliche Lebenszeit als auch die Lebensqualität einer medizinischen Maßnahme bewertet.
Wie beeinflusst der Utilitarismus die Gesundheitsfürsorge?
Der Utilitarismus strebt das größte Glück für die größte Zahl an. Im Gesundheitswesen bedeutet dies oft, Maßnahmen zu priorisieren, die den höchsten Gesamtnutzen für die Bevölkerung bringen.
Was sind die Prinzipien von Beauchamp und Childress?
Die Arbeit bezieht sich insbesondere auf die Prinzipien „Wohltätigkeit“ (Beneficence) und „Gerechtigkeit“ (Justice), die oft in Konflikt geraten, wenn Ressourcen verteilt werden müssen.
Welche Kritik gibt es an der monetären Bewertung von Menschenleben?
Kritiker argumentieren, dass ein Menschenleben eine unantastbare Würde besitzt und nicht gegen Geld oder rein wirtschaftlichen Nutzen aufgewogen werden darf.
- Quote paper
- Christian Bacher (Author), 2004, Valuing Life - Die Idee hinter einer nutzenbasierten Bewertung des Lebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33579