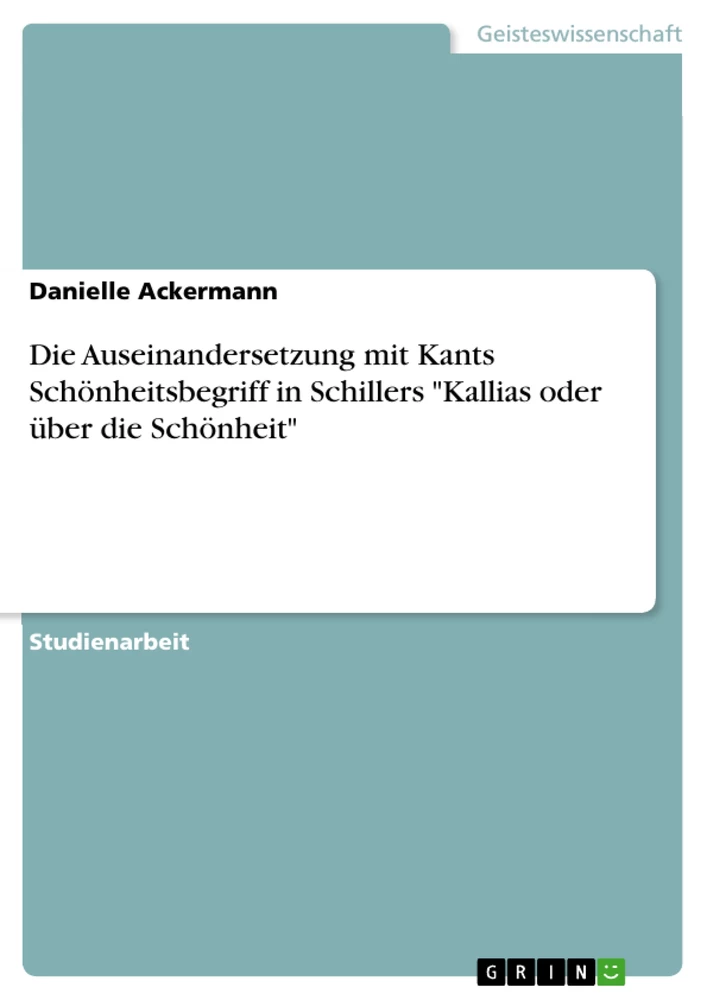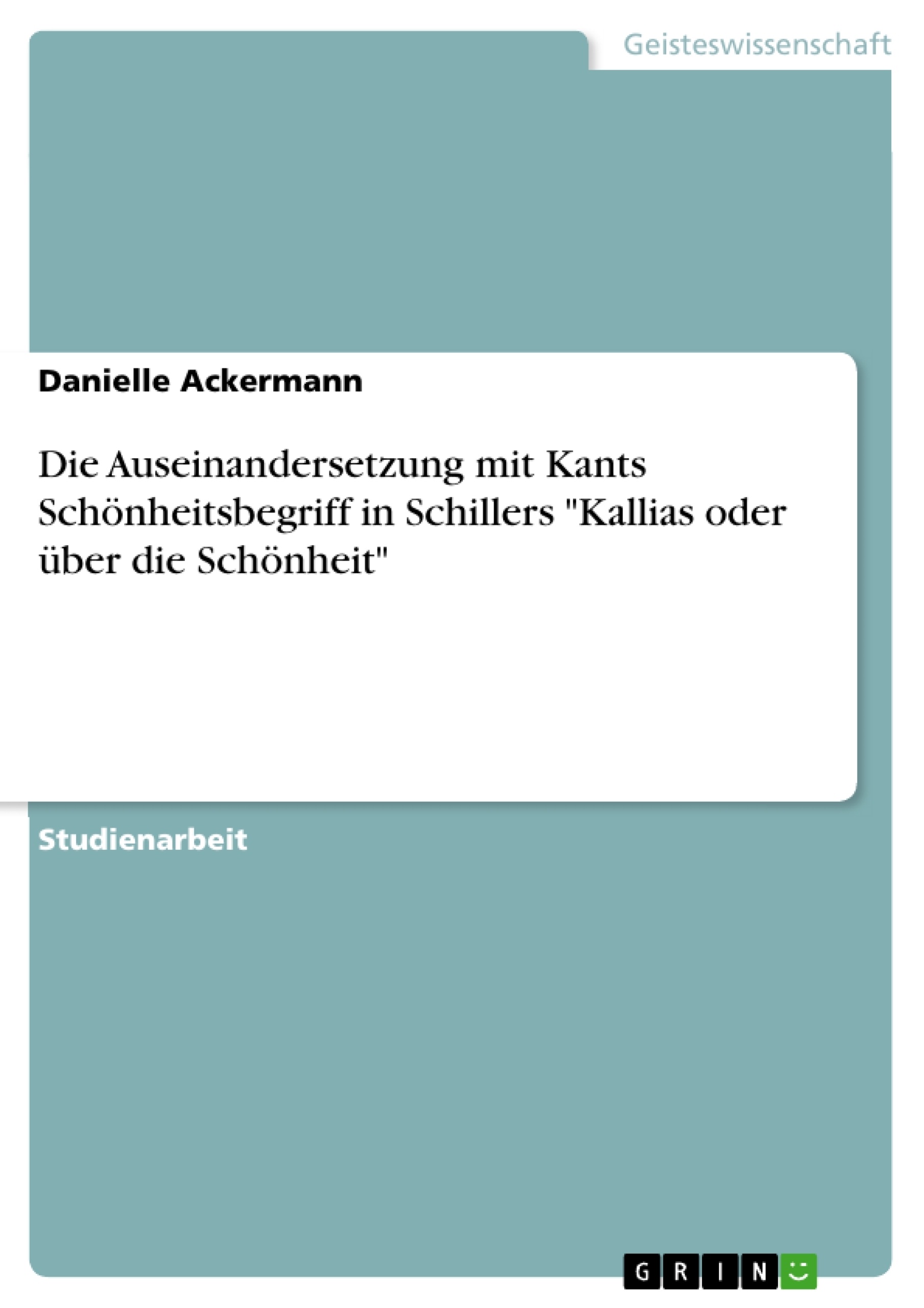Die Briefe, die Schiller seit dem Jahre 1791 an Körner verfasste, bringen zum Ausdruck, wie sehr Schiller die Kantische Schönheitslehre zu beschäftigen schien. Er fühlte sich in Kants Kritik der Urteilskraft ein und setzte sich intensiv mit seiner Philosophie auseinander. In Kants Schrift, ebenso wie in seinen beiden Kritiken der praktischen und reinen Vernunft, geht es um die Voraussetzungen menschlicher Erkenntnis. Dabei stellt sich Kant die Frage, ob ein allgemeingültiges Geschmacksurteil möglich sein kann und unter welchen Bedingungen das Schöne überhaupt zu erkennen ist, wobei er zu der Erkenntnis gelangt, dass das Schöne als solches nur subjektiv wahrgenommen werden kann. Schiller hingegen geht es weniger um das „Wie“, als viel mehr um das, wodurch sich das Schöne definiert. Er ist daran interessiert, ein objektives Prinzip zu finden, welches dem Geschmacksurteil zu Grunde liegt und sich auf bestimmte Merkmale der schönen Gegenstände zurückführen lässt. Er geht im Gegensatz zu Kant von einem objektiven Prinzip aus, das er in enger Verbindung von Schönheit und Freiheit sucht.
Diese Auseinandersetzung Schillers mit Kants Schönheitsbegriff spiegeln sich im Briefwechsel mit Körner wieder, der unter dem Namen Kallias bekannt ist. So werde ich auf diese Briefe im Folgenden näher eingehen. Zunächst möchte ich mich der Frage nach der Lokalisierung des Urteilsvermögens widmen: Ist das Urteilsvermögen Teil der theoretischen oder Teil der praktischen Vernunft? Daraufhin werde ich Schillers ästhetisches Modell genauer beleuchten, indem ich die Freiheit als Form der praktischen Vernunft, den Prozess des ästhetischen Urteils und die Autonomie in der Erscheinung thematisiere. Des Weiteren möchte ich im Anschluss auf den Zusammenhang zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit hinweisen, bevor ich abschließend noch einmal auf wichtige Aspekte eingehen und diese zusammenfassen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Urteilsvermögen und dessen Lokalisierung
- Schillers ästhetisches Modell
- Schlusswort
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Schillers Auseinandersetzung mit Kants Schönheitslehre, insbesondere im Kontext des Briefwechsels mit Körner, bekannt als "Kallias". Die Arbeit analysiert Schillers Kritik an Kants Lokalisierung des Urteilsvermögens und präsentiert Schillers eigenes ästhetisches Modell, das die Freiheit als Grundlage für das Schöne sieht. Die Analyse konzentriert sich auf die Beziehung zwischen der praktischen Vernunft, der Freiheit und der Form des ästhetischen Gegenstandes.
- Schillers Kritik an Kants Lokalisierung des Urteilsvermögens
- Schillers ästhetisches Modell und die Bedeutung der Freiheit
- Die Form des ästhetischen Gegenstandes und ihre Beziehung zur praktischen Vernunft
- Die Rolle der Vernunft und des Verstandes im ästhetischen Urteil
- Der Zusammenhang zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext von Schillers Auseinandersetzung mit Kants Schönheitslehre dar und führt den Leser in die Thematik des Briefwechsels mit Körner ein. Sie skizziert die zentralen Unterschiede zwischen Kants und Schillers Auffassungen vom Schönen und von der Lokalisierung des Urteilsvermögens.
Das Urteilsvermögen und dessen Lokalisierung
Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen Kants und Schillers Auffassungen vom Urteilsvermögen. Es beleuchtet Kants Dreiteilung der Erkenntnisvermögen und Schillers Kritik an dieser. Schiller argumentiert für eine Verbindung zwischen Schönheit und Freiheit und lokalisiert das Urteilsvermögen in der praktischen Vernunft.
Schillers ästhetisches Modell
Dieses Kapitel präsentiert Schillers eigenes ästhetisches Modell, das die Freiheit als Grundlage für das Schöne sieht. Es analysiert die Struktur des ästhetischen Gegenstandes und die Rolle der praktischen Vernunft im ästhetischen Urteil. Schiller argumentiert, dass die Form des Gegenstandes, die Freiheit widerspiegelt, den ästhetischen Genuss hervorruft.
Schlüsselwörter
Schiller, Kant, Schönheitslehre, Urteilsvermögen, praktische Vernunft, Freiheit, ästhetisches Modell, Form, Autonomie, Zweckmäßigkeit, Kallias-Briefe.
Häufig gestellte Fragen
Worin unterscheidet sich Schillers Schönheitsbegriff von Kants?
Während Kant Schönheit als subjektive Wahrnehmung betrachtet, sucht Schiller nach einem objektiven Prinzip des Schönen, das er in der Verbindung von Schönheit und Freiheit findet.
Was sind die „Kallias-Briefe“?
Es handelt sich um einen Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Christian Gottfried Körner aus dem Jahr 1793, in dem Schiller seine Ästhetiktheorie entwickelt.
Wie definiert Schiller Schönheit in Bezug auf Freiheit?
Für Schiller ist Schönheit „Freiheit in der Erscheinung“. Ein Gegenstand ist schön, wenn er so wirkt, als ob er sich selbst nach eigenen Gesetzen bestimmt (Autonomie).
Wo lokalisiert Schiller das Urteilsvermögen?
Im Gegensatz zu Kants strikter Trennung argumentiert Schiller für eine Lokalisierung in der praktischen Vernunft, da Schönheit eng mit dem Freiheitsbegriff verknüpft ist.
Welche Rolle spielt die Zweckmäßigkeit im ästhetischen Urteil?
Schiller untersucht den Zusammenhang zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit und wie die Form eines Gegenstandes ohne äußeren Zweckzwang ästhetisches Vergnügen bereitet.
- Citar trabajo
- Danielle Ackermann (Autor), 2011, Die Auseinandersetzung mit Kants Schönheitsbegriff in Schillers "Kallias oder über die Schönheit", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336616