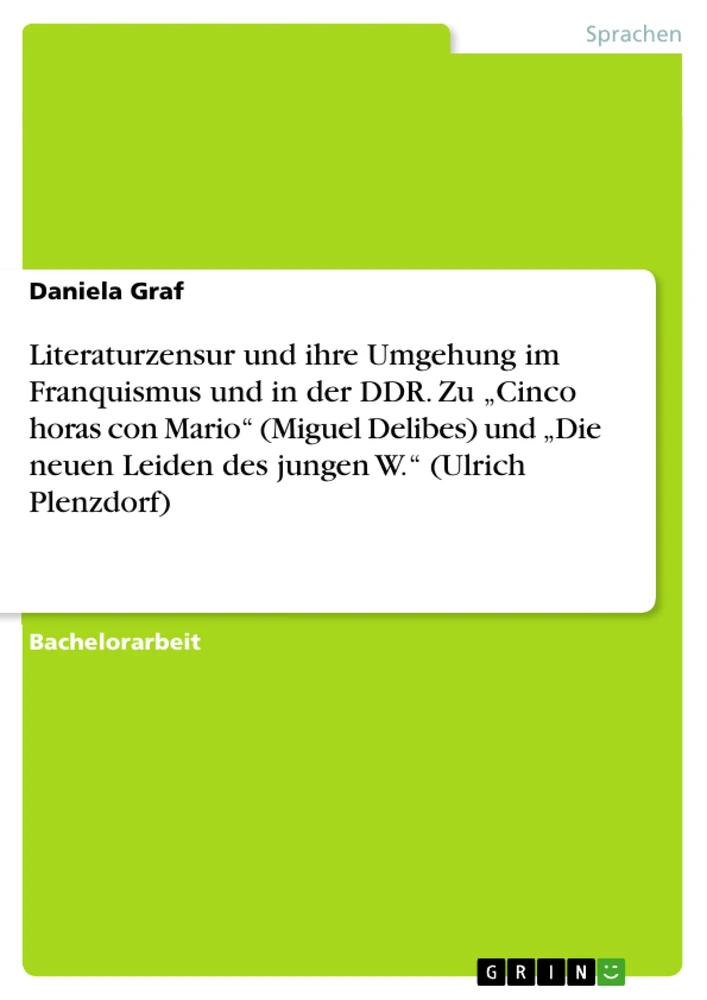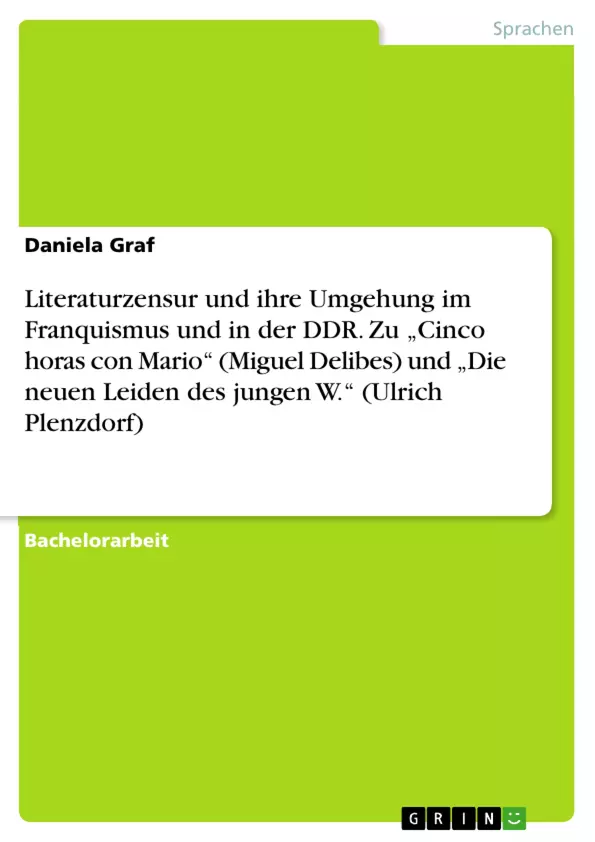Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Literaturzensur im Franquismus und in der DDR, deren Regeln, Ausführungen und Umgehungsmethoden. Speziell an den Beispielen „Cinco horas con Mario“ und „Die neuen Leiden des jungen W.“ soll gezeigt werden, wie die Autoren zwar Kritik üben, aber die Zensur passieren konnten und welche politischen Hintergründe mit eine Rolle spielten.
„Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ Weder im Franquismus (1939-1975) noch in der DDR (1949-1989) existierte dieses Recht. Die offizielle Zensur in Spanien und das Druckgenehmigungsverfahren in der DDR nahm Oppositionellen des Regimes die Möglichkeit, sich frei äußern zu dürfen. Regelverstöße wurden mit Nichtpublikation, Strafe, Zwangsarbeit und Ausweisung geahndet.
Claudia Bliesener behauptet, Zensur existiere, seit es Literatur gibt. Daraus kann gefolgert werden, dass es auch schon immer kreative Köpfe, Intellektuelle gab, die einen Weg gefunden haben diese zu umgehen. „Cinco horas con Mario“ von Miguel Delibes wurde erstmals 1966 veröffentlicht. Es ist nicht ganz klar, ob das Schriftstück aus Gründen des bewusst oder unbewusst euphemistisch-positiven Gutachtens des Zensors die Zensur passierte. Die Protagonistin zeigt sich vordergründig als die stereotype Verkörperung der Konventionen und des Gedankenguts des herrschenden Franquismus – und ist doch mit einem Schriftsteller und nicht so ganz systemkonformen Mann verheiratet.
Entwürfe zu den „Die Leiden des jungen W.“ stellte Plenzdorf bereits 1968/69 fertig, welche aber als Filmmanuskript und auch als Buchversion abgelehnt wurden. Nach der Liberalisierung durch Honecker, wurde der Text zunächst in der Zeitschrift Sinn und Form 1972 abgedruckt und ein Jahr später in einer überarbeiteten Fassung als Buch im Hirnstorff-Verlag, sowohl in der DDR, als auch in der BRD veröffentlicht, wo es in beiden Teilen eine Welle der Diskussion auslöste.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Literaturzensur und Umgehungsmethodik im Franquismus
- Cinco horas con Mario (Miguel Delibes)
- Carmen und Mario als Verkörperungen der „dos Españas“
- Die Liberalisierung des Regimes (apertura) aus der Sicht Carmens
- Kritik am herrschenden Frauenbild im Franquismus
- Cinco horas con Mario (Miguel Delibes)
- Literaturzensur und Umgehungsmethodik in der DDR
- Die neuen Leiden des jungen W. (Ulrich Plenzdorf)
- Edgars Protest gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR
- Die neuen Leiden des jungen Werther - Intertextualität als subtile Kritikform
- Die Wirkung der neuen Leiden auf die BRD und die DDR
- Die neuen Leiden des jungen W. (Ulrich Plenzdorf)
- Literaturzensur und Umgehungsmethodik im Franquismus
- Spanien und die DDR - Parallelen und Differenzen in der Zensur und in deren Umgehungsmethodik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Literaturzensur im Franquismus und in der DDR. Sie analysiert die Methoden der Zensur und die kreativen Umgehungsstrategien von Autoren, die unter diesen Bedingungen ihre Werke veröffentlichten. Zwei exemplarische Werke stehen im Fokus der Untersuchung: „Cinco horas con Mario“ von Miguel Delibes und „Die neuen Leiden des jungen W.“ von Ulrich Plenzdorf. Die Arbeit beleuchtet, wie die Autoren trotz der Zensur Kritik am herrschenden System übten und welche politischen Hintergründe eine Rolle spielten.
- Zensur im Franquismus und in der DDR: Definition, Geschichte und Etymologie
- Umgehungsmethoden von Autoren unter Zensurbedingungen
- Politische Hintergründe der Zensur und Einfluss auf die Werke
- Analyse der Werke „Cinco horas con Mario“ und „Die neuen Leiden des jungen W.“
- Parallelen und Unterschiede der Zensursysteme in Spanien und der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Literaturzensur ein und skizziert die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Zensur im Franquismus und in der DDR. Im zweiten Kapitel wird die Literaturzensur im Franquismus anhand des Beispiels „Cinco horas con Mario“ näher beleuchtet. Dabei werden die Protagonisten Carmen und Mario als Verkörperungen der „dos Españas“ analysiert, die Liberalisierung des Regimes aus Carmens Perspektive beleuchtet und die Kritik am herrschenden Frauenbild im Franquismus untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich der Literaturzensur in der DDR, exemplarisch am Werk „Die neuen Leiden des jungen W.“. Hier wird Edgars Protest gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR analysiert, die Intertextualität des Werks zum „Werther“ beleuchtet und die Wirkung des Buches auf die BRD und die DDR untersucht. Das vierte Kapitel vergleicht die Zensursysteme in Spanien und der DDR, indem es Parallelen und Differenzen in der Zensur und in deren Umgehungsmethoden herausarbeitet. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und formuliert Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Literaturzensur, Franquismus, DDR, „Cinco horas con Mario“, Miguel Delibes, „Die neuen Leiden des jungen W.“, Ulrich Plenzdorf, „dos Españas“, apertura, Intertextualität, Kritik am System, Umgehungsmethoden, Parallelen und Differenzen, Geschichte der Zensur, Zensurgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die Zensur im Franquismus von der in der DDR?
Im Franquismus gab es eine offizielle staatliche Zensur, während in der DDR ein „Druckgenehmigungsverfahren“ zur Kontrolle der Literatur genutzt wurde.
Wie umging Miguel Delibes die Zensur in „Cinco horas con Mario“?
Er nutzte eine Protagonistin, die vordergründig die franquistischen Konventionen verkörperte, um subtile Kritik am System und Frauenbild zu üben.
Welche Rolle spielt die Intertextualität in Plenzdorfs Werk?
In „Die neuen Leiden des jungen W.“ dient der Bezug auf Goethes Werther als subtile Kritikform an den gesellschaftlichen Verhältnissen der DDR.
Was passierte bei Regelverstößen gegen die Zensurvorschriften?
Regelverstöße wurden mit Nichtpublikation, hohen Strafen, Zwangsarbeit oder sogar Ausweisung geahndet.
Wann wurde Plenzdorfs Werk schließlich veröffentlicht?
Nach anfänglicher Ablehnung wurde es 1972 nach der Liberalisierung unter Honecker zuerst in der Zeitschrift „Sinn und Form“ abgedruckt.
- Quote paper
- Daniela Graf (Author), 2014, Literaturzensur und ihre Umgehung im Franquismus und in der DDR. Zu „Cinco horas con Mario“ (Miguel Delibes) und „Die neuen Leiden des jungen W.“ (Ulrich Plenzdorf), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336819