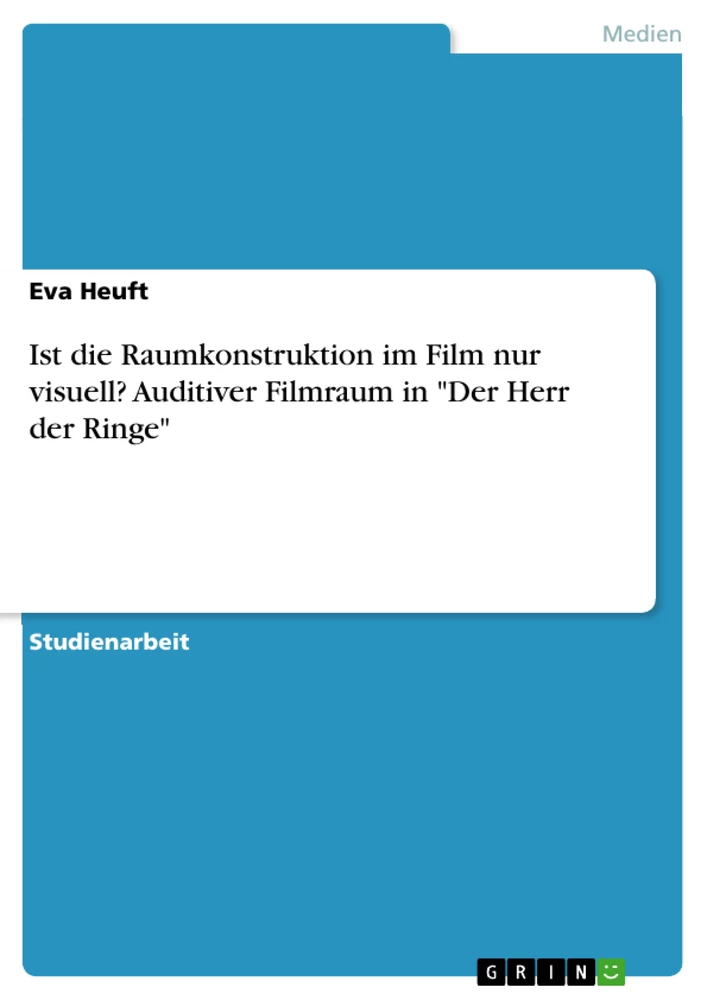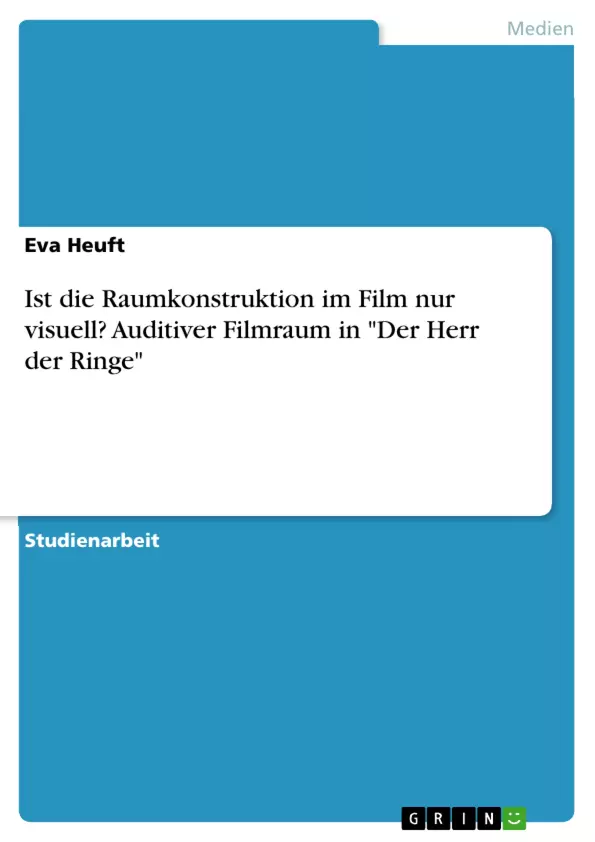In der folgenden Arbeit wird die Funktion von Filmmusik, genauer des auditiven Filmraumes, am Beispiel „Der Herr der Ringe“ untersucht. „Während wir den Film sehen, saugen wir die Bilder wohl in uns auf, neigen aber als Zuschauer und Kritiker dazu, ihre Gestalt kaum wahrzunehmen, und erinnern uns auch später nicht sonderlich stark an sie. Es scheint vielmehr so, als würden wir durch die Bilder hindurch die Geschichte sehen“ (Bordwell 1997, 17). Vermutlich ist es gerade diese Auffassung, die Bordwell davon abgehalten hat, in seinem Buch „Narration in the Fiction Film“ (1985) auf die Funktion von Filmmusik einzugehen. Zwar schreibt er über den Sonic Space, der für ihn aber nur aus Geräuschen und Sprache konstituiert wird.
Auch im „Lexikon der Raumphilosophie“ werden unter den Einträgen Klang- und Hörraum nur die Attribute des Raums vermittelt, die den Klang eines Musikstücks verändern können oder wie der Raum die Musik transportieren kann. Der auditive Raum ist durch das Ohr vermittelter Raumeindruck. Von Fischer meint aber ähnlich wie Bordwell den Raumeindruck, der entsteht, wenn der Mensch auf Grund von Sprache oder Geräuschen die Quelle selbiger ausmachen kann und dadurch einen Eindruck des Raumes bekommt.
Doch ließe sich der auditive Raum auch in der Weise definieren, in der er dazu in der Lage ist, einen Raum zu charakterisieren, symbolisieren und darzustellen. Die Musik ist, insbesondere im Film, eine eigenständige Mitteilungsebene, die stark mit den Handlungssträngen, Figuren und Objekten verbunden ist und durch ebendiese Verbindung auch den Filmraum auditiv darstellen kann. Ein Beispiel hierfür stellt die Trilogie „Der Herr der Ringe“ zur Verfügung. Mit über zehn Stunden musikalischem Material, von dem vieles als Leitmotiv konzipiert wurde, stellt „Der Herr der Ringe“ ein gutes Ausgangmaterial bereit, um den Filmraum näher zu untersuchen und zu prüfen, inwiefern diese durch die Filmmusik geprägt werden.
Dazu muss zunächst der Begriff des Raums näher erläutert werden, da dieser mit vielen Bedeutungsebenen belegt ist und die Nutzung des Begriffs nicht mehr eindeutig ist. Zudem ist eine Theorie zur Filmraumkonstruktion nötig, die von David Bordwell in „Narration in the Fiction Film“ stark an die Wahrnehmungspsychologie angelehnt ist, was für diese Arbeit sinnvoll ist, um die perzeptiven und kognitiven Vorgänge des Rezipienten während des Filmsehens besser beschreiben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RAUM: LOKALITÄT - METAPHORIK - ABSTRAKTION
- 3. THEORETISCHe FilmraumKONSTRUKTION
- 4. Filmraum in der Trilogie „Der Herr der RingE“
- Vorstellung der musikalischen Themen
- Auditive und visuelle Raumdarstellung
- 5. FAZIT: DER Auditive Film- (LEBENS-) RAUM
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit der auditive Raum im Film dazu in der Lage ist, einen Raum zu charakterisieren, symbolisieren und darzustellen. Am Beispiel der Trilogie „Der Herr der Ringe“ wird untersucht, wie Filmmusik den Filmraum auditiv prägt und die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflusst.
- Definition und Bedeutung des Raumbegriffs
- Theorie zur Filmraumkonstruktion nach David Bordwell
- Analyse der musikalischen Themen in „Der Herr der Ringe“
- Die Rolle der Musik in der auditiven und visuellen Raumdarstellung
- Der auditive Filmraum als eigenständige Mitteilungsebene
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung des auditiven Raums im Film dar. Es werden die Grenzen der bisherigen Raumkonzepte in der Filmtheorie aufgezeigt und die Bedeutung von Filmmusik für die Raumgestaltung hervorgehoben.
- Kapitel 2 beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen des Raumbegriffs und zeigt die Entwicklung von der physikalischen Lokalisierung bis hin zu abstrakten und metaphorischen Raumkonzepten auf.
- Kapitel 3 stellt die Theorie zur Filmraumkonstruktion nach David Bordwell vor und diskutiert deren Relevanz für die Analyse der Wahrnehmungsprozesse des Zuschauers.
- Kapitel 4 untersucht die musikalischen Themen in der Trilogie „Der Herr der Ringe“ und analysiert deren Funktion in der auditiven und visuellen Raumdarstellung.
Schlüsselwörter
Filmraum, Auditiver Raum, Filmmusik, Leitmotiv, Raumkonstruktion, „Der Herr der Ringe“, Wahrnehmungspsychologie, Filmtheorie, Symbolisierung, Charakterisierung, Darstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein auditiver Filmraum?
Ein auditiver Filmraum ist der durch das Gehör vermittelte Raumeindruck in einem Film, der durch Musik, Geräusche und Sprache erzeugt wird und den visuellen Raum ergänzt oder charakterisiert.
Wie nutzt „Der Herr der Ringe“ Musik zur Raumkonstruktion?
Durch über zehn Stunden Musik und den Einsatz von Leitmotiven werden verschiedene Regionen von Mittelerde (wie das Auenland oder Mordor) musikalisch identifizierbar und räumlich erfahrbar gemacht.
Welche Theorie von David Bordwell wird in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Bordwells Konzept der „Narration im Spielfilm“, kritisiert aber, dass er die Funktion der Filmmusik bei der Raumkonstruktion weitgehend vernachlässigt.
Kann Musik allein einen Raum symbolisieren?
Ja, Musik fungiert als eigenständige Mitteilungsebene, die eng mit Handlungssträngen und Orten verknüpft ist und so den Filmraum auch ohne visuelle Reize darstellen kann.
Was versteht man unter Leitmotiven in der Filmmusik?
Leitmotive sind wiederkehrende musikalische Themen, die fest mit bestimmten Figuren, Objekten oder Orten verbunden sind und dem Zuschauer helfen, diese kognitiv einzuordnen.
- Arbeit zitieren
- Eva Heuft (Autor:in), 2013, Ist die Raumkonstruktion im Film nur visuell? Auditiver Filmraum in "Der Herr der Ringe", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337473