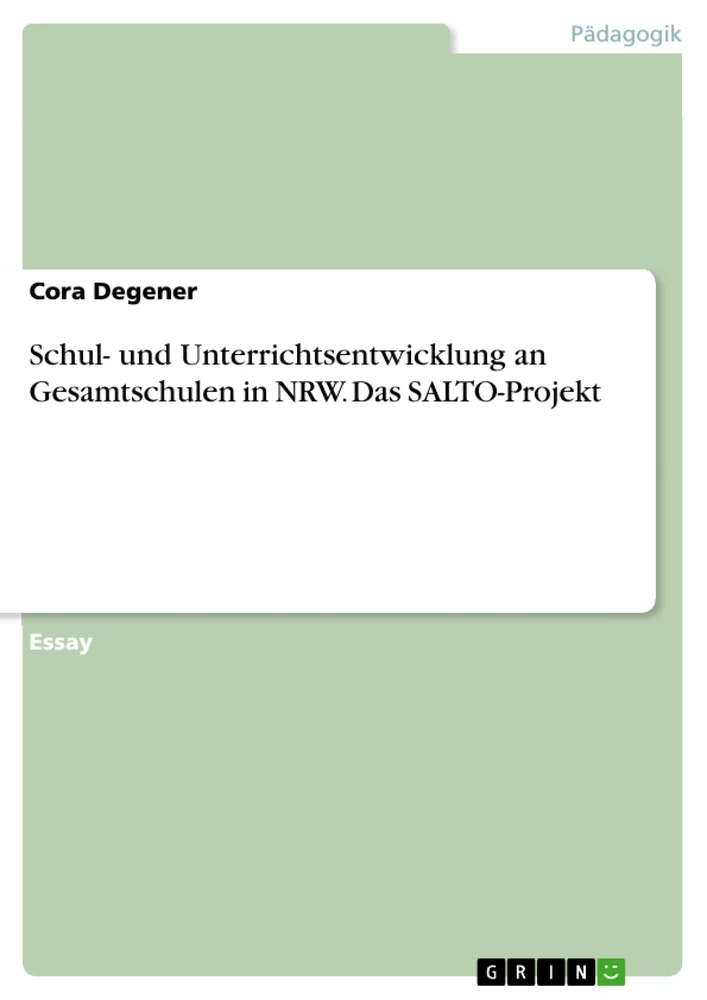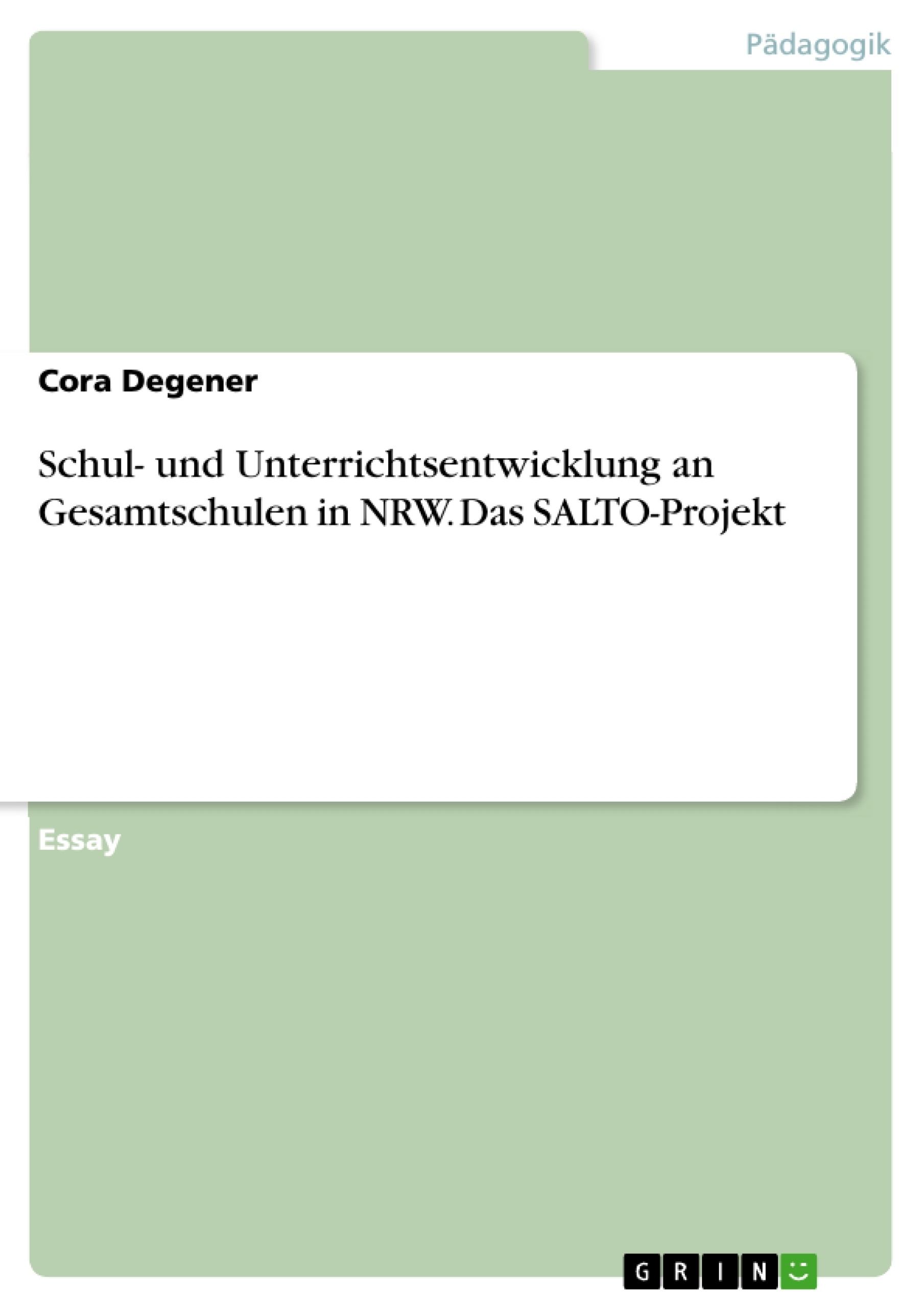In dieser wissenschaftlichen Reflexion wird sich mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung an Gesamtschulen in NRW auseinandergesetzt. Genauer unter die Lupe genommen, wird die Unterrichtsentwicklung in Projekten an drei Gesamtschulen in NRW. Nach einer vorherigen Auseinandersetzung mit einschlägiger wissenschaftlicher Literatur wurden Schul- und Unterrichtsbesuche vorgenommen sowie Interviews mit Lehrern und Schulleitern durchgeführt, die dazu dienen den derzeitigen Stand der Unterrichtsentwicklung in Projekten an den drei Gesamtschulen in NRW zu reflektieren.
Durch heterogene Klassen und wachsende Vielfalt, nicht zuletzt durch den Migrantenzuwachs sehen sich Schulen in einer stetigen Auseinandersetzung mit dem Thema individueller Förderung, weshalb Unterrichtsentwicklung an Aktualität mehr denn je gewinnt.
Inhaltsverzeichnis
- Unterrichtsentwicklung in Projekten
- SALTO-Projekt
- Individualisierung von Lernprozessen
- Lerndorfmodell
- Teamfähigkeit und Kooperation
- Duisburger Sprachtest
- Buddy-Projekt
- Teamschulen im Netzwerk
- Schulen im Team
- Zusammenarbeit und gegenseitige Hospitationen
- Inklusionsthematik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Unterrichtsentwicklungsprojekten auf die Lernprozesse und Arbeitsbedingungen an Gesamtschulen. Sie fokussiert auf das SALTO-Projekt, das an drei Schulen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird, um die Individualisierung von Lernprozessen und die Förderung der Schülermotivation zu verbessern.
- Individualisierung von Lernprozessen
- Teamfähigkeit und Kooperation
- Inklusion und Sprachförderung
- Schülermotivation und -engagement
- Bewertung der Effektivität von Unterrichtsentwicklungsprojekten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet zunächst die Notwendigkeit von Unterrichtsentwicklung und die Rolle von Schulnetzwerken. Anschließend werden die Ziele und die Umsetzung des SALTO-Projekts an den drei beteiligten Schulen vorgestellt. Dabei werden die verschiedenen Ansätze zur Individualisierung von Lernprozessen, die Förderung der Teamfähigkeit und die Integration von Inklusion und Sprachförderung in den Unterricht beschrieben. Schließlich wird die Effektivität des SALTO-Projekts anhand von Schüler- und Lehrerbefragungen sowie anhand von Beobachtungen im Unterricht analysiert.
Schlüsselwörter
Unterrichtsentwicklung, Schulnetzwerke, SALTO-Projekt, Individualisierung, Lernmotivation, Teamfähigkeit, Inklusion, Sprachförderung, Schülerengagement, Effektivität, Gesamtschulen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des SALTO-Projekts?
Das Ziel ist die Individualisierung von Lernprozessen und die Steigerung der Schülermotivation an Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen.
Wie wird Individualisierung im Projekt umgesetzt?
Durch Modelle wie das „Lerndorfmodell“, Sprachförderung (z. B. Duisburger Sprachtest) und das Buddy-Projekt wird auf die Vielfalt der Schüler eingegangen.
Welche Rolle spielen Schulnetzwerke wie „Schulen im Team“?
Sie ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Schulen, gegenseitige Hospitationen und den Austausch über Inklusionsthematiken.
Wie wird die Teamfähigkeit der Schüler gefördert?
Das Projekt legt großen Wert auf Kooperation und soziales Lernen, um die Schüler auf heterogene Anforderungen vorzubereiten.
Wie wurde die Effektivität des Projekts gemessen?
Die Untersuchung basierte auf Unterrichtsbesuchen, Interviews mit Lehrern und Schulleitern sowie Schülerbefragungen.
- Quote paper
- Cora Degener (Author), 2016, Schul- und Unterrichtsentwicklung an Gesamtschulen in NRW. Das SALTO-Projekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338833