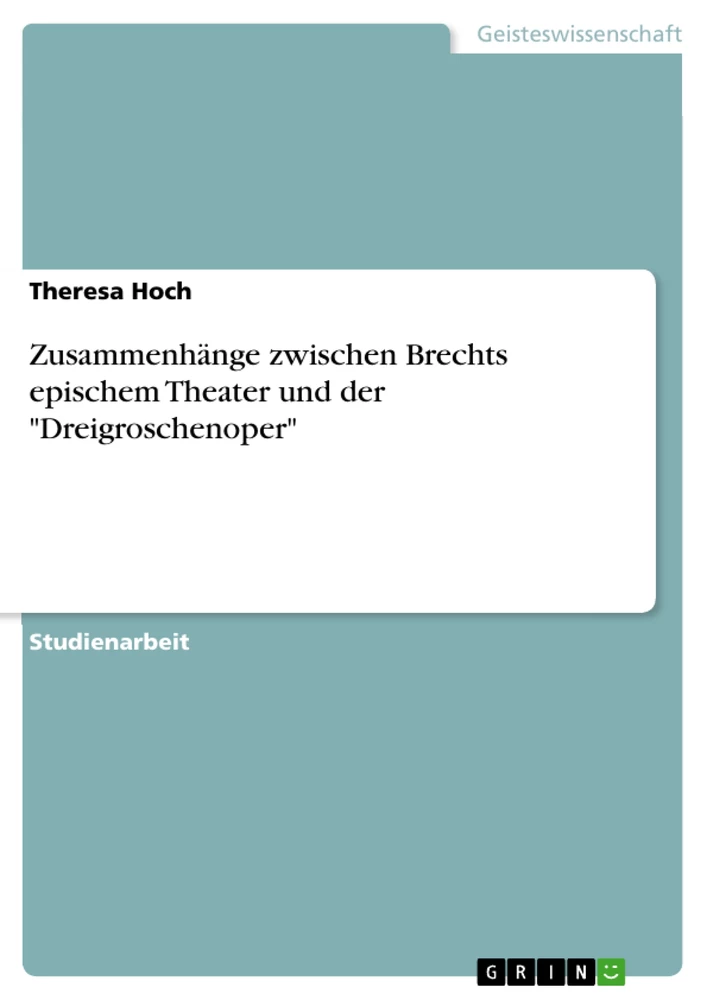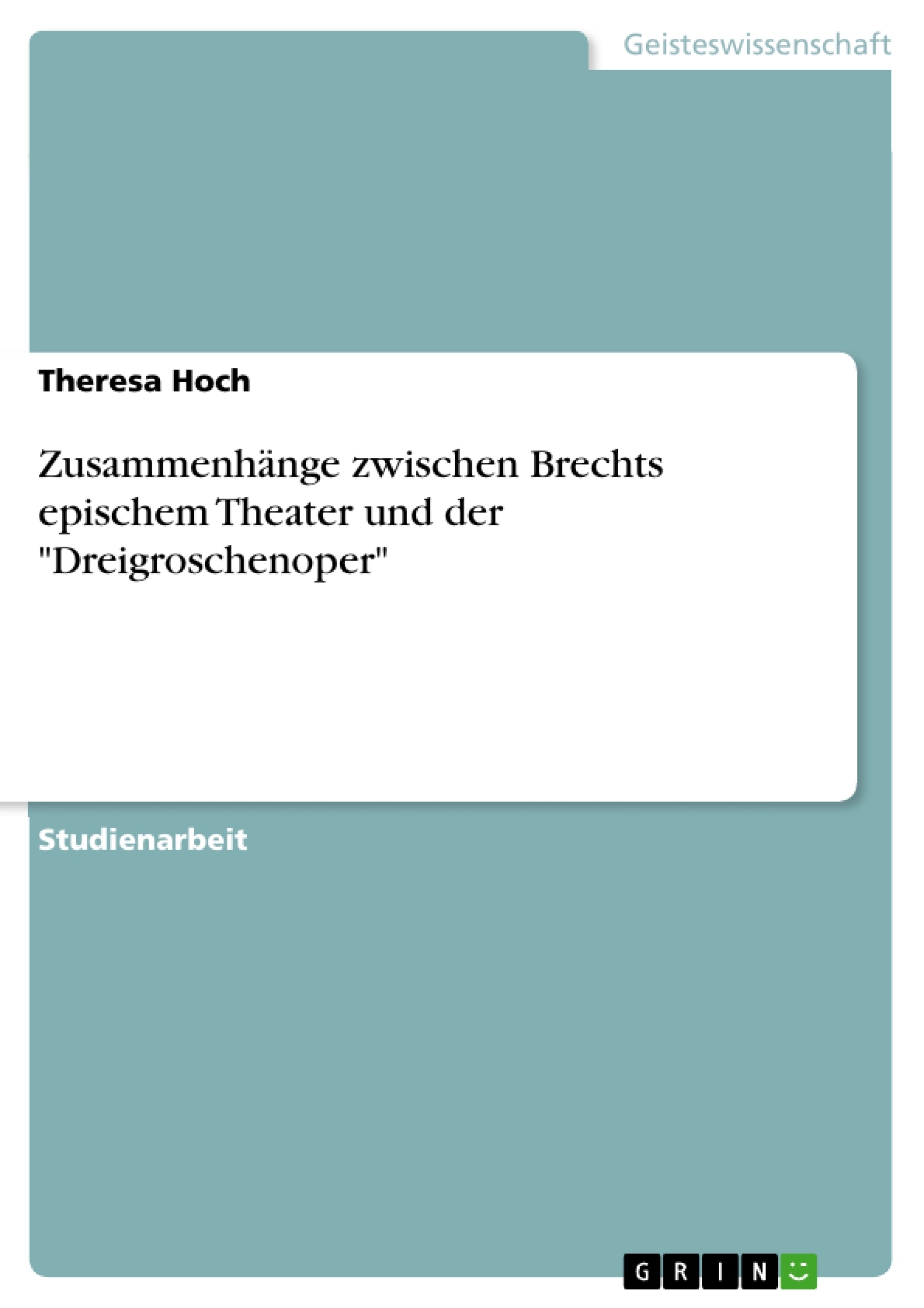Die vorliegende Arbeit soll sich mit der Frage auseinandersetzen, ob und inwiefern es mögliche Korrespondenzen zwischen Brechts epischem Theater und der „Dreigroschenoper“ gibt. Wie verhalten sich beide zueinander? Lassen sich Elemente des epischen Theaters in der „Dreigroschenoper“ finden?
Die „Dreigroschenoper“ gilt als Brechts bekanntestes Werk und zählt weltweit zu den meistgespielten Theaterstücken. Als Vorbild diente „The Beggar's Opera“ von John Gay aus dem Jahre 1728. Uraufgeführt wurde die „Dreigroschenoper“ am 31.8.1928 in Berlin im Theater am Schiffbauerdamm.
Brecht wendet sich sowohl im epischen Theater als auch in der „Dreigroschenoper“ von Stilmitteln des klassischen Dramas ab. Mit seiner Konzeption des epischen Theaters gilt er zugleich gewissermaßen als Begründer des modernen Dramas.
Inwiefern diese stilistischen Neuerungen auch auf die „Dreigroschenoper“ zutreffen, soll innerhalb dieser Arbeit untersucht werden.
Um sich der genannten Fragestellung anzunähern, soll zunächst versucht werden darzustellen, welchen Merkmalen, Besonderheiten oder auch historischen Hintergründen Brechts episches Theater unterliegt.
Es wird im Anschluss der Versuch unternommen, eine mögliche Antwort auf die Frage zu finden, welcher Werkgattung die „Dreigroschenoper“ zugehört. Schließlich soll dargestellt werden, welche Stilmittel des epischen Theaters sich möglicherweise in der „Dreigroschenoper“ finden lassen. Dabei sollen deren Inhalt, Text, Musik und vor allem auch die Darstellungsweise in die Auseinandersetzung einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über Brecht und das epische Theater
- Über die Unterschiede zwischen klassischem Drama und epischem Theater
- Über den Verfremdungseffekt
- Über die Musik oder die „Misuk“
- Über die Dreigroschenoper
- Über Elemente des epischen Theaters in der Dreigroschenoper
- Zur Gesellschaftskritik in der Dreigroschenoper
- Zur Abkehr vom klassischen Drama
- Über Verfremdungstechniken in der Dreigroschenoper
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern Brechts episches Theater und die „Dreigroschenoper“ miteinander korrespondieren. Sie untersucht, ob Elemente des epischen Theaters in der „Dreigroschenoper“ zu finden sind und beleuchtet die stilistischen Neuerungen, die Brecht sowohl im epischen Theater als auch in der „Dreigroschenoper“ einsetzt.
- Brechts episches Theater und seine Merkmale
- Die „Dreigroschenoper“ als Werkgenre
- Stilmittel des epischen Theaters in der „Dreigroschenoper“
- Analyse von Inhalt, Text, Musik und Darstellungsweise der „Dreigroschenoper“
- Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Aufbau der Untersuchung. Das zweite Kapitel widmet sich Brechts epischem Theater und dessen Zielen, insbesondere der politischen Erziehung des Zuschauers. Das dritte Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen dem klassischen Drama und dem epischen Theater, wobei Brechts Abkehr von der aristotelischen Dramenlehre im Vordergrund steht. Im vierten Kapitel wird die „Dreigroschenoper“ in Bezug auf die Merkmale des epischen Theaters untersucht, wobei Inhalt, Text, Musik und Darstellungsweise beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Brecht, episches Theater, Dreigroschenoper, klassisches Drama, Verfremdungseffekt, Gesellschaftskritik, politische Erziehung, Lehrstücktheorie, Dramenlehre, Aristoteles, Musik, Darstellungsweise.
Häufig gestellte Fragen zu Brecht und der Dreigroschenoper
Was ist das Ziel der Arbeit über die Dreigroschenoper?
Die Arbeit untersucht, ob und wie Elemente von Bertolt Brechts epischem Theater in der „Dreigroschenoper“ umgesetzt wurden.
Welches Werk diente als Vorlage für die Dreigroschenoper?
Als Vorbild diente „The Beggar's Opera“ von John Gay aus dem Jahr 1728.
Was versteht Brecht unter dem Verfremdungseffekt?
Es handelt sich um ein Stilmittel, das die Identifikation des Zuschauers mit dem Geschehen verhindert, um eine kritische Reflexion zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Musik in der Dreigroschenoper?
Brecht nutzt Musik (oft als „Misuk“ bezeichnet) als eigenständiges Element, das die Handlung unterbricht und kommentiert, statt sie nur zu untermalen.
Wie unterscheidet sich das epische Theater vom klassischen Drama?
Das epische Theater wendet sich von der aristotelischen Dramenlehre ab und zielt auf die politische Erziehung statt auf emotionale Katharsis.
Wann und wo wurde die Dreigroschenoper uraufgeführt?
Die Uraufführung fand am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin statt.
- Quote paper
- Theresa Hoch (Author), 2016, Zusammenhänge zwischen Brechts epischem Theater und der "Dreigroschenoper", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338836