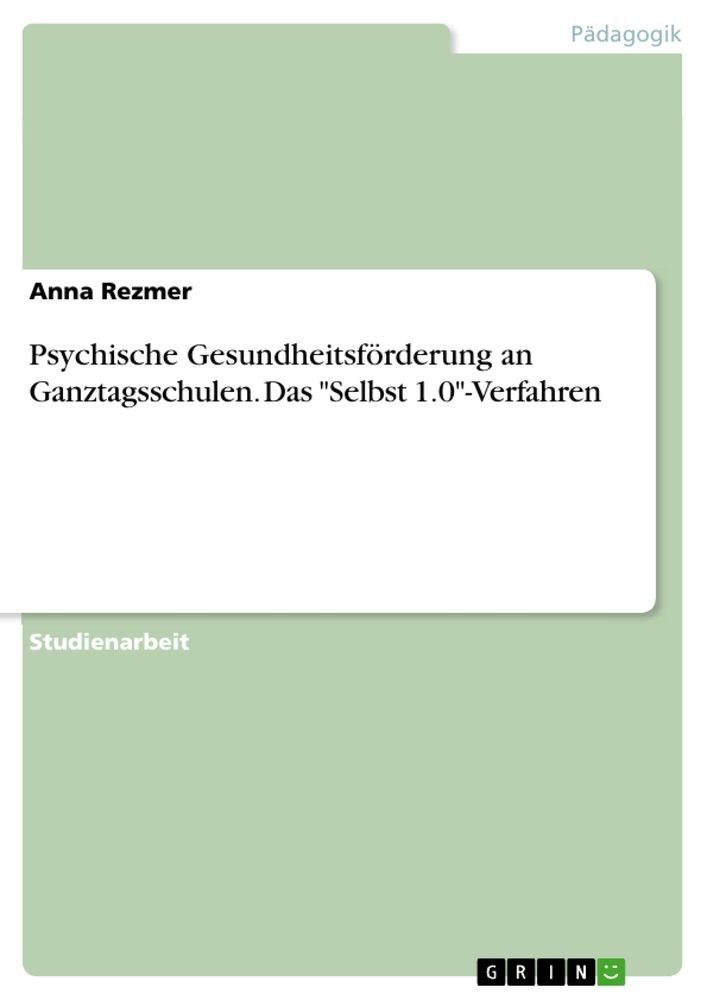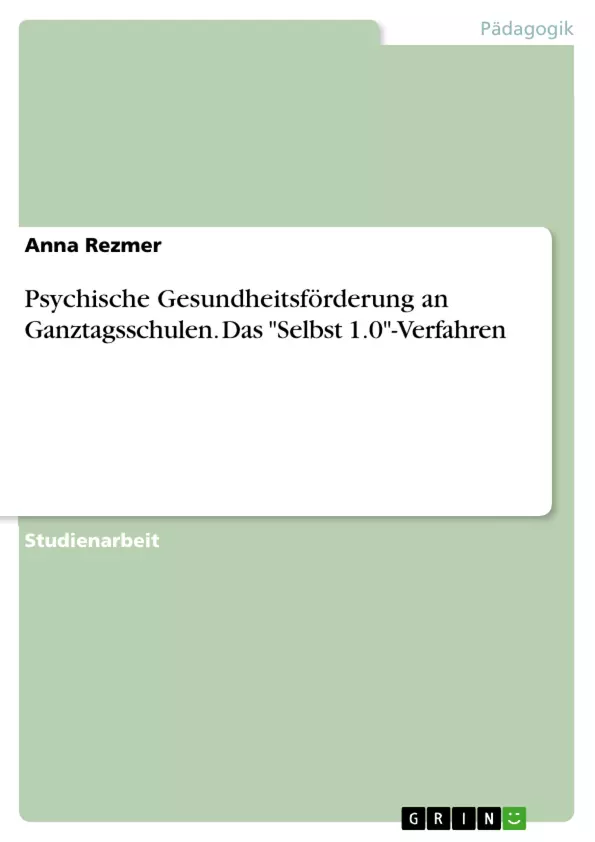Die Hausarbeit durchleuchtet die Gestaltung von Ganztagsschulen mit dem Schwerpunkt der psychischen Gesundheitsförderung von Schüler und Schülerinnen. Anhand des Verfahrens „Selbst 1.0 – Selbsteinschätzung zur Schulentwicklung mit psychischer Gesundheit“ wird versucht, die Gesundheit der Lernenden durch Vorgabe bestimmter Kontextmerkmale zu ermitteln und zu fördern.
Inwieweit sich tatsächlich positive Effekte durch das Verfahren herauskristallisieren lassen, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Zu Beginn der vorliegenden Ausarbeitung soll eine Begriffsdefinition der psychischen Gesundheit geschaffen werden, um daraufhin auf die Faktoren einer psychischen Gesundheit an Ganztagsschulen hinzuweisen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Kontextmerkmale von Eccles und Gootman gelegt, welche auf eine gesunde Ganztagsschulgestaltung abzielen. Im weiteren Verlauf erfolgt eine Vorstellung des Verfahrens „Selbst 1.0“ mit seinen Inhalten, Zielen und seiner Anwendung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff: Psychische Gesundheit
- Psychische Gesundheit an Ganztagsschulen: Kontextmerkmale nach Eccles, Gootman (2002) für ein gutes gesundes Aufwachsen
- Das Verfahren Selbst 1.0
- Positive und Negative Aspekte zur Verfahrensanwendung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gestaltung von Ganztagsschulen mit dem Fokus auf die Förderung der psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Dabei wird das Verfahren „Selbst 1.0“ analysiert, das durch die Vorgabe bestimmter Kontextmerkmale die psychische Gesundheit von Lernenden ermitteln und fördern soll. Die Arbeit beleuchtet die Effektivität des Verfahrens und untersucht, inwieweit sich positive Effekte durch seine Anwendung erzielen lassen.
- Definition und Bedeutung psychischer Gesundheit
- Kontextmerkmale für eine gesunde Ganztagsschule nach Eccles und Gootman
- Das Verfahren „Selbst 1.0“ und seine Anwendung
- Positive und negative Aspekte der Verfahrensanwendung
- Diskussion der Effektivität des Verfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der psychischen Gesundheitsförderung an Ganztagsschulen heraus und führt in die Thematik der Hausarbeit ein. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der psychischen Gesundheit definiert und es werden wichtige Merkmale für ein psychisches Wohlbefinden erläutert. Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von Kontextmerkmalen für eine gesunde Ganztagsschulgestaltung, insbesondere die acht Merkmale nach Eccles und Gootman. Das Verfahren „Selbst 1.0“ wird im vierten Kapitel vorgestellt, inklusive seiner Inhalte, Ziele und Anwendungsmöglichkeiten. Das Fazit und der Ausblick befassen sich mit der Effektivität des Verfahrens und diskutieren positive und negative Kriterien für seine Anwendung.
Schlüsselwörter
Psychische Gesundheit, Ganztagsschule, Schulentwicklung, Selbst 1.0, Kontextmerkmale, Eccles und Gootman, Präventionsdilemma, soziales Dilemma der Gesundheitsförderung, gesunde Entwicklung, Schülerwohl, Wohlbefinden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'Selbst 1.0'-Verfahren?
Es handelt sich um ein Verfahren zur Selbsteinschätzung der Schulentwicklung mit dem Fokus auf die psychische Gesundheit der Schüler.
Welche Rolle spielen Eccles und Gootman in dieser Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf die acht Kontextmerkmale nach Eccles und Gootman, die eine gesunde Gestaltung von Ganztagsschulen definieren.
Warum ist psychische Gesundheitsförderung an Ganztagsschulen wichtig?
Da Schüler viel Zeit in der Schule verbringen, ist die Gestaltung des Umfelds entscheidend für ihr Wohlbefinden und eine gesunde Entwicklung.
Welche Aspekte werden bei der Anwendung von 'Selbst 1.0' kritisch hinterfragt?
Die Arbeit diskutiert sowohl positive als auch negative Aspekte, darunter das Präventionsdilemma und die tatsächliche Effektivität des Verfahrens.
Was sind Schlüsselwörter dieser Untersuchung?
Schlüsselwörter sind Psychische Gesundheit, Schulentwicklung, Präventionsdilemma, Schülerwohl und Ganztagsschule.
- Citar trabajo
- Anna Rezmer (Autor), 2013, Psychische Gesundheitsförderung an Ganztagsschulen. Das "Selbst 1.0"-Verfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338964