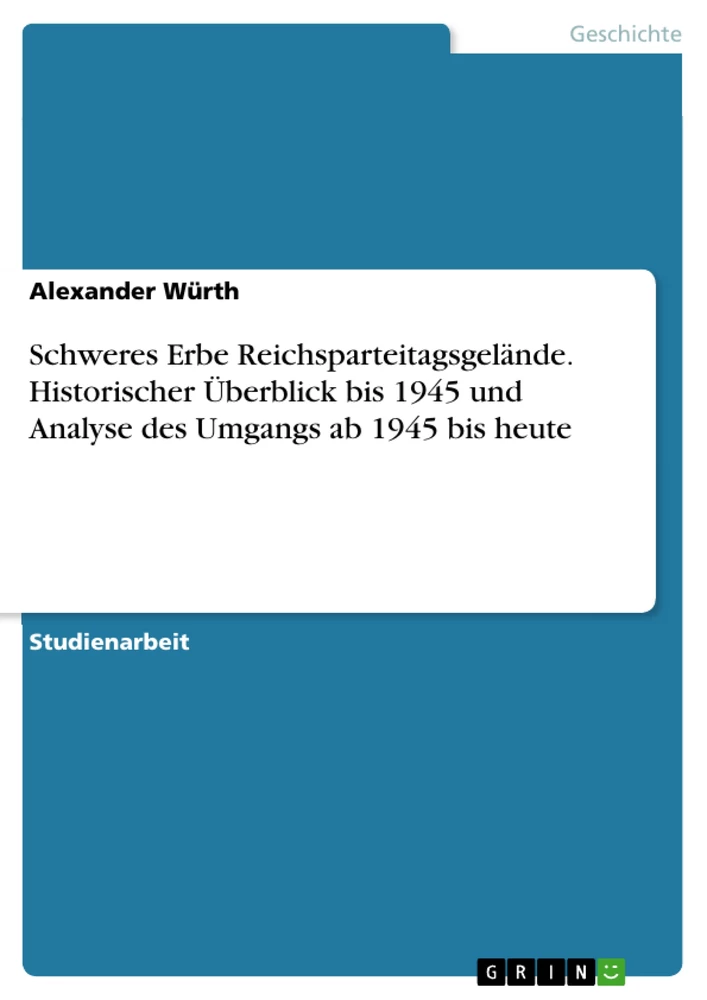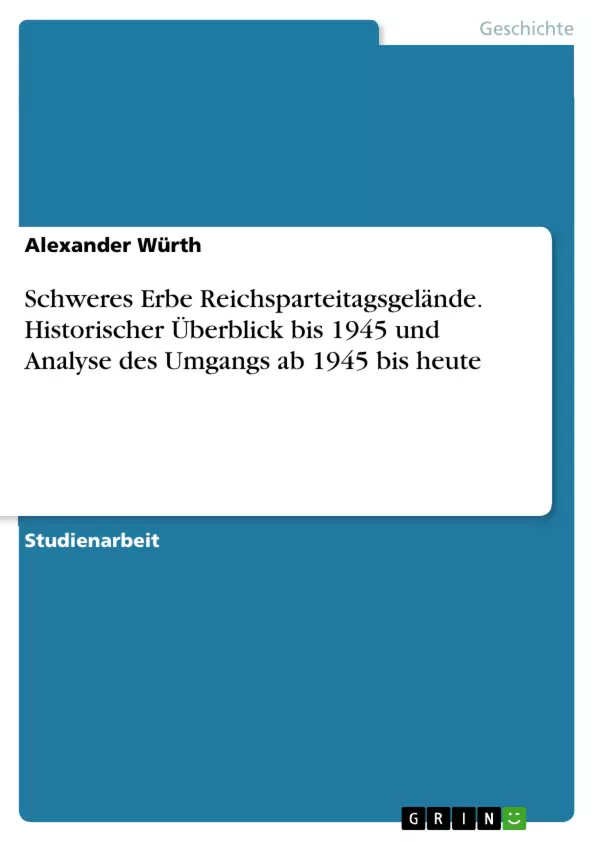Das Reichsparteitagsgelände Nürnberg ist – wie jeder historische Ort – einzigartig. Die bis heute teilweise erhaltenen Bauten bilden das größte Ensemble der nationalsozialistischen Staats- und Parteitagsarchitektur. An diesen Bauten lässt sich noch heute der durch Architektur ins Werk gesetzte Macht- und Herrschaftsanspruch des Dritten Reiches ablesen.
Die Arbeit soll der Frage nachgehen, unter welchen politischen Voraussetzungen diese Bauten entstanden sind, welchen Zweck sie hatten und schließlich wie diese Bauten gewirkt haben. Im Zweiten Teil wird aufgezeigt, wie mit den Reichsparteitagsbauten und ihren Überresten seit 1945 umgegangen wurde und wird und welche Kontroversen und Schwierigkeiten sich dabei ergaben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- I Historischer Überblick: Reichsparteitagsgelände bis 1945
- I.1 Einleitung
- I.1.1 Kontext
- I.1.2 Fragestellung und Methode
- I.2 Hauptteil: Das Gelände
- I.2.1 Rahmenbedingungen
- I.2.1.1 Politisch und historisch
- I.2.1.2 Infrastruktur
- I.2.2 Die Bauten
- I.2.2.1 Luitpoldarena und erste Provisorien
- I.2.2.2 Luitpoldhalle
- I.2.2.3 Kongresshalle und Große Straße
- I.2.2.4 Zeppelintribüne und Zeppelinfeld
- I.2.2.5 Deutsches Stadion
- I.2.2.6 Märzfeld
- I.2.2.7 Sonstige Bauten
- I.2.3 Die Architekten
- I.2.3.1 Ludwig und Franz Ruff
- I.2.3.2 Albert Speer
- I.2.4 Wirkung der Bauten
- I.2.1 Rahmenbedingungen
- I.3 Schluss
- I.3.1 Zusammenfassung und Bewertung
- I.3.2 Ausblick
- I.1 Einleitung
- II Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände bis heute
- II.1 Einleitung
- II.1.1 Kontext
- II.1.2 Fragestellung und Methode
- II.2 Hauptteil: Schweres Erbe
- II.2.1 Kriegsende und erste Nutzung
- II.2.1.1 Bilanz
- II.2.1.2 Wohnungsnot
- II.2.1.3 Aufräumarbeiten
- II.2.1.4 Zurück zum Ursprung
- II.2.1.5 Weiternutzung
- II.2.2 Verdrängung der Vergangenheit
- II.2.2.1 Beseitigungen
- II.2.2.2 Neue Konzepte
- II.2.3 Aufarbeitung
- II.2.3.1 Faszination und Gewalt
- II.2.3.2 Dokumentationszentrum
- II.2.3.3 Städtebauliche Neukonzeption
- II.2.4 Kontroverse um künftigen Umgang
- II.2.4.1 Denkmalschutz
- II.2.4.2 Baulicher Zustand
- II.2.4.3 Positionen der Stadt Nürnberg
- II.2.4.4 Andere Positionen
- II.2.4.5 Zusammenfassung
- II.2.1 Kriegsende und erste Nutzung
- II.3 Schluss
- II.3.1 Ergebnis
- II.3.2 Ausblick
- II.1 Einleitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg, von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Ziel ist es, die politischen Hintergründe der Errichtung der Bauten, deren Zweck und ihre Wirkung zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der Zeit bis 1945 und der anschließenden Auseinandersetzung mit dem "schweren Erbe".
- Die politische und historische Entwicklung des Reichsparteitagsgeländes.
- Die Architektur und Symbolik der NS-Bauten.
- Der Umgang mit dem Gelände nach 1945: Verdrängung, Aufarbeitung und Kontroversen.
- Die Bedeutung des Geländes als Erinnerungsort.
- Städtebauliche Konzepte und Denkmalschutzfragen.
Zusammenfassung der Kapitel
I Historischer Überblick: Reichsparteitagsgelände bis 1945: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Es beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen, die zur Errichtung dieser monumentalen Bauten führten, beschreibt detailliert die einzelnen Gebäude (Luitpoldarena, Kongresshalle, Zeppelinfeld etc.) und deren Architekten (u.a. Albert Speer), und analysiert die beabsichtigte Wirkung dieser Architektur auf die Bevölkerung und die internationale Wahrnehmung des NS-Regimes. Die Kapitel unterstreichen die enge Verbindung zwischen Architektur, Machtdemonstration und Propaganda im Nationalsozialismus.
II Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände bis heute: Dieses Kapitel analysiert den komplexen Umgang mit dem "schweren Erbe" des Reichsparteitagsgeländes nach 1945. Es beschreibt die unterschiedlichen Phasen der Nutzung, von der unmittelbaren Nachkriegszeit mit Wohnungsnot und Aufräumarbeiten über die teilweise Verdrängung der Vergangenheit bis hin zu den Bemühungen um Aufarbeitung und die Einrichtung des Dokumentationszentrums. Besonderes Augenmerk liegt auf den anhaltenden Kontroversen um Denkmalschutz, städtebauliche Konzepte und die angemessene Erinnerungskultur an diesem Ort. Die Kapitel beleuchten die Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit stellen, mit einer historisch belasteten Architektur umzugehen.
Schlüsselwörter
Reichsparteitagsgelände, Nürnberg, Nationalsozialismus, Architektur, Machtdemonstration, Propaganda, Albert Speer, Erinnerungsort, Aufarbeitung der Vergangenheit, Denkmalschutz, Kontroversen, Städtebau.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Reichsparteitagsgelände Nürnberg
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg, von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Sie untersucht die politischen Hintergründe, die Architektur, die Symbolik der NS-Bauten, den Umgang mit dem Gelände nach 1945 (Verdrängung, Aufarbeitung, Kontroversen), und die Bedeutung des Geländes als Erinnerungsort. Ein Schwerpunkt liegt auf der Zeit bis 1945 und der anschließenden Auseinandersetzung mit dem "schweren Erbe".
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert die politische und historische Entwicklung des Geländes, die Architektur und Symbolik der NS-Bauten (mit Beschreibung einzelner Gebäude wie Luitpoldarena, Kongresshalle, Zeppelinfeld etc. und deren Architekten, z.B. Albert Speer), den Umgang mit dem Gelände nach 1945 (Kriegsende, Aufräumarbeiten, Verdrängung der Vergangenheit, Aufarbeitung, Dokumentationszentrum), die Kontroversen um Denkmalschutz und städtebauliche Konzepte, sowie die Bedeutung des Geländes als Erinnerungsort.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel I ("Historischer Überblick: Reichsparteitagsgelände bis 1945") beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Geländes bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Kapitel II ("Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände bis heute") analysiert den Umgang mit dem "schweren Erbe" nach 1945, einschließlich der Herausforderungen im Umgang mit einer historisch belasteten Architektur.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Kapitel I bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Reichsparteitagsgeländes bis 1945, beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen, beschreibt die einzelnen Gebäude und deren Architekten, und analysiert die Wirkung der Architektur. Kapitel II analysiert den komplexen Umgang mit dem Gelände nach 1945, von der Nachkriegszeit über die Verdrängung der Vergangenheit bis hin zur Aufarbeitung und den anhaltenden Kontroversen um Denkmalschutz und Erinnerungskultur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Reichsparteitagsgelände, Nürnberg, Nationalsozialismus, Architektur, Machtdemonstration, Propaganda, Albert Speer, Erinnerungsort, Aufarbeitung der Vergangenheit, Denkmalschutz, Kontroversen, Städtebau.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes, beleuchtet die politischen Hintergründe der Errichtung der Bauten, deren Zweck und Wirkung. Der Fokus liegt auf der Zeit bis 1945 und der anschließenden Auseinandersetzung mit dem "schweren Erbe".
- Quote paper
- Alexander Würth (Author), 2016, Schweres Erbe Reichsparteitagsgelände. Historischer Überblick bis 1945 und Analyse des Umgangs ab 1945 bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339250