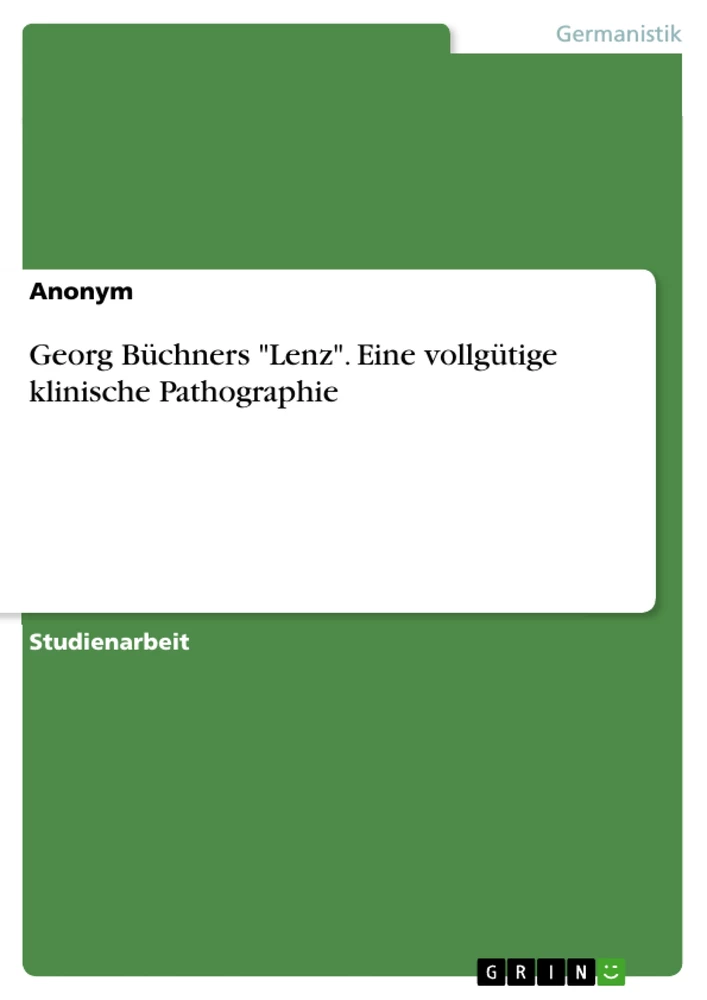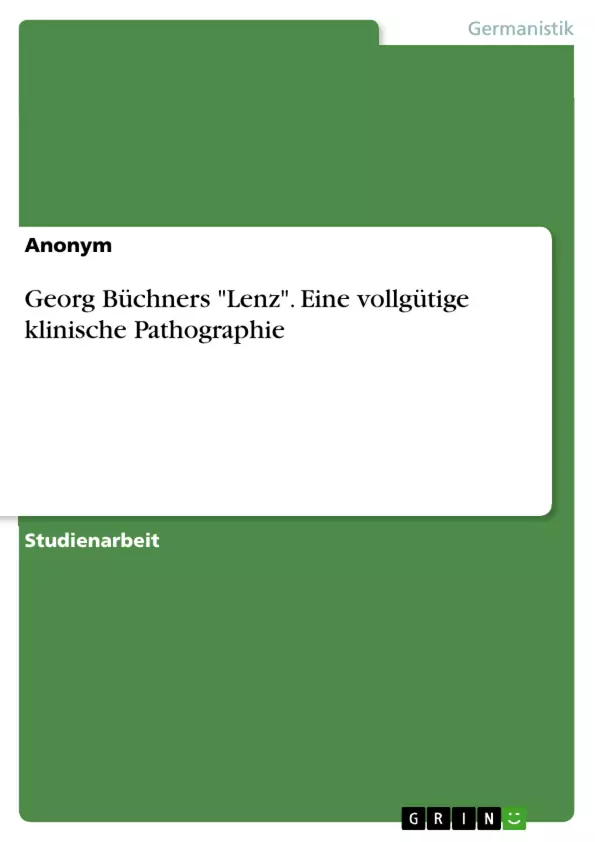Büchners Novelle „Lenz“ stellt sich unzweifelhaft jedem Leser als befremdende und eigentümliche Schilderung einer Begebenheit dar, die heute nicht nur für die Literaturwissenschaft, sondern auch in hohem Masse für die Psychologie interessant erscheint. Seit ihrer Entstehung beschäftigt sich die Forschung mit der Frage, ob es sich bei Georg Büchners Schilderung um die sehr genaue Darstellung dessen handelt, das erst einige Jahre später als die Krankheit „Schizophrenie“ bezeichnet werden wird. In der folgenden Ausarbeitung möchte ich der Frage nachgehen, ob das Novellenfragment „Lenz“ von Georg Büchner tatsächlich als frühe Studie und als frühe Darstellung einer manifesten Schizophrenie gelten kann.
Dafür werde ich zunächst darstellen, was die moderne Psychologie unter dem Krankheitsbild der Schizophrenie versteht und ich werde dann die Novelle Büchners dazu in Beziehung setzen. Die Symptome der Gemütskrankheit sollen dabei in Büchners Darstellung der literarischen Figur Lenz nachgewiesen werden. Ich werde zunächst einen kurzen Einblick in den historischen Hintergrund zu Büchners Erzählung geben und die Vorlage, den Bericht des Pfarrers Oberlin, vorstellen. Im Folgenden soll dann besonders untersucht werden, mit welchen Mitteln Georg Büchner die Schizophrenie erzählerisch verarbeitet und welche Unterschiede sich bei einem Vergleich mit der historischen Vorlage ergeben. Außerdem möchte ich der Frage nachgehen, welche Motive den Philosophen und Naturwissenschaftler Georg Büchner dazu bewogen haben, sich in seiner Novelle mit der damals unerforschten Geisteskrankheit so eingehend zu beschäftigen. In meiner abschließenden Bewertung werde ich die Ergebnisse zusammenfassen und einen Kommentar zu der eingangs gestellten Frage, ob und warum die Novelle „Lenz“ in der Tat als Pathographie gelten darf, abgeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Klärung des Themas
- 2. Schizophrenie - Definition und Geschichte
- 3. Die Schizophrenie in Büchners Novelle „Lenz“
- 3.1 Der historische Hintergrund – Lenz und Oberlin
- 3.2 Die Darstellung der Schizophrenie in der Figur Lenz
- 3.3 Der Oberlin-Bericht im Vergleich mit Büchners Novellenfragment
- 3.4 Wahnsinn als Topos
- 4. Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht, ob Georg Büchners Novelle „Lenz“ als frühe Darstellung einer manifesten Schizophrenie interpretiert werden kann. Die Arbeit setzt Büchners Schilderung in Beziehung zur modernen psychologischen Definition der Schizophrenie und analysiert die Darstellung der Krankheit in der Figur Lenz. Der historische Kontext, insbesondere der Oberlin-Bericht als Vorlage, wird berücksichtigt. Schließlich wird die Frage nach den Motiven Büchners für die Auseinandersetzung mit diesem Thema untersucht.
- Darstellung der Schizophrenie in Büchners „Lenz“
- Vergleich zwischen Büchners Darstellung und dem Oberlin-Bericht
- Analyse der Symptome der Schizophrenie in der Figur Lenz
- Der historische Kontext der Geisteskrankheit
- Büchners Motive für die Auseinandersetzung mit dem Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Klärung des Themas: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage auf: Kann Büchners „Lenz“ als frühe Darstellung der Schizophrenie verstanden werden? Es wird der Forschungsansatz skizziert, der die moderne psychologische Definition der Schizophrenie mit Büchners Novelle verbindet und die Symptome der Krankheit in Lenz nachweisen möchte. Die Arbeit verspricht eine Untersuchung des historischen Hintergrunds, einen Vergleich mit dem Oberlin-Bericht und eine Analyse von Büchners Motiven. Die Einleitung legt den Grundstein für eine detaillierte Analyse der Darstellung von psychischer Erkrankung in einem literarischen Werk.
2. Schizophrenie – Definition und Geschichte: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Schizophrenie, beginnend mit ihrer Definition in der modernen Psychologie. Es wird der Unterschied in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von körperlichen und psychischen Krankheiten hervorgehoben. Die Geschichte der Schizophrenie wird kurz skizziert, beginnend mit frühen Belegen aus der Steinzeit bis hin zu Kraeplins Beschreibung der "Dementia praecox". Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der Beschreibung von Symptomen aufgrund der Variabilität von Ursachen und Verlauf der Krankheit. Es werden verschiedene Arten von Störungen beschrieben, die für die Schizophrenie charakteristisch sind, einschließlich assoziativer Störungen, affektiver Inkongruenz und Ambivalenz, sowie weitere begleitende Symptome wie Halluzinationen und Wahnideen. Das Kapitel betont die Bedeutung des Werkes von Emil Kraeplin und Silvano Arieti für das Verständnis der Schizophrenie.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Lenz, Novelle, Schizophrenie, Dementia praecox, Emil Kraeplin, Silvano Arieti, Oberlin-Bericht, Geisteskrankheit, Psychopathographie, Literaturwissenschaft, Psychologie, Wahnsinn, Symptome, historische Kontext.
Häufig gestellte Fragen zu Georg Büchners Novelle "Lenz" und der Darstellung von Schizophrenie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob Georg Büchners Novelle "Lenz" als frühe Darstellung einer manifesten Schizophrenie interpretiert werden kann. Sie vergleicht Büchners Schilderung mit der modernen psychologischen Definition der Schizophrenie und analysiert die Darstellung der Krankheit in der Figur Lenz, unter Berücksichtigung des historischen Kontextes und des Oberlin-Berichts als Vorlage. Die Motive Büchners für die Auseinandersetzung mit diesem Thema werden ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Klärung des Themas; 2. Schizophrenie - Definition und Geschichte; 3. Die Schizophrenie in Büchners Novelle „Lenz“ (unterteilt in 3.1 Der historische Hintergrund – Lenz und Oberlin; 3.2 Die Darstellung der Schizophrenie in der Figur Lenz; 3.3 Der Oberlin-Bericht im Vergleich mit Büchners Novellenfragment; 3.4 Wahnsinn als Topos); 4. Abschließende Bewertung.
Wie wird die Schizophrenie in der Arbeit definiert und dargestellt?
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Schizophrenie, beginnend mit ihrer modernen psychologischen Definition. Es beleuchtet den Unterschied in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von körperlichen und psychischen Krankheiten und skizziert die Geschichte der Schizophrenie von frühen Belegen bis zu Kraeplins "Dementia praecox". Die Arbeit beschreibt verschiedene für die Schizophrenie charakteristische Störungen (assoziative Störungen, affektive Inkongruenz, Ambivalenz) und begleitende Symptome (Halluzinationen, Wahnideen). Die Bedeutung der Werke von Emil Kraeplin und Silvano Arieti wird hervorgehoben.
Wie wird Büchners „Lenz“ im Kontext der Schizophrenie analysiert?
Kapitel 3 analysiert die Darstellung der Schizophrenie in der Figur Lenz. Es berücksichtigt den historischen Hintergrund, insbesondere den Oberlin-Bericht als Vorlage, und vergleicht Büchners Darstellung mit dem Bericht. Die Analyse konzentriert sich auf die Symptome der Schizophrenie, die in Lenz erkennbar sind, und untersucht "Wahnsinn" als Topos.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Georg Büchner, Lenz, Novelle, Schizophrenie, Dementia praecox, Emil Kraeplin, Silvano Arieti, Oberlin-Bericht, Geisteskrankheit, Psychopathographie, Literaturwissenschaft, Psychologie, Wahnsinn, Symptome, historischer Kontext.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann Büchners „Lenz“ als frühe Darstellung der Schizophrenie verstanden werden?
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verbindet die moderne psychologische Definition der Schizophrenie mit Büchners Novelle und analysiert die Symptome der Krankheit in Lenz. Sie untersucht den historischen Hintergrund, vergleicht Büchners Darstellung mit dem Oberlin-Bericht und analysiert Büchners Motive.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die abschließende Bewertung (Kapitel 4) fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung wird im bereitgestellten Textfragment nicht explizit genannt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2002, Georg Büchners "Lenz". Eine vollgütige klinische Pathographie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34054