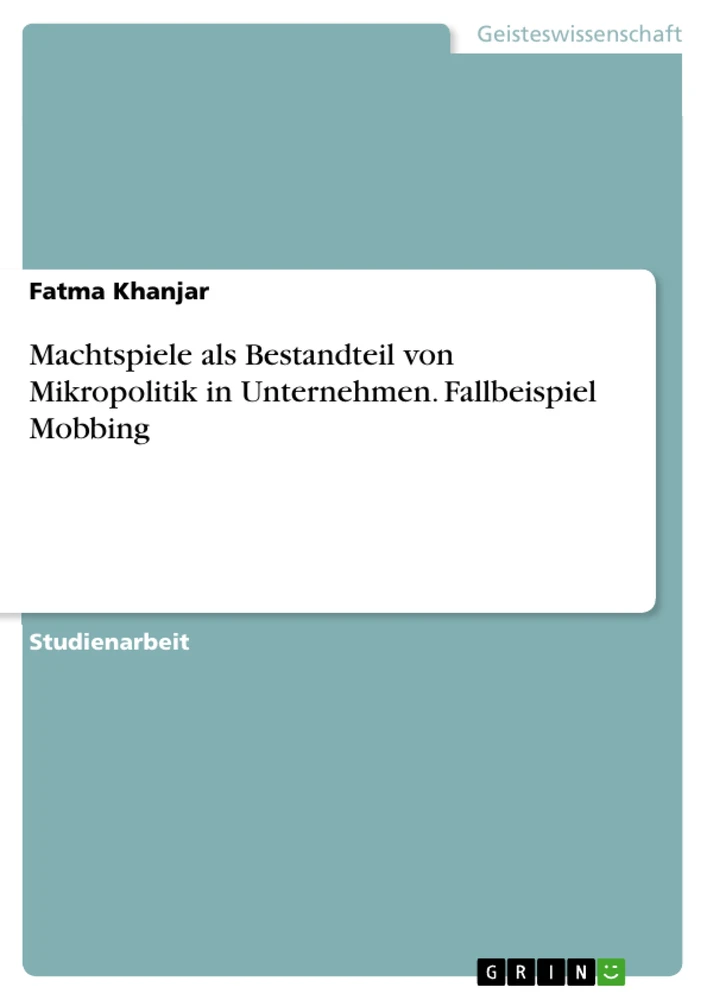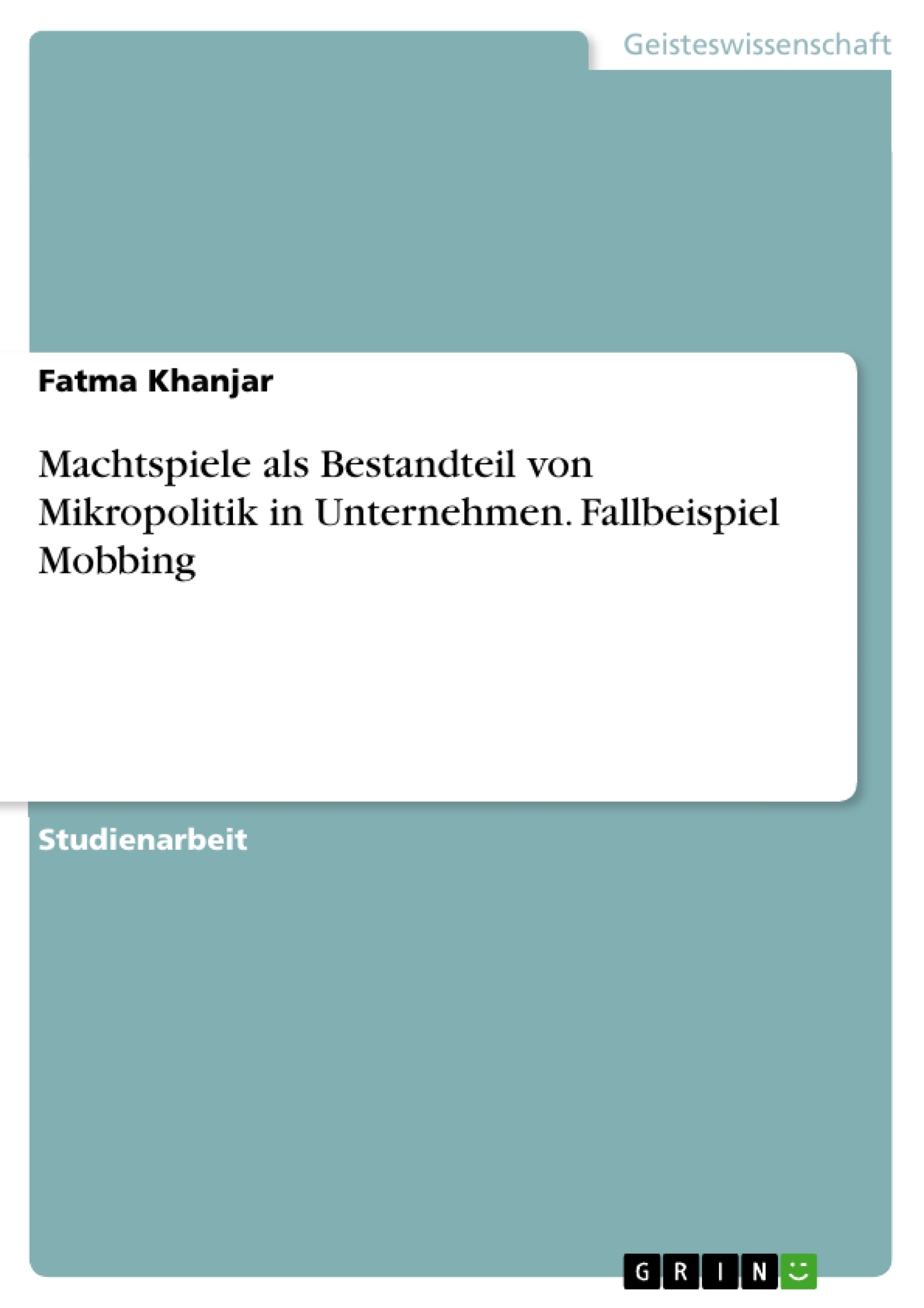Das fächerübergreifende Phänomen Mobbing wird in vielen Bereichen diskutiert, sei es in der Medizin, der Psychologie oder der Soziologie. Der gewählte Zugang dieser Arbeit ist ein organisationssoziologischer. Ziel dieser Arbeit ist es nämlich darzustellen, inwiefern das Fallbeispiel Mobbing in den Rahmen von Machtspielen passt und somit auf den mikropolitischen Ansatz anwendbar ist.
Um diese Fragestellung beantworten zu können, müssen vorerst die Bedingungen, unter denen Machtspiele überhaupt entstehen können, dargelegt werden.
Die idealtypische Definition nach Max Weber besagt, dass Macht sich auch gegen Widerstand von Menschen durchsetzen kann. Jedoch schließt Weber nicht aus, dass sie sich auch widerstandlos entfalten kann. Mit welchen Mitteln die Macht durchgesetzt wird, lässt Weber ebenfalls offen. Dies kann beispielsweise durch legitimierte Macht, nämlich Herrschaft, möglich sein, oder durch die Anwendung von Gewalt und Zwang.
Der Machtbegriff nach Max Weber bezieht sich auf das Durchsetzungsvermögen eines einzelnen Akteurs, ganz im Gegensatz zur Definition nach Michel Crozier und Erhard Friedberg. Nach ihnen ist Macht die Fähigkeit von Akteuren, Ressourcen für ihr Individualinteresse nutzen zu können und zu mobilisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Macht
- Definition
- Machtressourcen
- Mikropolitik
- Definition und Ziele der Mikropolitik
- Machtspiele
- Definition
- Konzepte und Strategien von Machtspielen
- Mobbing
- Definition
- Beteiligte am Mobbing-Prozess und angewandte Methoden
- Leymanns Phasenmodell
- Die Metapher des Spiels
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Mobbing in Unternehmen und untersucht, inwieweit Mobbing als ein Beispiel für Machtspiele im mikropolitischen Kontext betrachtet werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung der Bedingungen, die zur Entstehung von Machtspielen in Unternehmen führen, und der Analyse des Mobbingphänomens im Hinblick auf seine Zusammenhänge mit Machtstrategien und -spielen.
- Die Definition und Bedeutung von Macht in Organisationen
- Die Definition und Ziele der Mikropolitik in Unternehmen
- Machtspiele als Bestandteil der Mikropolitik und ihre Konzepte
- Mobbing als Form von Machtspielen
- Das Verhältnis zwischen Mobbing und der Metapher des Spiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mobbing und seine Relevanz in verschiedenen Lebensbereichen ein. Sie stellt die organisationssoziologische Perspektive der Arbeit vor und skizziert den Forschungsgegenstand sowie die Forschungsfrage. Die folgenden Kapitel widmen sich zunächst den Begriffen Macht und Mikropolitik und beleuchten die verschiedenen Konzepte und Strategien, die mit diesen verbunden sind. Anschließend wird Mobbing als ein spezifisches Beispiel für Machtspiele im Rahmen der Mikropolitik analysiert. Dabei werden die Definition, die Beteiligten und die typischen Mobbingmethoden erläutert. Leymanns Phasenmodell dient zur Veranschaulichung des Mobbingprozesses, und es wird erörtert, ob Mobbing als ein Spiel betrachtet werden kann. Der Ausblick geht kurz auf den rechtlichen Aspekt des Mobbings ein und stellt Präventionsmaßnahmen vor, um dem Mobbing entgegenzuwirken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Macht, Mikropolitik, Machtspiele, Mobbing, Konflikte, Unternehmen, Organisationssoziologie, Machtressourcen, Beziehungen, Strategien, Leymanns Phasenmodell, Spieltheorie, Rechtliche Aspekte, Präventionsmaßnahmen.
- Arbeit zitieren
- Fatma Khanjar (Autor:in), 2014, Machtspiele als Bestandteil von Mikropolitik in Unternehmen. Fallbeispiel Mobbing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340695