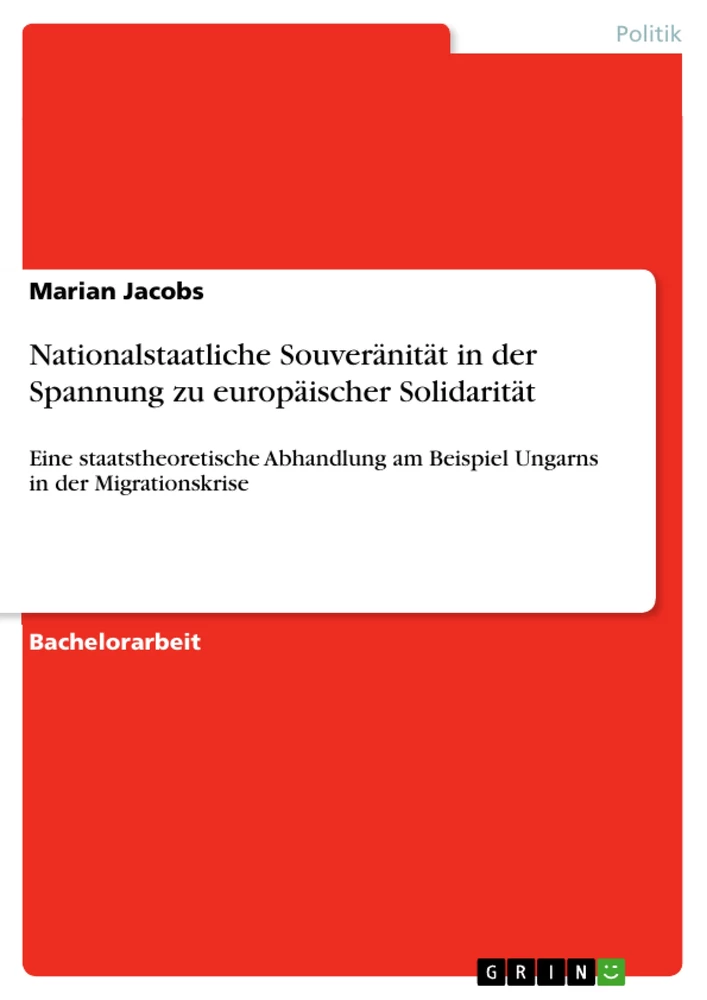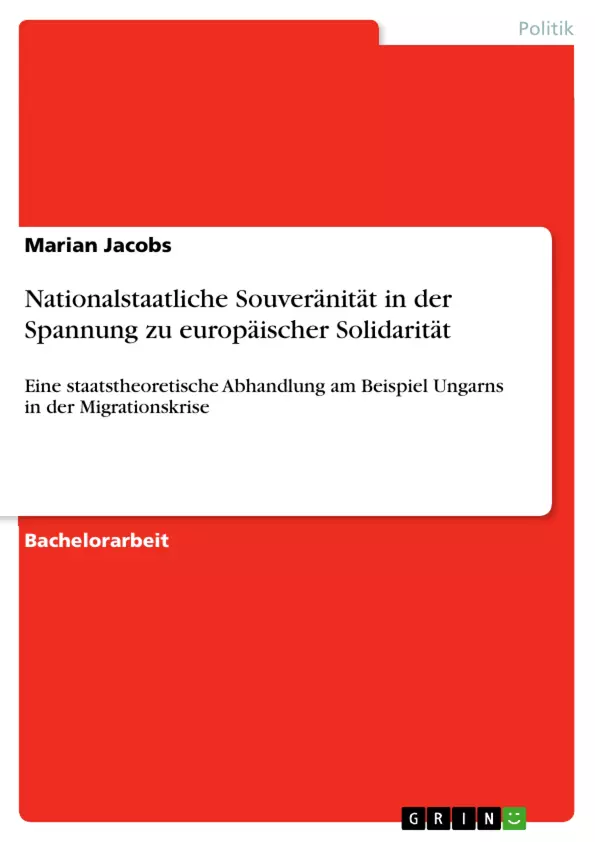Das Prinzip der nationalstaatlichen Souveränität schien über Jahrzehnte harmonisch vereinbar mit dem der Solidarität der europäischen Mitgliedstaaten, bis durch die sich zuspitzende Migrationskrise evident wurde, dass beide Prinzipien in Konflikt geraten können bzw. geraten sind – in einen Konflikt, der die Grundwerte und damit das Fundament der Europäischen Union zu gefährden vermag. Wie die Politikwissenschaftler Jürgen Neyer und Annegret Bendiek, Wissenschaftler der SWP-Forschungsgruppe EU/Europa, folgerichtig erkennen, unterzieht die Flüchtlingskrise die europäische Solidarität einem Realitätstest.3 Der in der Präambel des Vertrags von Maastricht konstatierte Wunsch, die Solidarität zwischen den Völkern und Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken, lässt grundlegend darauf schließen, dass die europäischen Mitgliedstaaten auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention gemeinsam an einer Bewältigung des Problems arbeiten wollen. Bei näherer Betrachtung der Praxis in Europa wird deutlich, dass das in dem EU-Vertrag festgelegte Solidaritätsprinzip allerdings zur Makulatur gemacht worden ist.
Um dieses Dilemma zweier an sich positiv besetzten, hier aber nicht zu vereinbarenden Prinzipien konkret herausarbeiten zu können, ist es aufschlussreich, sich der Haltung Ungarns zuzuwenden, an Hand derer sich das Problem ideal veranschaulichen lässt. Die Frage nach der Funktion intergouvernementaler Solidarität in der Migrationspolitik ist hier von übergeordneter Bedeutung. Welche Strukturen weist das europäische Solidaritätsprinzip in rechtlicher und politikwissenschaftlicher Hinsicht auf? Kann man, ausgehend von der Volkssouveränität, davon sprechen, dass die Bürger, das Wahlvolk, in Europa eine kollektive, europäische Identität verspüren, aufgrund der ein Solidaritätsgefühl bestehen und sich möglicherweise weiterentwickeln kann? Und welche Rolle spielt die Souveränität des Nationalstaates dabei? Kann man heutzutage angesichts der Komplexität internationaler Interdependenzen überhaupt noch davon sprechen?
Anhand dieser Erkenntnisse ist mir abschließend die Möglichkeit gegeben, einen Ausblick, der die Kon- bzw. Destruktion der Europäischen Union zum Gegenstand nimmt, zu entwerfen und damit die Staatstheorie mit der Staatspraxis vergleichsweise und konstruktiv zusammenzubringen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Staatliche Souveränität.
- 1. Carl Schmitt.
- 2. Hermann Heller.
- 3. Die Souveränität des modernen Verfassungsstaats - heute
- III. Nationalstaaten in der Europäischen Union.
- 1. Integration auf Basis der europäischen Vertragsgrundlage.
- 2. Das Prinzip der Solidarität
- 3. Gemeinsam ausgeübte Souveränität.
- 4. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union.
- IV. Ungarn in der Migrationskrise.
- 1. Ungarn in der europäischen Asylpolitik.
- 2. Der ungarische Souverän
- 3. Viktor Orbán – Protektor der Magyaren oder Verräter der Solidargemeinschaft?.
- V. Konklusion.
- VI. Ausblick.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text befasst sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Souveränität und Solidarität im Kontext der Europäischen Union, insbesondere im Hinblick auf die Migrationskrise. Er analysiert, wie diese beiden Prinzipien in der Praxis zusammenstoßen und welche Auswirkungen dies auf die Handlungsfähigkeit der EU hat.
- Die Bedeutung der Souveränität im Denken von Carl Schmitt und Hermann Heller.
- Die Rolle des Nationalstaates in der Europäischen Union.
- Die Herausforderungen der europäischen Solidarität im Kontext der Migrationskrise.
- Die Position Ungarns in der Migrationspolitik.
- Die Folgen des Konflikts zwischen Souveränität und Solidarität für die Zukunft der EU.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Der Text stellt das Problem des Spannungsverhältnisses zwischen Souveränität und Solidarität in der EU im Kontext der Migrationskrise dar. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Problematik der europäischen Solidarität im Kontext der Migrationskrise.
II. Staatliche Souveränität: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Souveränität im Denken von Carl Schmitt und Hermann Heller. Es analysiert, wie diese beiden Staatsrechtler das Konzept der Souveränität verstanden haben.
III. Nationalstaaten in der Europäischen Union: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Nationalstaaten in der Europäischen Union. Es analysiert, wie die Integration auf Basis der europäischen Vertragsgrundlage funktioniert und welche Herausforderungen sich aus dem Prinzip der Solidarität ergeben.
IV. Ungarn in der Migrationskrise: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Position Ungarns in der Migrationskrise. Es analysiert die ungarische Asylpolitik und die Rolle des ungarischen Souveräns im Kontext der europäischen Solidarität.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Souveränität, Solidarität, Europäische Union, Migrationskrise, Nationalstaat, Carl Schmitt, Hermann Heller, Ungarn, Viktor Orbán.
Häufig gestellte Fragen
Wie stehen Souveränität und Solidarität in der EU im Konflikt?
Der Konflikt wurde besonders in der Migrationskrise deutlich: Nationale Souveränität (eigene Grenzkontrolle) kollidiert oft mit der geforderten europäischen Solidarität (gemeinsame Aufnahme von Flüchtlingen).
Welche Position vertritt Ungarn in der europäischen Migrationspolitik?
Ungarn unter Viktor Orbán betont stark die nationale Souveränität und lehnt das europäische Solidaritätsprinzip bei der Flüchtlingsverteilung weitgehend ab.
Was sagten Carl Schmitt und Hermann Heller zur Souveränität?
Die Arbeit analysiert die Staatsrechtler Schmitt und Heller, um das klassische Verständnis von Souveränität mit den heutigen Anforderungen des modernen Verfassungsstaats zu vergleichen.
Gibt es eine kollektive europäische Identität?
Die Untersuchung hinterfragt, ob die Bürger der EU ein ausreichendes Solidaritätsgefühl besitzen, um eine gemeinsame Identität zu bilden, die über nationale Interessen hinausgeht.
Was ist das „Demokratiedefizit“ der Europäischen Union?
Es beschreibt die Kritik, dass Entscheidungsprozesse in der EU nicht ausreichend durch die Bürger legitimiert sind, was die Akzeptanz von Solidaritätsentscheidungen erschwert.
- Quote paper
- Marian Jacobs (Author), 2016, Nationalstaatliche Souveränität in der Spannung zu europäischer Solidarität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340828