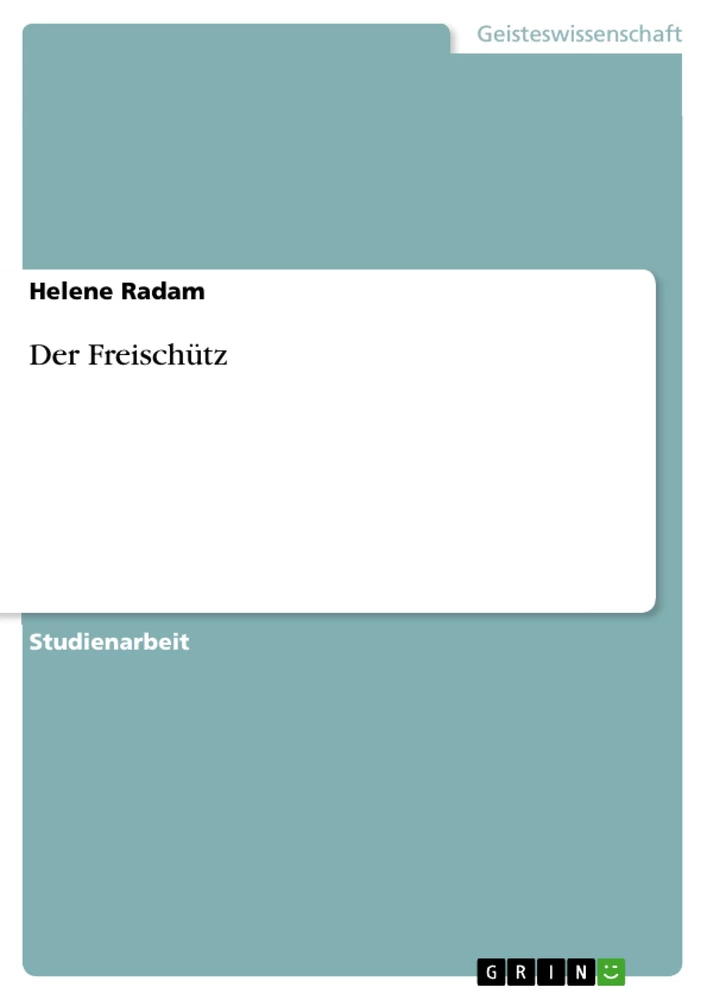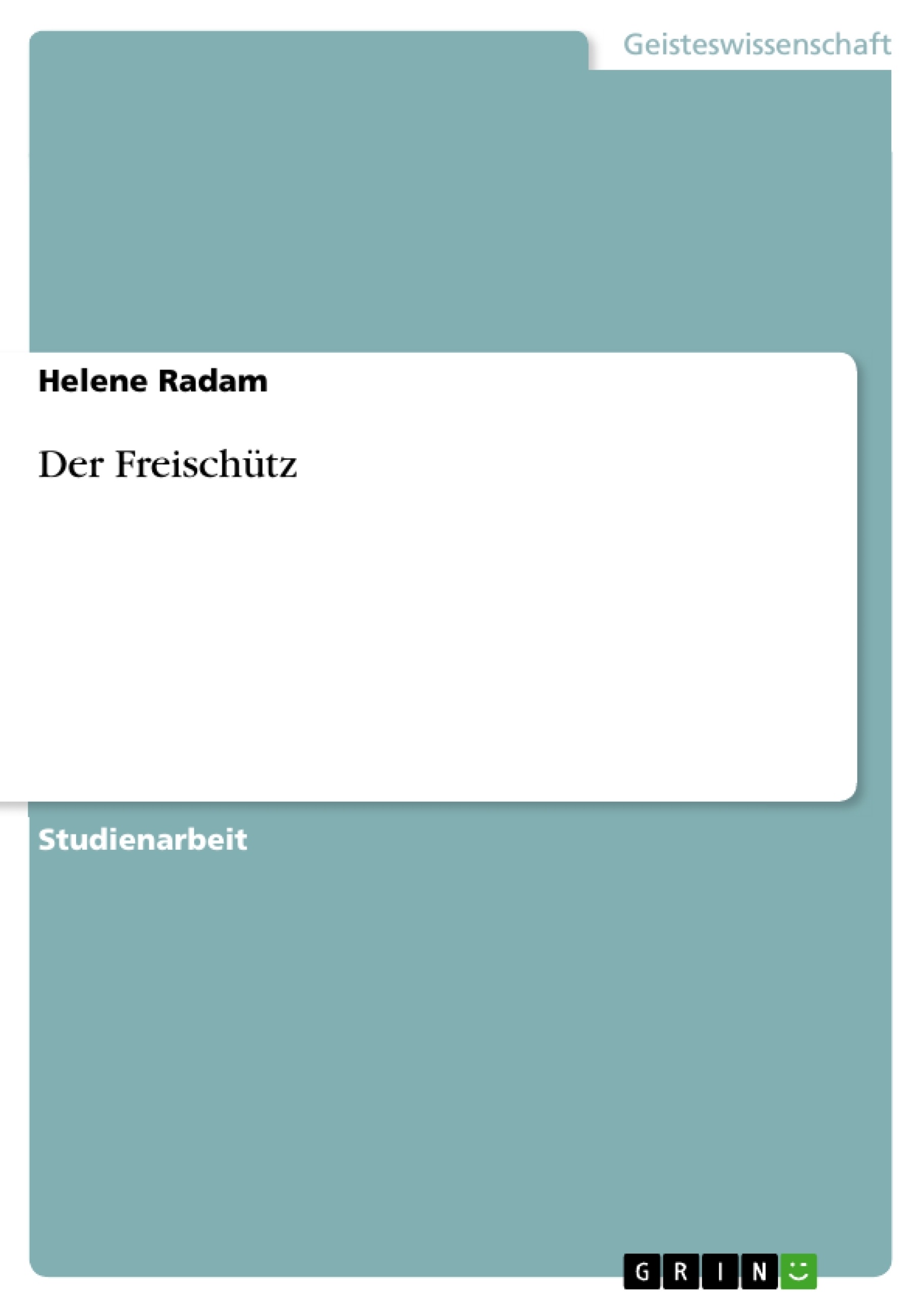Carl Maria von Weber stammt aus einer süddeutschen Familie. Geboren ist er allerdings in Norddeutschland, in Eutin. Er wuchs inmitten einer wandernden Theatergruppe unter der Obhut seines Vaters auf. Der Vater verweilte auf Grund der gegebenen Situation nie sehr lange an einem Ort, so waren die Umstände für Carl Marias Ausbildung von klein auf sehr schwierig. Die Vorteile dabei waren, dass er bei verschiedenen Lehrern Unterricht genoss und somit ein breites Spektrum an Bildung erfuhr.
Er hatte Klavierunterricht bei Heuschkel in Hildburghausen, das Fach der Kontrapunktarbeiten erlernte er bei Michael Haydn in Salzburg, in den Genuss der Musiktheorie kam er bei dem Organisten Kachler in München. Diese Vielfalt der Orte wie auch der Lehrer durchzog seine Laufbahn. Webers erste Opernversuche hatten ihre Premiere in Freiberg. Danach allerdings arbeitet er wieder bei Hayden in Salzburg und später dann bei Abt Vogler in Wien. 1804 ging er als Kapellmeister nach Breslau. 1807 befand er sich in fürstlicher Stellung in Stuttgart. 1813 wurde er dann Operndirektor in Prag. Von 1817 bis zu seinem Tode war er als Musikdirektor in Dresden beschäftigt. Carl Maria von Weber starb in London. 1844 wurde seine sterblichen Überresten durch die Initiative Richard Wagners nach Deutschland geholt und zum zweiten Mal bestattet.
Den Musikdramatiker Weber findet man bereits in seinen frühen Werken wie „Das stumme Waldmädchen“ (1800) oder „Peter Schmoll und seine Nachbarn“ (1801). Die erste Oper ist allerdings nur bruchstückhaft überliefert und bei der zweiten ist das Textbuch verlorengegangen. Allerdings fand diese Oper 1942 ihre Rückkehr auf die Bühne durch eine zeitgenössische Romanvorlage. Ein weiteres Fragment blieb der „Rübezahl“ (1804). Über weitere Opern wie die romantische Oper „Silvana“ (1812), die komische Oper „Abu Hassan“ (1811) oder dem musikalischen Lustspiel „Die drei Pintos“ (ca.1820), die von Weber unvollendet gelassen und später von Gustav Mahler ergänzt wurde, rückt man langsam in die Jahre, in denen Webers große Opern entstanden bzw. ihre Vollendung fanden. Webers Name bleibt vor allem an den Opern der „Freischütz“ (1821), „Euryanthe“ (1823) und „Oberon“ (1826) geknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- Carl Maria von Weber (1786-1826)
- Werkgeschichte
- Handlung des Freischütz
- Ruth Berghaus (1927-1996)
- Die Freischütz-Inszenierung in Zürich
- Die Wolfsschlucht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, einer der wichtigsten Werke der deutschen romantischen Oper. Sie analysiert die Werkgeschichte, die Handlung und die musikalischen Besonderheiten des Stückes. Darüber hinaus wird die Inszenierung des Werkes durch die Regisseurin Ruth Berghaus in Zürich beleuchtet.
- Die Entstehung und Rezeption der Oper "Der Freischütz"
- Die romantische Ästhetik in Webers Werk
- Die Darstellung von Volksglaube und Natur in der Oper
- Der Einfluss von Ruth Berghaus auf die Inszenierung von "Der Freischütz"
- Die Bedeutung der Wolfsschlucht als Symbolraum in der Oper
Zusammenfassung der Kapitel
- Carl Maria von Weber (1786-1826): Dieses Kapitel stellt den Komponisten Carl Maria von Weber vor und beleuchtet seine Lebensgeschichte, seine musikalische Ausbildung und seine wichtigsten Werke.
- Werkgeschichte: Hier wird die Entstehung des "Freischütz" nachvollzogen, wobei der Fokus auf der literarischen Vorlage, der Zusammenarbeit mit dem Librettisten und der Entstehungsprozess der Oper liegt.
- Handlung des Freischütz: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Handlung des "Freischütz", wobei die wichtigsten Personen und Handlungsstränge vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Carl Maria von Weber, Der Freischütz, Romantische Oper, Volksglaube, Natur, Ruth Berghaus, Inszenierung, Wolfsschlucht, Freikugeln, Sternschießen, Jäger, Teufel, Liebesgeschichte, Gesellschaft, Tradition, Musik, Orchesterstil, Dramaturgie, Bühne, Musiktheater.
- Quote paper
- Helene Radam (Author), 2001, Der Freischütz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34093