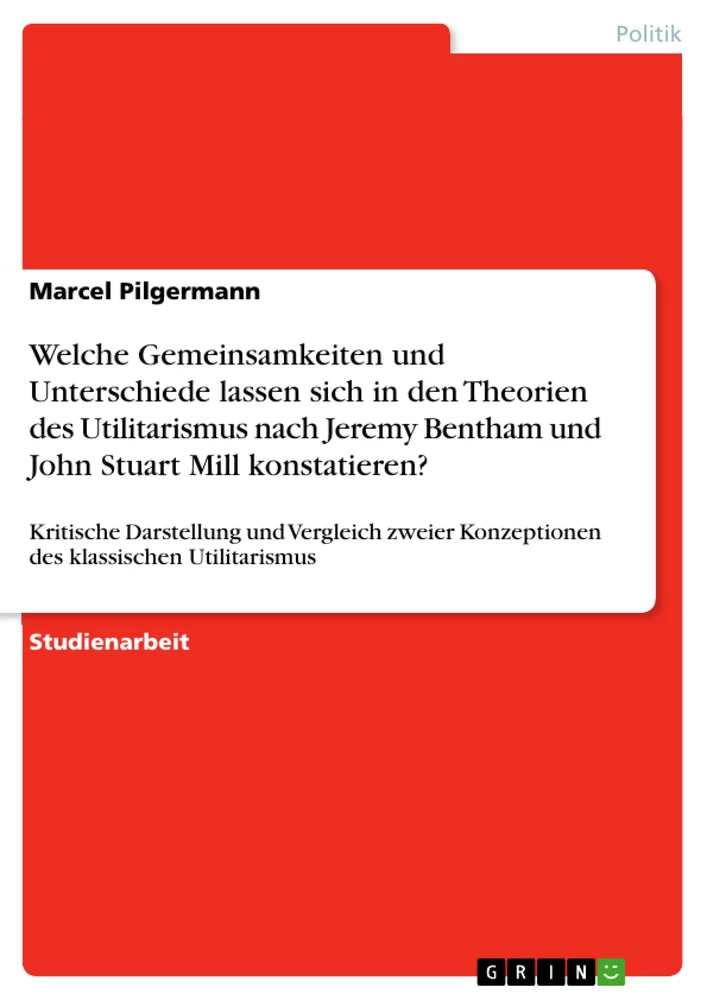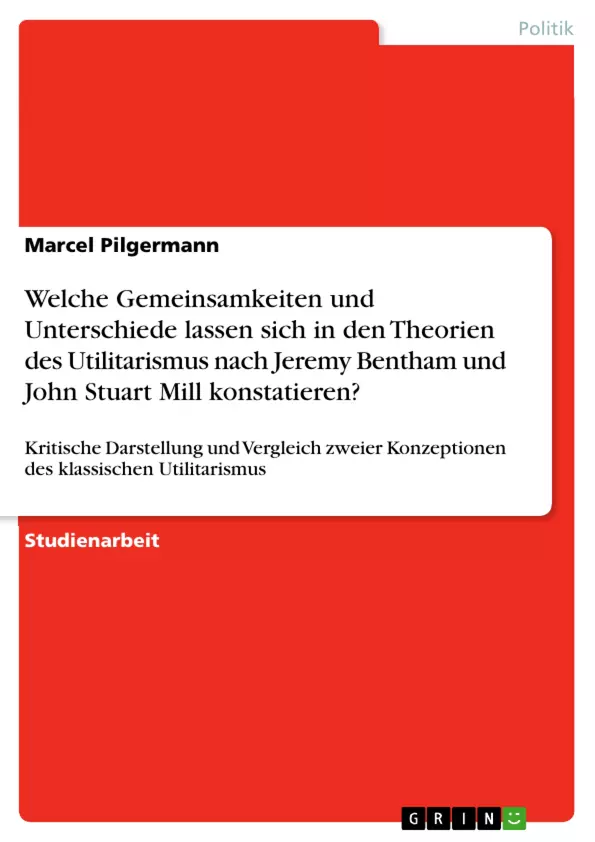Die vorliegende Arbeit präsentiert zunächst eine Darstellung der Theorie des klassischen Utilitarismus nach Jeremy Bentham, was aus einer kritisch hinterfragenden Perspektive erfolgt.
Anschließend wird die von John Stuart Mill erarbeitete Konzeption vergleichend zu der Mills erläutert und ebenso werden hier die Vorzüge und Schwachstellen der Theorie diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Kerngedanken.
In Deutschland wurden die beiden utilitaristischen Ansätze nicht umfassend behandelt und diskutiert, was wegen des hohen Stellenwertes der Lehren Kants nicht verwunderlich ist. Mit seinem kategorischen Imperativ fordert Kant Handlungen als unmittelbar geboten ohne Berücksichtigung von Zweck und Folgen dieser.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Konzeption des Utilitarismus nach Jeremy Bentham
- Biographische Hintergründe
- The principle of utility – Das Prinzip der Nützlichkeit
- Der Beweis des Nützlichkeitsprinzips
- Der quantitative Aspekt von Freude und Leid
- Sanktionen: die Ursprünge von Freude und Leid
- Kritikpunkte der Konzeption
- Die Konzeption des Utilitarismus nach John Stuart Mill im Vergleich zur Konzeption Benthams
- Biographische Hintergründe
- Das Prinzip der Nützlichkeit
- Der Beweis des Nützlichkeitsprinzips
- Der qualitative Aspekt von Freude und Leid
- Die Bedeutung der Sanktionen
- Kritikpunkte der Konzeption
- Zusammenfassung der Kerngedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem klassischen Utilitarismus, einer bedeutenden philosophischen Theorie, die seit dem 19. Jahrhundert zahlreiche Diskussionen in verschiedenen Sprachräumen ausgelöst hat. Sie untersucht die Konzeptionen des Utilitarismus nach Jeremy Bentham und John Stuart Mill, indem sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze herausarbeitet und kritisch hinterfragt.
- Das Prinzip der Nützlichkeit als Grundlage der utilitaristischen Ethik
- Der quantitative und qualitative Aspekt von Freude und Leid
- Die Rolle von Sanktionen in der utilitaristischen Theorie
- Kritische Analyse der Vor- und Nachteile der beiden Konzeptionen
- Zusammenfassung der Kerngedanken und Relevanz des Utilitarismus für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt eine Einführung in die Thematik des Utilitarismus und stellt die beiden zu untersuchenden Konzeptionen von Jeremy Bentham und John Stuart Mill vor.
Das zweite Kapitel widmet sich der Konzeption des Utilitarismus nach Jeremy Bentham, wobei es zunächst auf seine biographischen Hintergründe eingeht. Anschließend wird das Prinzip der Nützlichkeit, der Beweis des Nützlichkeitsprinzips, der quantitative Aspekt von Freude und Leid sowie die Bedeutung von Sanktionen für die Theorie dargestellt. Das Kapitel schließt mit einer kritischen Analyse der Konzeption Benthams.
Im dritten Kapitel wird die Konzeption des Utilitarismus nach John Stuart Mill im Vergleich zu Benthams Theorie erläutert. Auch hier werden zunächst die biographischen Hintergründe Mills behandelt, bevor das Prinzip der Nützlichkeit, der Beweis des Nützlichkeitsprinzips, der qualitative Aspekt von Freude und Leid sowie die Bedeutung von Sanktionen für die Theorie Mills diskutiert werden. Abschließend werden kritische Punkte der Konzeption Mills aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Utilitarismus, insbesondere mit den Konzeptionen von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Nützlichkeitsprinzip, Freude, Leid, Sanktionen, quantitative und qualitative Bewertung von Glück, konsequentialistische Ethik, teleologische Ethik, Hedonismus, moralische Handlungsbewertung, Kritik des Utilitarismus.
- Quote paper
- Marcel Pilgermann (Author), 2014, Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich in den Theorien des Utilitarismus nach Jeremy Bentham und John Stuart Mill konstatieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340964