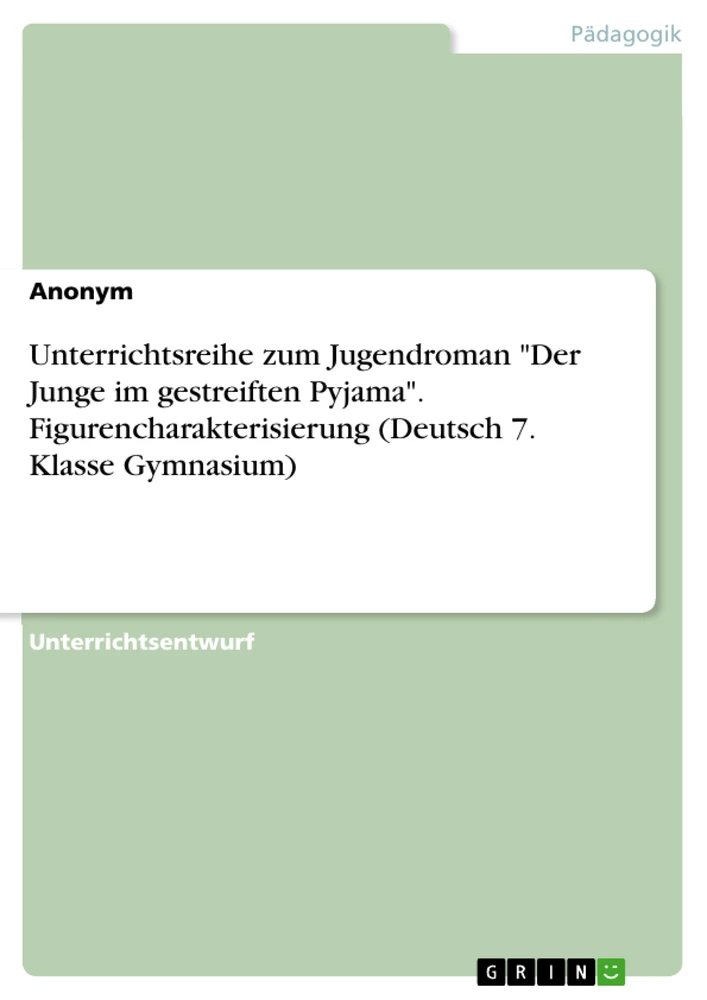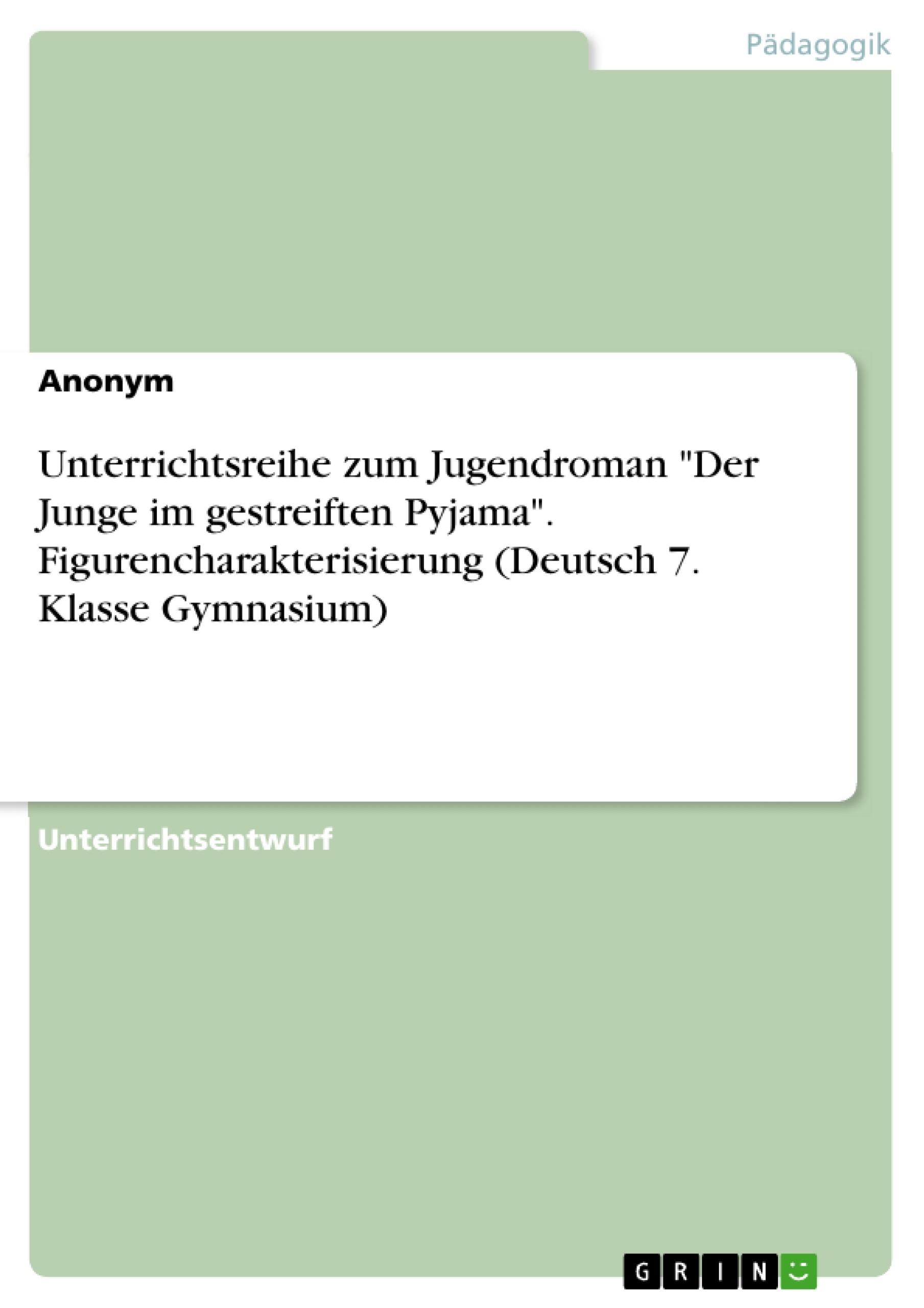In der hier detailliert zu präsentierenden Unterrichtsstunde wird eine Textstelle des zeitgeschichtlichen Jugendromans "Der Junge im gestreiften Pyjama", welcher im Englischen 2006 von dem Iren John Boyne verfasst worden ist, als Vorbereitung für die Klassenarbeit, in welcher die SuS die fiktive Figur der Großmutter charakterisieren sollen, näher betrachtet.
Ziel der Unterrichtsreihe ist es, dass die SuS es vermögen, eine Charakterisierung zu einer Figur zu verfassen, indem sie deren wichtige Eigenschaften antizipieren und in einer Beschreibung münden lassen. Außerdem setzen sie dies in den Kontext des Nationalsozialismus’ und können das Handeln der Figuren auf diesem Hintergrund kritisch reflektieren. Durch die Erarbeitung des Konflikts in der Familie erfassen die SuS in dieser Unterrichtsstunde die besondere Stellung der Großmutter im Roman und verstehen ihr Handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachliche Erkundungen
- Die Schule
- Das Praktikum
- Die Klasse
- Die Unterrichtsreihe zu Der Junge im gestreiften Pyjama
- Darstellung einer absolvierten Unterrichtsstunde
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Entscheidungen
- Planung der Unterrichtsstunde
- Reflexion der Unterrichtsstunde
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Praxisphase im Fach Deutsch während des Praxissemesters im Rahmen des Master of Education-Studiengangs. Sie zeichnet ein Bild der fachlichen Arbeit im Praktikum und der Entwicklung von Handlungskompetenzen in der Unterrichtsplanung, -durchführung und -reflexion. Die Arbeit fokussiert sich auf eine exemplarische Unterrichtsreihe zu "Der Junge im gestreiften Pyjama" und analysiert eine Unterrichtsstunde im Detail.
- Entwicklung von Handlungskompetenzen im Fach Deutsch
- Praktische Anwendung von Unterrichtsplanungs- und -durchführungsmethoden
- Analyse und Reflexion einer Unterrichtsstunde
- Darstellung der Lerngruppe und didaktische Entscheidungen
- Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Rahmenbedingungen des Praxissemesters und die Zielsetzung der Hausarbeit dar.
- Fachliche Erkundungen: Dieser Abschnitt beschreibt das Gymnasium, an dem das Praxissemester absolviert wurde, inklusive der Ausstattung, dem Förderungskonzept und den besonderen Schwerpunkten. Außerdem werden die Erfahrungen im Praktikum und die Beobachtung einer Projektreihe und einer Unterrichtsreihe zum Thema "Informationsdarstellung" und "Woyzeck" beschrieben.
- Die Unterrichtsreihe zu Der Junge im gestreiften Pyjama: Die Autorin stellt die Lerngruppe vor und erläutert die didaktischen Entscheidungen, die zur Planung und Durchführung der Unterrichtsreihe getroffen wurden.
- Darstellung einer absolvierten Unterrichtsstunde: Dieser Abschnitt analysiert eine Unterrichtsstunde der Reihe im Detail, einschließlich der Sachanalyse, der didaktischen Analyse und der Reflexion der Stunde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Praxissemester, Fach Deutsch, Unterrichtsplanung, Unterrichtsdurchführung, Unterrichtsreflexion, Handlungskompetenz, Unterrichtsreihe, "Der Junge im gestreiften Pyjama", Didaktik, Sachanalyse, methodisch-didaktische Entscheidungen, Lerngruppe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Unterrichtsreihe zu "Der Junge im gestreiften Pyjama"?
Ziel ist es, dass Schüler eine Charakterisierung verfassen können und das Handeln der Figuren kritisch vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus reflektieren.
Welche Figur wird in der Beispielstunde charakterisiert?
Der Fokus der detailliert beschriebenen Unterrichtsstunde liegt auf der fiktiven Figur der Großmutter und ihrer besonderen Stellung innerhalb der Familie.
Für welche Schulform und Klasse ist der Entwurf geeignet?
Die Unterrichtsreihe ist für die 7. Klasse eines Gymnasiums im Fach Deutsch konzipiert.
Was beinhaltet die didaktische Analyse der Hausarbeit?
Sie erläutert die Auswahl des Themas, die Lernvoraussetzungen der Klasse sowie die methodischen Entscheidungen für die Durchführung der Stunde.
Wie wird der Bezug zum Nationalsozialismus hergestellt?
Die Schüler untersuchen die familiären Konflikte und die unterschiedlichen moralischen Haltungen der Charaktere gegenüber dem NS-Regime.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Unterrichtsreihe zum Jugendroman "Der Junge im gestreiften Pyjama". Figurencharakterisierung (Deutsch 7. Klasse Gymnasium), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341099