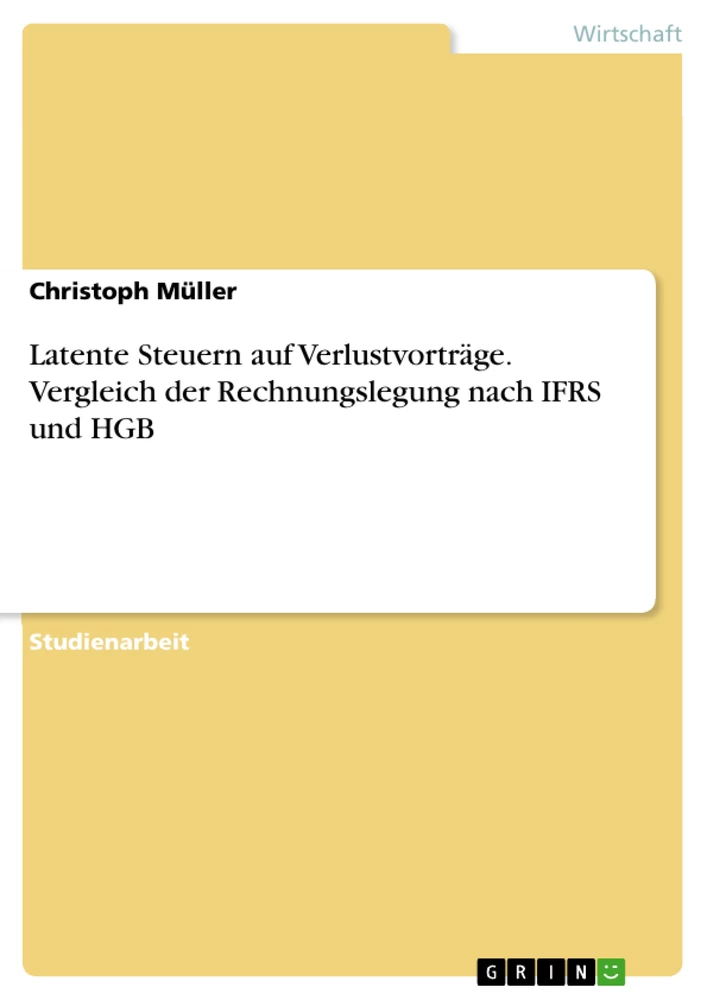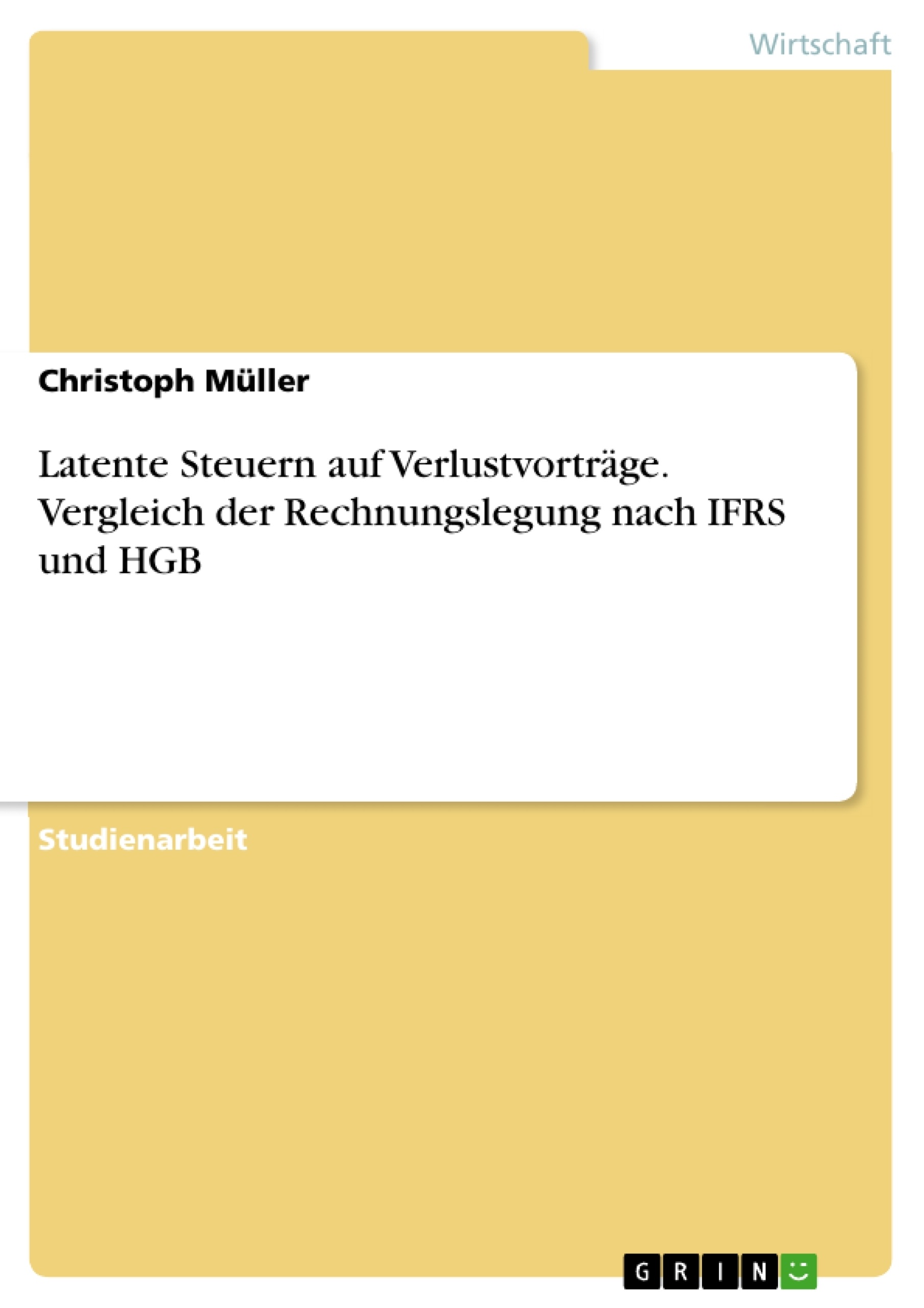Besonders in mittelständischen Unternehmen, die ihre Rechnungslegung auf IFRS umstellen, liegen die erforderlichen Fachkenntnisse nur bei wenigen Mitarbeitern vor. Erschwerend kommt hinzu, dass die DPR den Ansatz und die Bewertung von latenten Steueransprüchen (IAS 12) als einen Prüfungsschwerpunkt für das Jahr 2015 festgelegt hat.
Die DPR-Experten raten zu einer aussagefähigen Darstellung. „Dies gilt insbesondere für die Dokumentation der Werthaltigkeit der aktivierten Steuerlatenzen auf Verlustvorträge und der Dokumentation der überzeugenden Hinweise bei Vorliegen einer Verlusthistorie.“ Wird im Rahmen der Prüfung ein Fehler festgestellt und ein möglicher Verdacht einer Straftat bestätigt sich, so kann gemäß § 331 HGB eine unrichtige Darstellung der Verhältnisse mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften sind jedoch nicht nur für die Erstellung, sondern auch für die Analyse des Abschlusses von Bedeutung. So sind beispielsweise Verlustvorträge, auf die keine latenten Ansprüche gebildet wurden ein Indiz dafür, dass das bilanzierende Unternehmen selbst nicht damit rechnet, dass in Zukunft ausreichend Gewinne erwirtschaftet werden.
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit zunächst die Bilanzierungsvorschriften für latente Steuern auf Verlustvorträge gemäß HGB und IFRS darzustellen. Im zweiten Schritt sollen die Unterschiede konkret benannt werden
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Methodisches Vorgehen
- Einführende Informationen zu latenten Steuern und Verlustvorträgen
- Latente Steuern
- Verlustvortrag
- Ansatz und Ausweis von latenten Steuern auf Verlustvorträge
- Regelungen nach IFRS
- Regelungen nach HGB
- Unterschiede zwischen den Regelungswerken
- Bewertung von latenten Steuern auf Verlustvorträge
- Regelungen nach IFRS
- Regelungen nach HGB
- Unterschiede zwischen den Regelungswerken
- Anhangsangaben latenter Steuern auf Verlustvorträge
- Regelungen nach IFRS
- Regelungen nach HGB
- Unterschiede zwischen den Regelungswerken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit hat zum Ziel, die Bilanzierungsvorschriften für latente Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB darzustellen und die Unterschiede zwischen beiden Regelwerken herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der komplexen Zusammenhänge und der praktischen Relevanz für Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, die auf IFRS umstellen.
- Darstellung der Bilanzierungsvorschriften für latente Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB.
- Konkrete Benennung der Unterschiede zwischen den Regelungswerken nach IFRS und HGB.
- Analyse der praktischen Relevanz für Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Prüfungsschwerpunkte der DPR.
- Bewertung der Auswirkungen auf die Darstellung der Ertrags- und Vermögenslage.
- Zusammenstellung der relevanten Anhangsangaben.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit befasst sich mit der komplexen Bilanzierung latenter Steueransprüche auf Verlustvorträge, insbesondere im Kontext des Übergangs von mittelständischen Unternehmen zu IFRS. Die Arbeit betont die Bedeutung korrekter Bilanzierung aufgrund der Prüfungsschwerpunkte der DPR und der potenziellen strafrechtlichen Konsequenzen bei Fehlern. Das methodische Vorgehen beinhaltet die Darstellung einführender Informationen zu Verlustvorträgen und latenten Steuern, gefolgt von einer Gegenüberstellung der Vorschriften nach IFRS und HGB, beginnend mit Ansatz und Ausweis, dann Bewertung und abschließend Anhangsangaben.
Einführende Informationen zu latenten Steuern und Verlustvorträgen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die anschließende Gegenüberstellung der IFRS- und HGB-Regelungen. Es definiert latente Steuern und Verlustvorträge und erläutert ihre Bedeutung im Kontext der Unternehmensbilanzierung. Die Definitionen und Erläuterungen bilden die Basis für das Verständnis der komplexen Bilanzierungsvorschriften, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
Ansatz und Ausweis von latenten Steuern auf Verlustvorträge: Dieses Kapitel vergleicht den Ansatz und Ausweis latenter Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB. Es analysiert die jeweiligen Regelungen und hebt die Unterschiede zwischen den beiden Rechnungslegungsstandards hervor. Die Analyse zeigt, wie die unterschiedlichen Vorschriften zu abweichenden Darstellungen in der Bilanz führen können und welche Konsequenzen dies für die Interpretation der Unternehmensdaten hat.
Bewertung von latenten Steuern auf Verlustvorträge: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bewertung latenter Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB. Es analysiert die verschiedenen Bewertungsmethoden und zeigt die Unterschiede in der Anwendung auf. Die Unterschiede in der Bewertungsmethode können zu signifikanten Abweichungen in der Bilanzierung führen und die Interpretation der finanziellen Situation des Unternehmens beeinflussen.
Anhangsangaben latenter Steuern auf Verlustvorträge: Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Anhangsangaben zu latenten Steuern auf Verlustvorträge gemäß IFRS und HGB. Es analysiert die jeweiligen Anforderungen und zeigt die Unterschiede in der Offenlegungspflicht. Die detaillierte Darstellung der Anhangsangaben verdeutlicht, wie die Informationen über latente Steuern transparent und nachvollziehbar für die Stakeholder dargestellt werden müssen.
Schlüsselwörter
Latente Steuern, Verlustvorträge, IFRS, HGB, Bilanzierung, Bewertung, Anhangsangaben, Rechnungslegung, DPR, Prüfungsschwerpunkte, Mittelständische Unternehmen, BilMOG.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Latente Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung latenter Steuern auf Verlustvorträge nach den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) Vorschriften. Sie vergleicht die beiden Regelwerke, analysiert deren Unterschiede und beleuchtet die praktische Relevanz für Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen im Kontext des IFRS-Übergangs.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Einführung in die Problematik, methodisches Vorgehen, einführende Informationen zu latenten Steuern und Verlustvorträgen, Ansatz und Ausweis latenter Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB, Bewertung dieser latenten Steuern nach IFRS und HGB, sowie die notwendigen Anhangsangaben nach beiden Regelwerken. Ein besonderer Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen IFRS und HGB und deren Auswirkungen auf die Unternehmensbilanz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die Bilanzierungsvorschriften für latente Steuern auf Verlustvorträge nach IFRS und HGB darzustellen und die Unterschiede zwischen beiden Regelwerken herauszuarbeiten. Sie analysiert die praktische Relevanz für Unternehmen, insbesondere die Auswirkungen auf die Ertrags- und Vermögenslage und die Prüfungsschwerpunkte der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR).
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung mit Problemstellung und methodischem Vorgehen, gefolgt von einführenden Informationen zu latenten Steuern und Verlustvorträgen. Die Kernkapitel vergleichen den Ansatz und Ausweis, die Bewertung sowie die Anhangsangaben nach IFRS und HGB. Jedes Kapitel analysiert die jeweiligen Regelungen und hebt die Unterschiede hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Latente Steuern, Verlustvorträge, IFRS, HGB, Bilanzierung, Bewertung, Anhangsangaben, Rechnungslegung, DPR, Prüfungsschwerpunkte, Mittelständische Unternehmen, BilMoG.
Für welche Unternehmensgruppe ist die Seminararbeit besonders relevant?
Die Seminararbeit ist besonders relevant für mittelständische Unternehmen, die auf IFRS umstellen oder bereits nach IFRS bilanzieren. Sie bietet wichtige Informationen zur korrekten Bilanzierung latenter Steuern auf Verlustvorträge und den damit verbundenen Prüfungsschwerpunkten.
Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich aus den Unterschieden zwischen IFRS und HGB?
Die Unterschiede in den Bilanzierungsvorschriften zwischen IFRS und HGB können zu signifikanten Abweichungen in der Darstellung der Ertrags- und Vermögenslage führen. Dies beeinflusst die Interpretation der Unternehmensdaten und hat Konsequenzen für die Unternehmensbewertung und die Entscheidungsfindung von Stakeholdern.
Welche Bedeutung haben die Anhangsangaben in diesem Kontext?
Die Anhangsangaben spielen eine entscheidende Rolle für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bilanzierung latenter Steuern auf Verlustvorträge. Die Arbeit analysiert die Anforderungen an die Anhangsangaben nach IFRS und HGB und zeigt die Unterschiede in der Offenlegungspflicht auf.
- Arbeit zitieren
- Christoph Müller (Autor:in), 2015, Latente Steuern auf Verlustvorträge. Vergleich der Rechnungslegung nach IFRS und HGB, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341410