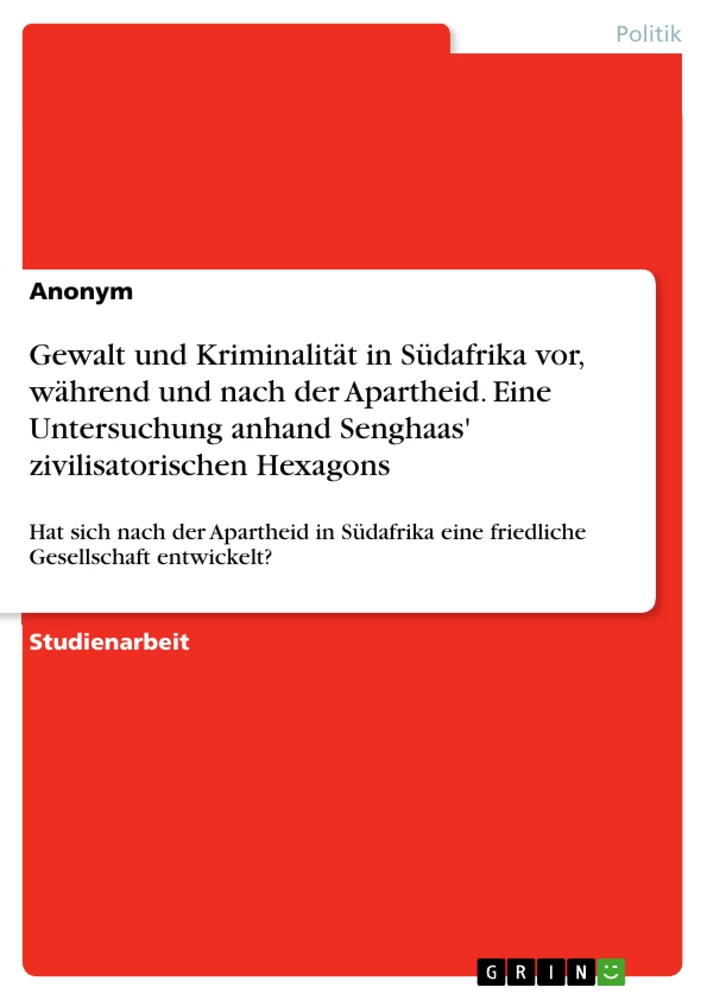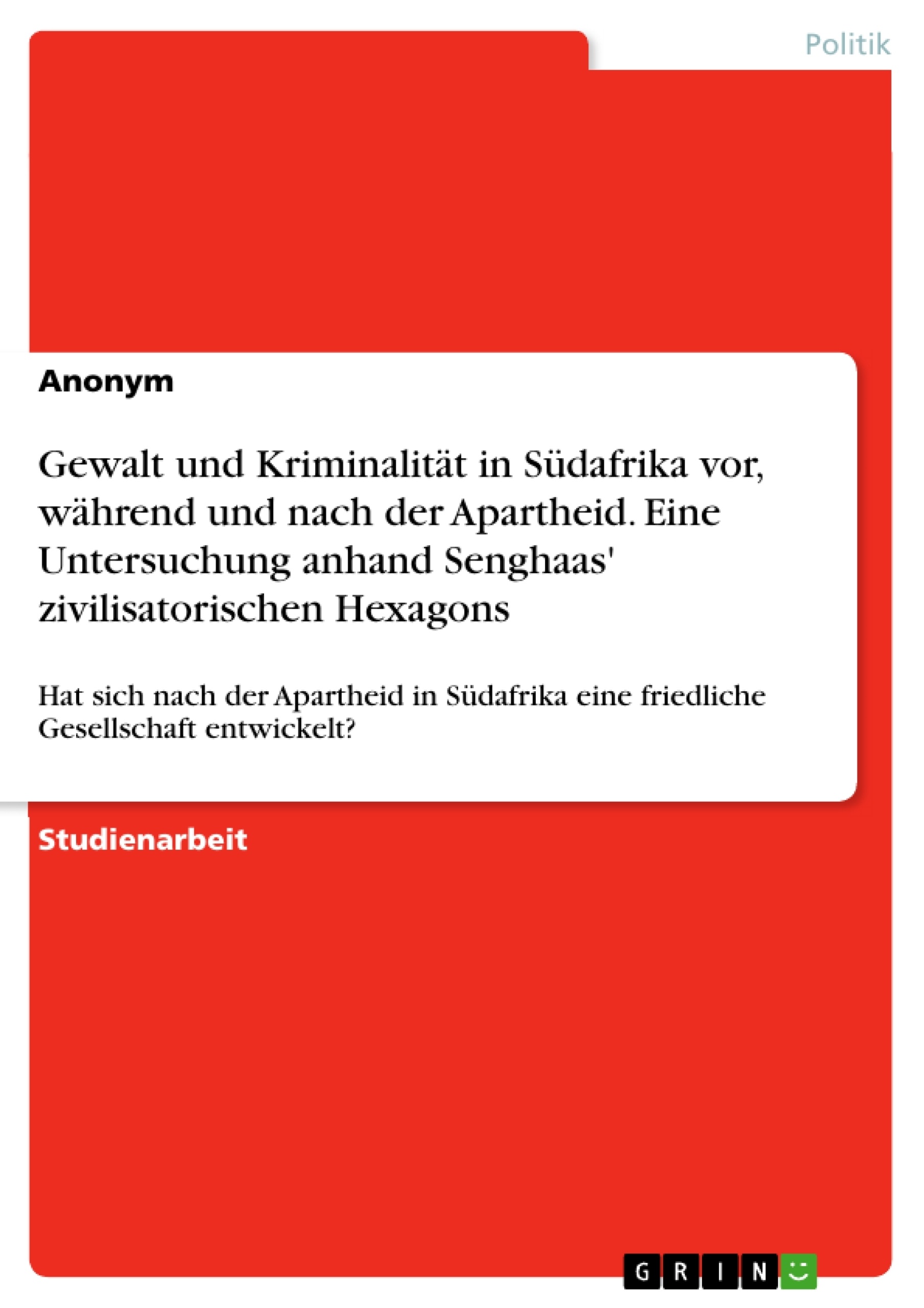Immer wieder hört man von gewalttätigen Übergriffen gegen Schwarze in Südafrika, obwohl die Apartheid seit 1994 abgeschafft ist. Es stellt sich die Frage, wie sich Südafrika mehr als zwanzig Jahre nach Ende der Apartheid gesellschaftlich und politisch entwickelt hat.
Die Hausarbeit befasst sich also mit der Frage, ob sich nach der Apartheid in Südafrika im Bezug auf den Umgang mit Gewalt eine friedliche Gesellschaft entwickeln konnte. Analysiert wird diese Frage anhand der Gewalt und Kriminalität in Südafrika während und nach der Apartheid.
Im Jahr 2013 veröffentlichte der Spiegel einen Artikel zur Polizeigewalt in Südafrika. Hierbei ging es um einen schwarzen Taxifahrer in Johannesburg, welcher ohne nennenswerten Grund von Polizisten aus seinem Taxi gezerrt wurde und anschließend am Polizeiauto festgebunden zum Polizeirevier geschleift wurde. Dieser Vorfall brutaler unbegründeter Gewalt, erinnert an die Zeit der Apartheid.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das zivilisatorische Hexagon
- 3. Der Gewaltbegriff nach Galtung
- 4. Der Fall Südafrika
- 4.1 Kulturelle Gewalt
- 4.2 Strukturelle Gewalt
- 4.3 Direkte Gewalt
- 4.4 Resumé
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung Südafrikas nach dem Ende der Apartheid im Hinblick auf den Umgang mit Gewalt. Ziel ist es, zu analysieren, ob sich eine friedliche Gesellschaft etablieren konnte. Die Analyse erfolgt anhand des zivilisatorischen Hexagons von Senghaas und der Gewaltdefinition nach Galtung.
- Entwicklung Südafrikas nach der Apartheid
- Anwendung des zivilisatorischen Hexagons von Senghaas
- Analyse verschiedener Gewaltformen (kulturelle, strukturelle, direkte Gewalt)
- Frieden als Zivilisierungsprozess
- Zusammenhang zwischen Gewaltverzicht und friedlichem Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung einer friedlichen Gesellschaft in Südafrika nach der Apartheid. Ausgehend von einem Beispiel polizeilicher Gewalt wird die Problematik der anhaltenden Gewalt gegen Schwarze trotz des Endes der Apartheid aufgezeigt. Die Arbeit untersucht diese Frage anhand des zivilisatorischen Hexagons von Senghaas und der Gewaltdefinition nach Galtung, um die verschiedenen Gewaltformen in Südafrika vor, während und nach der Apartheid zu analysieren.
2. Das zivilisatorische Hexagon: Dieses Kapitel erläutert das Modell des zivilisatorischen Hexagons von Dieter Senghaas. Es beschreibt sechs sich gegenseitig bedingende Faktoren für Frieden: legitimiertes Gewaltmonopol, Rechtstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Partizipation, Interdependenzen und Affektkontrollen, sowie eine konstruktive Konfliktkultur. Senghaas betrachtet Frieden als einen Zivilisierungsprozess, der durch die Entprivatisierung von Gewalt und die Herausbildung staatlicher Strukturen erreicht wird. Das Kapitel betont die Bedeutung von Gewaltverzicht und gegenseitiger Anerkennung für das Funktionieren des Hexagons und ein friedliches Zusammenleben. Die einzelnen Elemente des Hexagons werden detailliert erklärt und ihre wechselseitigen Beziehungen herausgearbeitet. Die Bedeutung der "Tiefenbindung" für gesellschaftliche Harmonie wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Apartheid, Südafrika, Gewalt, Kriminalität, Frieden, Zivilisierungsprozess, zivilisatorisches Hexagon (Senghaas), Gewaltbegriff (Galtung), kulturelle Gewalt, strukturelle Gewalt, direkte Gewalt, Rechtstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Partizipation, Interdependenzen, Konfliktkultur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Analyse der Gewalt in Südafrika nach dem Ende der Apartheid"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung Südafrikas nach dem Ende der Apartheid im Hinblick auf den Umgang mit Gewalt. Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob sich eine friedliche Gesellschaft etablieren konnte.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Analyse basiert auf dem zivilisatorischen Hexagon von Dieter Senghaas und der Gewaltdefinition nach Johan Galtung. Das zivilisatorische Hexagon beschreibt sechs Faktoren für Frieden (legitimiertes Gewaltmonopol, Rechtstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Partizipation, Interdependenzen und Affektkontrollen, sowie eine konstruktive Konfliktkultur), während Galtungs Gewaltbegriff verschiedene Formen von Gewalt (kulturelle, strukturelle, direkte Gewalt) unterscheidet.
Welche Gewaltformen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht kulturelle, strukturelle und direkte Gewalt in Südafrika, sowohl vor, während als auch nach der Apartheid. Sie analysiert, wie diese Gewaltformen miteinander zusammenhängen und die Entwicklung einer friedlichen Gesellschaft beeinflussen.
Wie wird die Entwicklung Südafrikas analysiert?
Die Analyse erfolgt durch die Anwendung des zivilisatorischen Hexagons auf die südafrikanische Situation. Es wird untersucht, inwieweit die sechs Faktoren des Hexagons in Südafrika vorhanden sind und wie sie zur Etablierung (oder Nicht-Etablierung) von Frieden beigetragen haben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Das zivilisatorische Hexagon, Der Gewaltbegriff nach Galtung, Der Fall Südafrika (mit Unterkapiteln zu kultureller, struktureller und direkter Gewalt sowie einem Resümee) und Fazit.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im fünften Kapitel präsentiert und fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen. Es bewertet, inwieweit sich eine friedliche Gesellschaft in Südafrika nach dem Ende der Apartheid etablieren konnte, unter Berücksichtigung der analysierten Gewaltformen und des zivilisatorischen Hexagons.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Apartheid, Südafrika, Gewalt, Kriminalität, Frieden, Zivilisierungsprozess, zivilisatorisches Hexagon (Senghaas), Gewaltbegriff (Galtung), kulturelle Gewalt, strukturelle Gewalt, direkte Gewalt, Rechtstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Partizipation, Interdependenzen, Konfliktkultur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel zu analysieren, ob sich nach dem Ende der Apartheid eine friedliche Gesellschaft in Südafrika etablieren konnte. Dies wird anhand der Anwendung des zivilisatorischen Hexagons und der Gewaltdefinition nach Galtung untersucht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Gewalt und Kriminalität in Südafrika vor, während und nach der Apartheid. Eine Untersuchung anhand Senghaas' zivilisatorischen Hexagons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341814