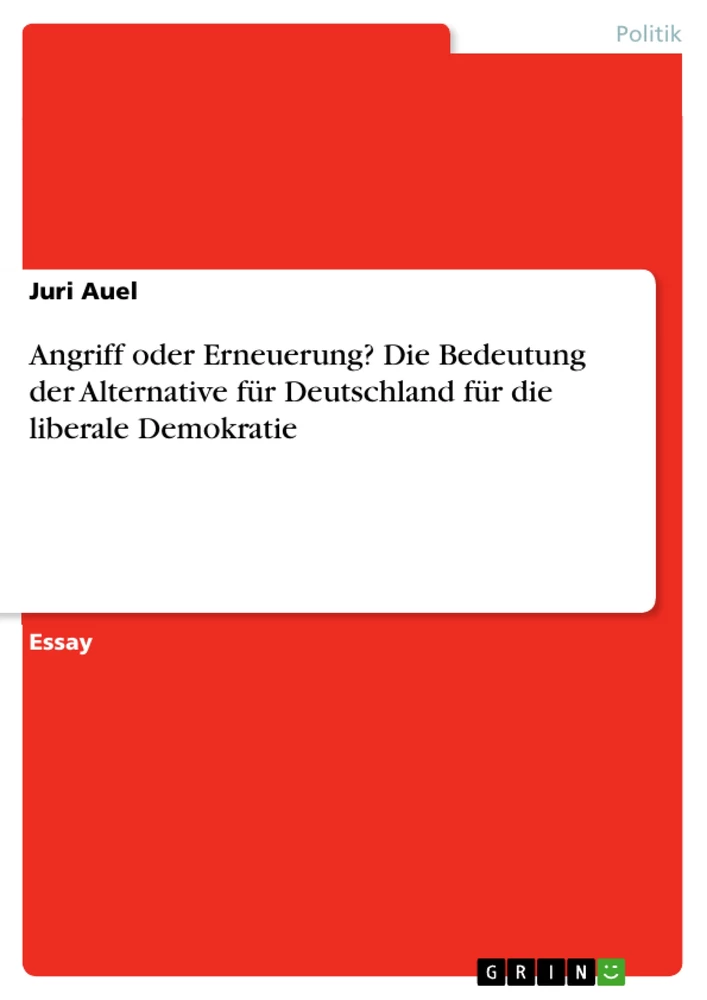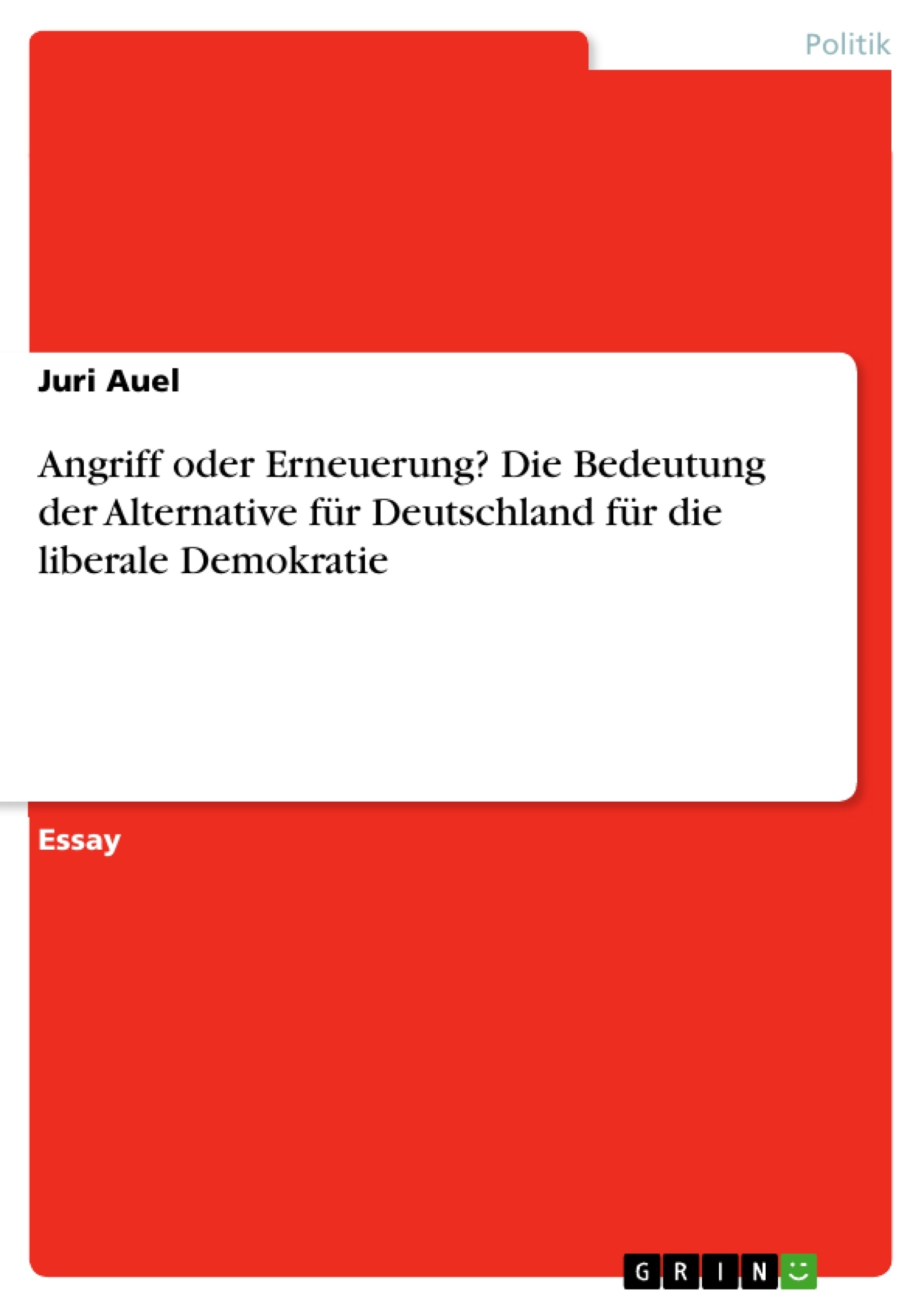„Die Partei schwankt zwischen FDP und NPD.“ Mit diesem Satz über die Alternative für Deutschland zitierte das Handelsblatt am Beginn des Jahres Bernd Riexinger. Das zugegeben etwas provokante Zitat des Fraktionschefs der Linken im Bundestag umreißt ziemlich gut zwei Fragen, welche die Gesellschaft in Bezug auf die AfD seit ihrer Gründung beschäftigen. Erstens: Was genau will die Alternative für Deutschland? Und zweitens: Ist sie eine Gefahr oder doch eine erneuernde Bereicherung für die Demokratie im Allgemeinen und unsere liberale Demokratie im Speziellen?
Fakt ist: Von der Alternativen als schnöde Ein-Themen-Partei zu reden, die lediglich der D-Mark nachtrauert, greift mittlerweile zu kurz. Nach ihrer Gründung mutierte die Partei zu einem Sammelbecken unterschiedlichster Strömungen. Bei Wahlen klaut sie von allen Parteien Stammwähler, am meisten betroffen waren in Thüringen und Brandenburg – recht paradox – CDU und die Linke, also die Außenränder der Parteien. Die Varianz ihrer politischen Forderungen ist in der Tat beachtlich. Dabei ist die Partei anscheinend noch in der Findungsphase, das zeigt nicht zuletzt der Richtungsstreit am Bremer Parteitag. Ein Bundesprogramm gibt es noch nicht, lediglich einen Leitfaden. Parteimitglieder, Journalisten und Politologen suchen noch nach dem richtigen Etikett für die Partei.
Weil sich die beiden oben erwähnten Fragen einander bedingen, sollen sie in diesem Essay auch zusammen behandelt werden. Die Frage nach den Forderungen der Alternative soll mit einem exemplarischen Blick in den Bundesleitfaden sowie die Wahlprogramme aus Sachsen und Hamburg erfolgen. Wo ist die AfD liberal, konservativ oder gar rechtspopulistisch? Wo ein Gewinn oder eine Bedrohung für die liberale Demokratie? Dazu kommen Aussagen bekannter AfD-ler. Doch ganz am Anfang steht natürlich die Frage: Was ist eigentlich eine liberale Demokratie?
Inhaltsverzeichnis
- Was die liberale Demokratie ausmacht
- Die AfD und die anderen
- Familien- und Gesellschaftspolitik
- Bildungspolitik
- Wirtschaftspolitik
- Demokratiepolitik
- Innere Sicherheit
- Asylrecht, Integration und Zuwanderung
- Vom Bewahren der alten Freiheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Alternative für Deutschland (AfD) und ihre Bedeutung für die liberale Demokratie. Die Arbeit analysiert die politischen Forderungen der Partei und hinterfragt, ob sie eine Gefahr oder eine Bereicherung für die Demokratie darstellt.
- Definition und Merkmale der liberalen Demokratie
- Politische Forderungen und Positionen der AfD
- Analyse der AfD im Kontext von Rechtspopulismus und Bürgernähe
- Kritik an der AfD im Hinblick auf ihre potenziellen Auswirkungen auf die Demokratie
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Was die liberale Demokratie ausmacht
Dieser Abschnitt definiert die liberale Demokratie und ihre zentralen Prinzipien. Der Autor erläutert die Bedeutung von Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit und stellt die Fragilität der Einheit von liberalem Rechtsstaat und Demokratie heraus.
Die AfD und die anderen
Dieser Abschnitt analysiert die Positionierung der AfD im politischen Spektrum. Der Autor beleuchtet die Kritik der AfD an der deutschen Politik der vergangenen Jahre und ihre Selbstwahrnehmung als Alternative zu den etablierten Parteien. Die Rhetorik und die Positionierung der AfD im Kontext von Rechtspopulismus und Bürgernähe werden diskutiert.
Familien- und Gesellschaftspolitik
Dieser Abschnitt beleuchtet die Positionen der AfD in der Familien- und Gesellschaftspolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der traditionellen Familienpolitik und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von Familienwerten. Die Haltung der AfD zu Themen wie Homosexualität und Abtreibung wird ebenfalls beleuchtet.
Bildungspolitik
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Positionen der AfD in der Bildungspolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der aktuellen Bildungslandschaft und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von Bildungsgerechtigkeit und traditionellem Bildungswesen. Die Haltung der AfD zu Themen wie Inklusion und Ganztagsschule wird ebenfalls beleuchtet.
Wirtschaftspolitik
Dieser Abschnitt untersucht die Positionen der AfD in der Wirtschaftspolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der Eurorettungspolitik und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von Wirtschaftswachstum und nationaler Souveränität. Die Haltung der AfD zu Themen wie Freihandel und Steuerpolitik wird ebenfalls beleuchtet.
Demokratiepolitik
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Positionen der AfD in der Demokratiepolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der deutschen Demokratie und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von direkter Demokratie und Volksentscheiden. Die Haltung der AfD zu Themen wie Medienfreiheit und Meinungsfreiheit wird ebenfalls beleuchtet.
Innere Sicherheit
Dieser Abschnitt untersucht die Positionen der AfD in der Innenpolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der Sicherheitspolitik der Bundesregierung und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von Sicherheit und Ordnung. Die Haltung der AfD zu Themen wie Kriminalität, Polizei und Strafrecht wird ebenfalls beleuchtet.
Asylrecht, Integration und Zuwanderung
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Positionen der AfD in der Migrationspolitik. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der aktuellen Asylpolitik und ihre Forderungen nach einer strengeren Grenzkontrolle und einer restriktiveren Einwanderungspolitik. Die Haltung der AfD zu Themen wie Integration und kulturelle Vielfalt wird ebenfalls beleuchtet.
Vom Bewahren der alten Freiheiten
Dieser Abschnitt untersucht die Positionen der AfD im Hinblick auf die Bewahrung von traditionellen Werten und Freiheiten. Der Autor analysiert die Kritik der AfD an der politischen Korrektheit und ihre Forderungen nach einer stärkeren Betonung von Freiheit und Selbstbestimmung. Die Haltung der AfD zu Themen wie Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte des Essays sind: liberale Demokratie, Rechtspopulismus, Alternative für Deutschland (AfD), politische Forderungen, Bürgernähe, Demokratie, Meinungsfreiheit, Integration, Asylpolitik, Familienpolitik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Innere Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Was macht eine liberale Demokratie aus?
Eine liberale Demokratie zeichnet sich durch das Zusammenspiel von Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz von Minderheiten aus.
Welche Position vertritt die AfD in der Wirtschaftspolitik?
Die AfD kritisiert die Eurorettungspolitik scharf und fordert eine Rückbesinnung auf nationale Souveränität sowie eine stärkere Betonung des Wirtschaftswachstums.
Wie steht die AfD zum Thema direkte Demokratie?
Die Partei fordert eine stärkere Einbindung der Bürger durch Volksentscheide und direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild.
Was sind die Kernpunkte der AfD-Migrationspolitik?
Die AfD fordert strengere Grenzkontrollen, eine restriktive Einwanderungspolitik und kritisiert das aktuelle Asylrecht sowie bestehende Integrationskonzepte.
Ist die AfD laut dem Essay eine Gefahr für die Demokratie?
Der Essay untersucht diese Frage kontrovers und analysiert, ob die Partei als rechtspopulistische Bedrohung oder als erneuernde Kraft durch Bürgernähe zu werten ist.
Welche Haltung hat die AfD zur Familienpolitik?
Die Partei betont traditionelle Familienwerte und kritisiert moderne Entwicklungen in der Gesellschafts- und Geschlechterpolitik.
- Quote paper
- Juri Auel (Author), 2015, Angriff oder Erneuerung? Die Bedeutung der Alternative für Deutschland für die liberale Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342194