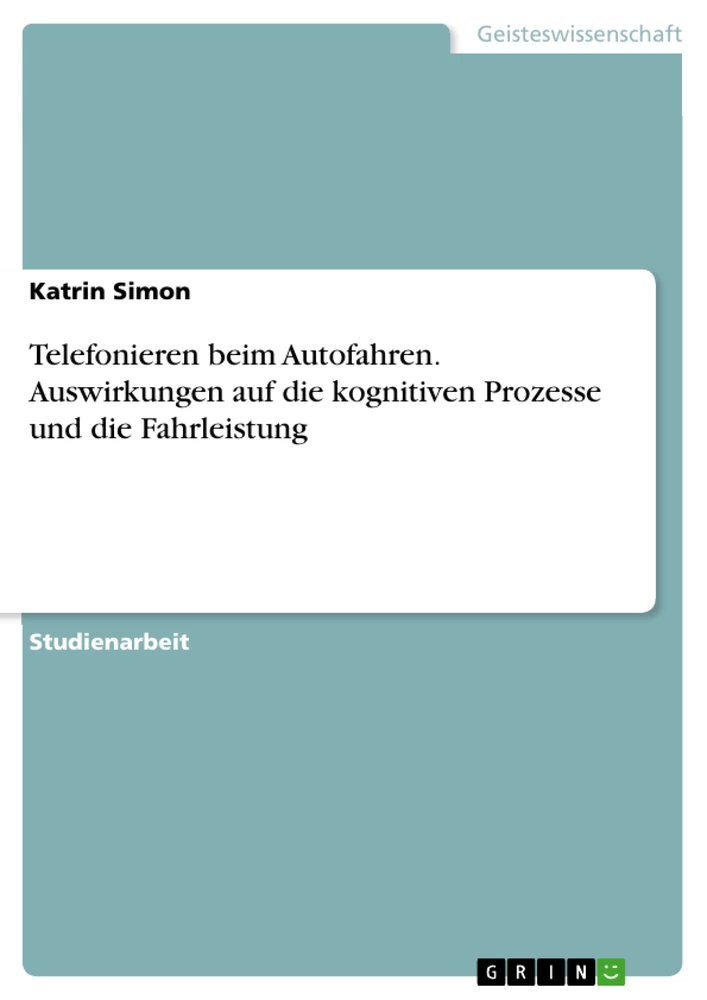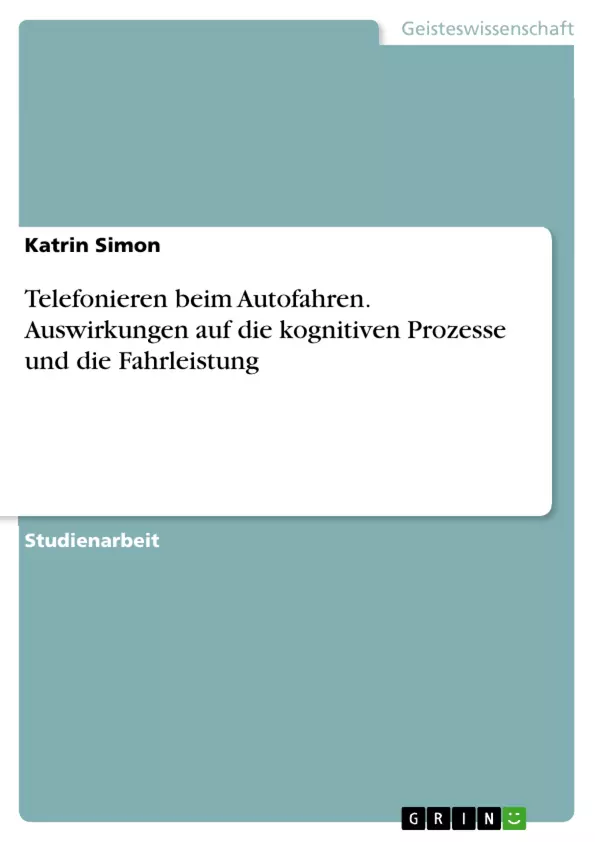Welche Auswirkungen das Multitasking und insbesondere das Telefonieren während des Autofahrens auf die kognitive Prozesse und die Fahrleistung hat, wird in der vorliegenden Arbeit anhand verschiedener Studien diskutiert.
Möglichst viele Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten ist im menschlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Dies zeigt sich beispielsweise im modernen Büroalltag. Das parallele Ausführen von Tätigkeiten ist durch hohen Zeit- und Termindruck, aber auch durch viele Arbeitsunterbrechungen für die Beschäftigten meistens unabdingbar geworden. Das sogenannte „Multitasking“ stammt ursprünglich aus der Informatik und beschreibt die Eigenschaft eines Rechnerbetriebssystems zum Mehrprozessbetrieb. Auf den Menschen übertragen wird unter Multitasking das gleichzeitige Bearbeiten mehrerer paralleler Aufgaben verstanden. Detaillierter ausgedrückt ist damit die Fähigkeit gemeint, „mehrere Aufgaben oder Unteraufgaben-Komponenten einer größeren, komplexeren Aufgabe zu vereinen, zu integrieren und auszuführen“ (Salvucci, 2005).
Das Autofahren an sich ist eher eine routinierte Angelegenheit und solange beim Autofahren keine unerwarteten Situationen auftreten, kann es schnell passieren, dass beim Fahrer Langeweile aufkommt und er sich neue Herausforderungen sucht. Die Ablenkung beim Autofahren ist dabei relativ vielfältig und beeinflusst die Fahrleistung unterschiedlich stark. Demnach beeinflusst beispielsweise Essen oder Radiohören die Fahrleistung eher gering. Greift man jedoch während des Fahrens zum Telefon, kann dies zu erheblichen Defiziten in der Fahrleistung führen und das Unfallrisiko um das vierfache erhöhen. Dabei ist es völlig irrelevant, ob man das Telefon in der Hand hält oder eine Freisprechanlage verwendet. Verschlechterungen zeigen sich dabei für die Reaktionszeiten, aber auch bei der Wahrscheinlichkeit verpasster Signale. Besonders starke Beeinträchtigungen für die Reaktionszeiten entstehen bei kognitiv sehr anspruchsvollen Aufgaben. Es zeigt sich somit eine Beeinträchtigung in der Fahrleistung, welche auf das Telefonieren zurückgeführt werden kann. Es scheint demnach so, dass der Mensch nicht fähig ist mehrere Aufgaben simultan zu bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Studien im Simulator
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen des Telefonierens während des Autofahrens auf die Fahrleistung. Sie analysiert die kognitiven Prozesse, die bei der gleichzeitigen Ausführung beider Aufgaben beteiligt sind, und beleuchtet die Risiken, die mit dieser Form des Multitaskings verbunden sind.
- Die Auswirkungen des Telefonierens auf die Reaktionszeiten und die Wahrscheinlichkeit, Signale zu verpassen
- Die Rolle kognitiver Prozesse bei der Entstehung von Doppelaufgabeninterferenzen
- Die Unterschiede zwischen der Nutzung von Handys und Freisprechanlagen
- Der Zusammenhang zwischen Telefonieren und dem Unfallrisiko
- Die Relevanz dieser Erkenntnisse für die Verkehrssicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Multitasking ein und erläutert die Bedeutung des Themas im Kontext des modernen Alltags. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Multitasking und der Fahrleistung beim Autofahren her und hebt die potenziellen Risiken hervor, die mit dem Telefonieren während der Fahrt verbunden sind.
Studien im Simulator
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Studien, die im Fahrsimulator durchgeführt wurden, um die Auswirkungen des Telefonierens auf die Fahrleistung zu untersuchen. Die Studien beleuchten die Doppelaufgabeninterferenzen, die beim gleichzeitigen Telefonieren und Autofahren auftreten, und analysieren die Auswirkungen auf die Reaktionszeiten und das Bremsverhalten.
Schlüsselwörter
Multitasking, Doppelaufgabeninterferenzen, Telefonieren, Autofahren, Fahrleistung, Reaktionszeiten, Unfallrisiko, Freisprechanlage, Verkehrssicherheit
Häufig gestellte Fragen
Wie gefährlich ist Telefonieren beim Autofahren?
Es kann das Unfallrisiko um das Vierfache erhöhen, da es die Reaktionszeiten verschlechtert und die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen ablenkt.
Ist eine Freisprechanlage sicherer als das Handy in der Hand?
Nein, die kognitive Ablenkung ist bei beiden Varianten nahezu identisch. Das Problem liegt im Gesprächsprozess selbst, nicht nur in der Handbedienung.
Was bedeutet „Multitasking“ beim Autofahren?
Es beschreibt den Versuch, mehrere Aufgaben simultan zu bearbeiten, was jedoch oft zu Doppelaufgabeninterferenzen führt, da das Gehirn Kapazitätsgrenzen hat.
Welche kognitiven Prozesse werden beeinträchtigt?
Betroffen sind vor allem die Wahrnehmung von Signalen, die Entscheidungsfindung und die motorische Reaktion (z. B. Bremsverhalten).
Warum ist Radiohören weniger gefährlich als Telefonieren?
Radiohören ist eine passivere Tätigkeit, während ein Telefonat aktive kognitive Leistungen und soziale Interaktion erfordert, die mehr Ressourcen binden.
Was zeigen Simulatorstudien?
Studien belegen signifikant längere Bremswege und eine höhere Rate an verpassten Verkehrsschildern oder Ampelsignalen während des Telefonierens.
- Quote paper
- Katrin Simon (Author), 2014, Telefonieren beim Autofahren. Auswirkungen auf die kognitiven Prozesse und die Fahrleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344480