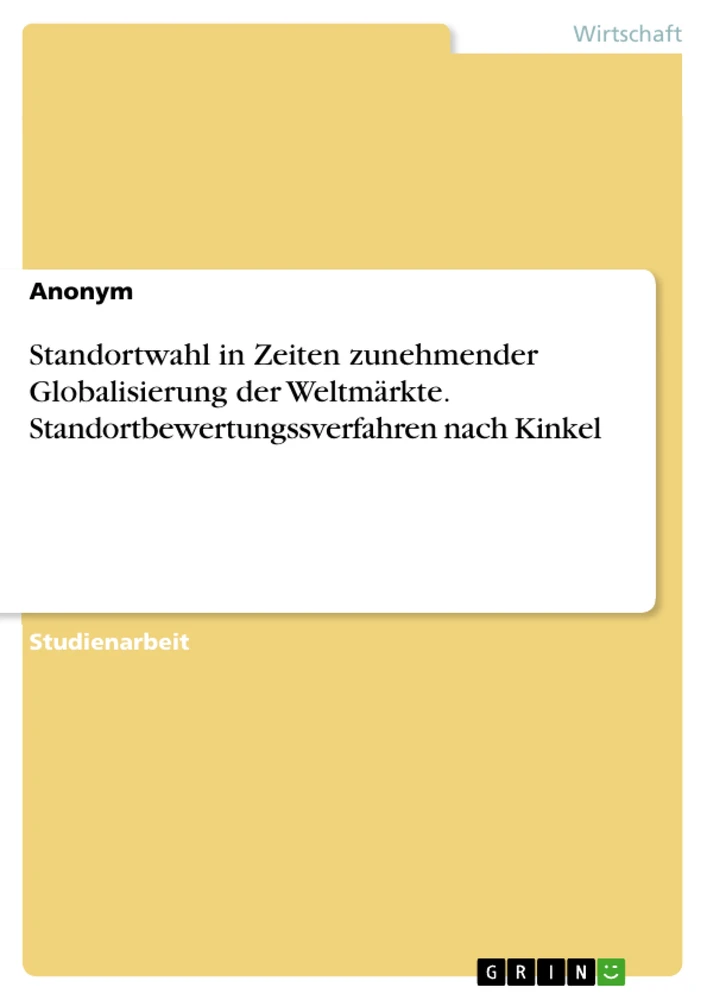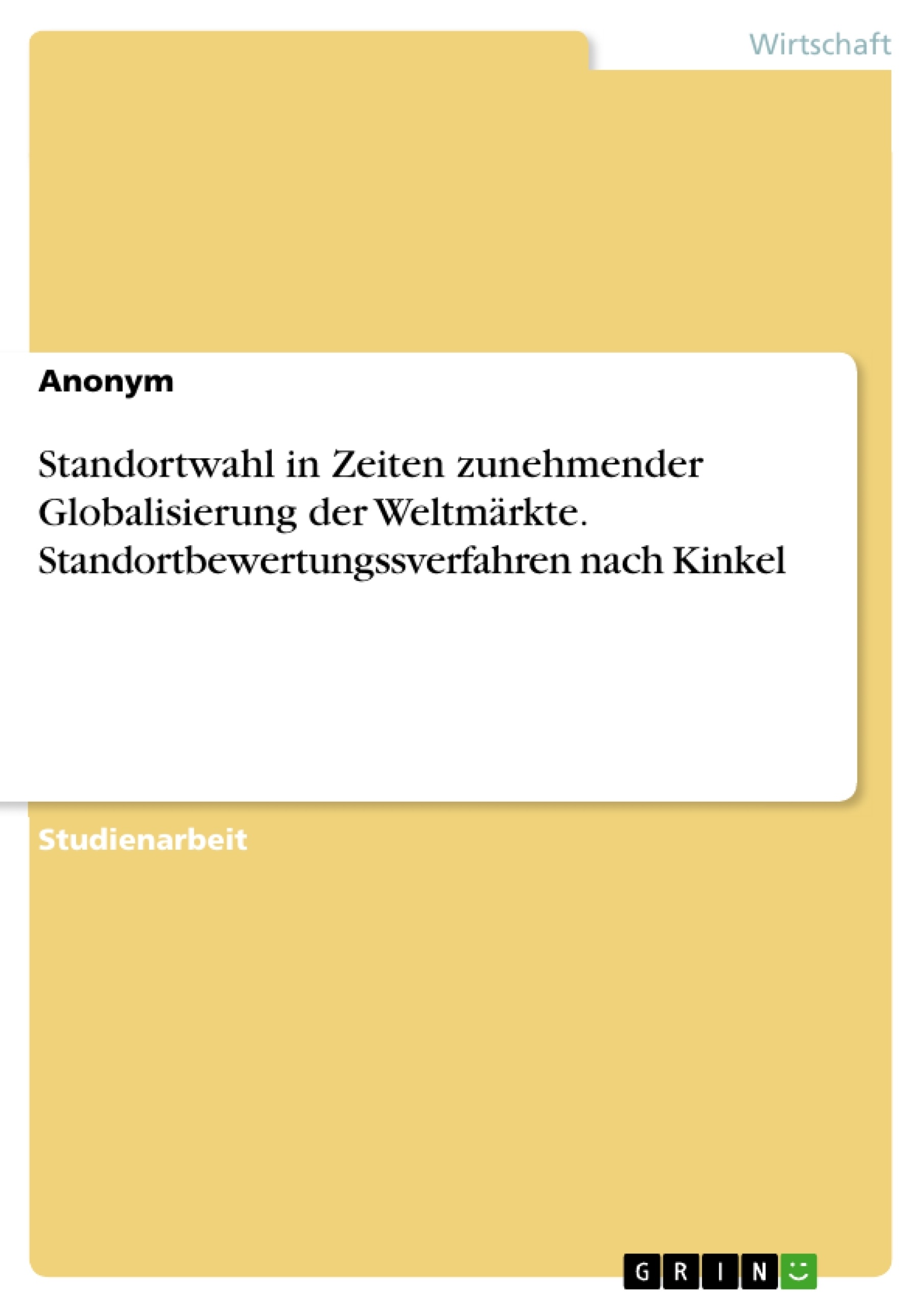Die Wahl des richtigen Standortes spielt für jedes Unternehmen eine wichtige Rolle. Die zunehmende Globalisierung der Weltmärkte und der Abbau von internationalen Hemmnissen, führt immer mehr Unternehmen der produzierenden Industrie dazu, ihre Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern. Als Grund dafür werden die schlechten Rahmenbedingungen, die in Deutschland herrschen, angegeben. Demnach machen zu hohe Arbeitskosten, kurze Arbeitszeiten, hohe Lohnnebenkosten und Steuern, den Standort Deutschland, neben den potentiellen Niedriglohnländern, als Standort für eine Produktionsstätte, immer unattraktiver. Weiterhin bieten sich für Unternehmen viele neue Standortalternativen, was die Standortwahl komplexer gestaltet. Anhand von Standortbewertungsverfahren, bei denen verschiedene Standortfaktoren (harte Faktoren und weiche Faktoren) bewertet werden, wird aus den gegebenen Standortalternativen die vorteilhaftteste Variante gewählt.
Dass sich eine Standortverlagerung in einigen Fällen jedoch als eine Fehlentscheidung her-ausstellen kann, zeigen Rückverlagerungsquoten von Unternehmen, die sich in den Jahren 2000 – 2006 für eine Produktionsverlagerung entschieden haben.
In seinem Buch „In- und ausländische Standorte richtig bewerten“, nennt Kinkel (2009) vier Grundfragen, die in jede Standortentscheidung mit einfließen müssen. Nach Kinkel (2009) ist der Grund dafür, weshalb 15 – 25 % der Verlagerungsentscheidungen sich als Fehlentschei-dungen entpuppen, welche einem Unternehmen Verluste in zweistelligen Millionenbeträgen einbringen können, dass diese Unternehmen ihre berücksichtigten Standortfaktoren nicht an-gemessen bewerten. Seine Kritik an traditionellen Standortbewertungsverfahren ist, dass den „harten Faktoren“ bei der Standortbewertung ein viel zu hoher Wert beigemessen wird und im Gegenzug die „weichen Faktoren“ zu kurz kommen, was grobe Fehleinschätzungen bei der Standortbewertung mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Standortplanung
- 2.1 Standortfaktoren
- 2.2 Traditionelle Standortbewertungsverfahren
- 2.2.1 Qualitative Bewertungsverfahren
- 2.2.2 Quantitative Bewertungsverfahren
- 3. Fehler bei der Standortwahl
- 3.1 Stimmigkeit von Wettbewerbs- und Standortstrategie
- 3.2 Optimierungspotentiale am bestehenden Standort werden übersehen
- 3.3 Netzwerbedarf wird unterschätzt
- 3.4 Szenarien Denken fehlt
- 3.5 Anlaufzeiten und Betreuungskosten werden unterschätzt
- 4. Neue Instrumente in der Standortbewertung
- 4.1 Checklisten erfolgskritischer Standortfaktoren
- 4.2 Historieninventur
- 4.3 Optimierungspotentiale am eigenen Standort untersuchen und bewerten
- 4.4 Transparenter Netzwerkbedarf
- 4.5 Szenario-basierte Standortbewertung
- 4.6 Strategisches Standortcontrolling
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der Standortbewertung, insbesondere im Kontext internationaler Standortverlagerungen. Sie analysiert die Bedeutung „weicher Faktoren“ bei Standortentscheidungen und zielt darauf ab, einen Lösungsansatz zu entwickeln, wie diese Faktoren zukünftig angemessen bewertet und quantifiziert werden können, um sie in die Standortbewertung zu integrieren.
- Die Bedeutung von „weichen Faktoren“ bei der Standortwahl
- Kritik an traditionellen Standortbewertungsverfahren
- Optimierungspotenziale am bestehenden Standort
- Neue Instrumente und Ansätze in der Standortbewertung
- Einbezug von Szenarien und strategischen Überlegungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz der Standortwahl für Unternehmen und die wachsende Bedeutung internationaler Standortverlagerungen. Sie diskutiert die Herausforderungen, die sich aus den schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland ergeben, und beleuchtet die Komplexität der Standortwahl angesichts neuer Standortalternativen. Das Kapitel stellt die Notwendigkeit von Standortbewertungsverfahren vor und kritisiert die Fokussierung auf „harte Faktoren“ in traditionellen Ansätzen. Die Bedeutung der „weichen Faktoren“ wird hervorgehoben.
2. Standortplanung
Dieses Kapitel definiert die Aufgabe der betrieblichen Standortplanung und die Motivation für Standortentscheidungen. Es stellt die Kriterien für die Standortwahl dar, darunter die Anlässe, die Standortalternativen und die relevanten Standortfaktoren.
3. Fehler bei der Standortwahl
Dieses Kapitel beleuchtet die häufigsten Fehler bei der Standortwahl. Es analysiert die mangelnde Stimmigkeit zwischen Wettbewerbs- und Standortstrategie, das Übersehen von Optimierungspotenzialen, die Unterschätzung des Netzwerbedarfs und die fehlende Berücksichtigung von Szenarien. Auch die Unterschätzung von Anlaufzeiten und Betreuungskosten wird als Fehlerpunkt genannt.
4. Neue Instrumente in der Standortbewertung
Kapitel 4 präsentiert neue Instrumente und Ansätze für die Standortbewertung. Es beinhaltet Checklisten für erfolgskritische Standortfaktoren, die Historieninventur, die Analyse von Optimierungspotenzialen am eigenen Standort, die transparente Betrachtung des Netzwerbedarfs, die Szenario-basierte Standortbewertung und das strategische Standortcontrolling.
Schlüsselwörter
Standortbewertung, Standortwahl, Standortverlagerung, „weiche Faktoren“, „harte Faktoren“, traditionelle Standortbewertungsverfahren, neue Instrumente, Szenario-basierte Bewertung, strategisches Standortcontrolling, Netzwerbedarf, Optimierungspotenziale.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Standortwahl in Zeiten zunehmender Globalisierung der Weltmärkte. Standortbewertungssverfahren nach Kinkel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344743