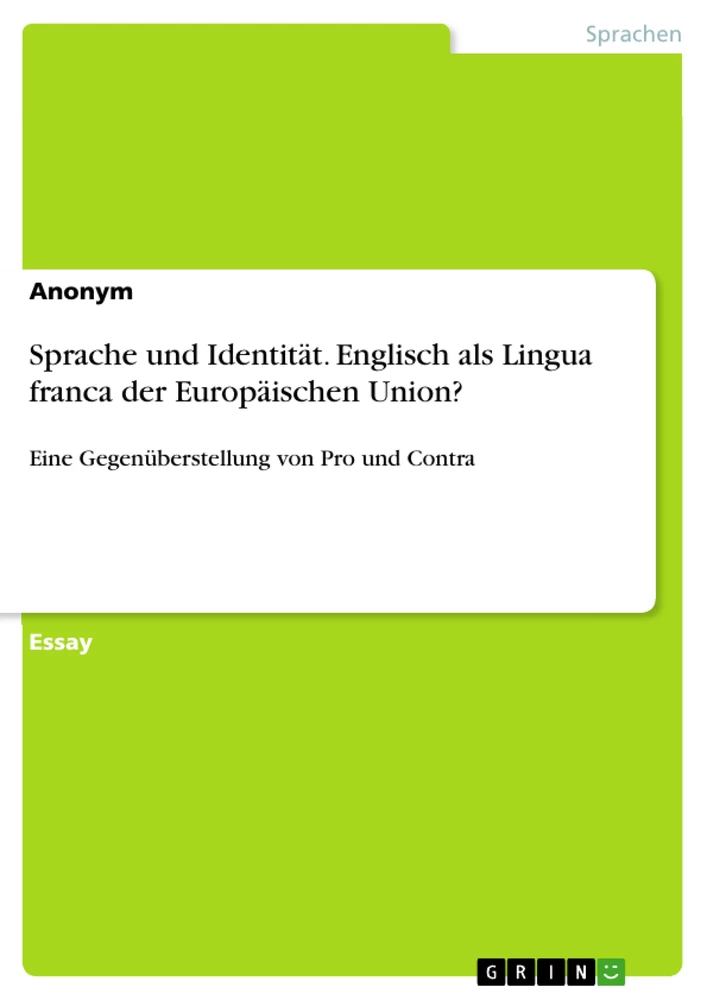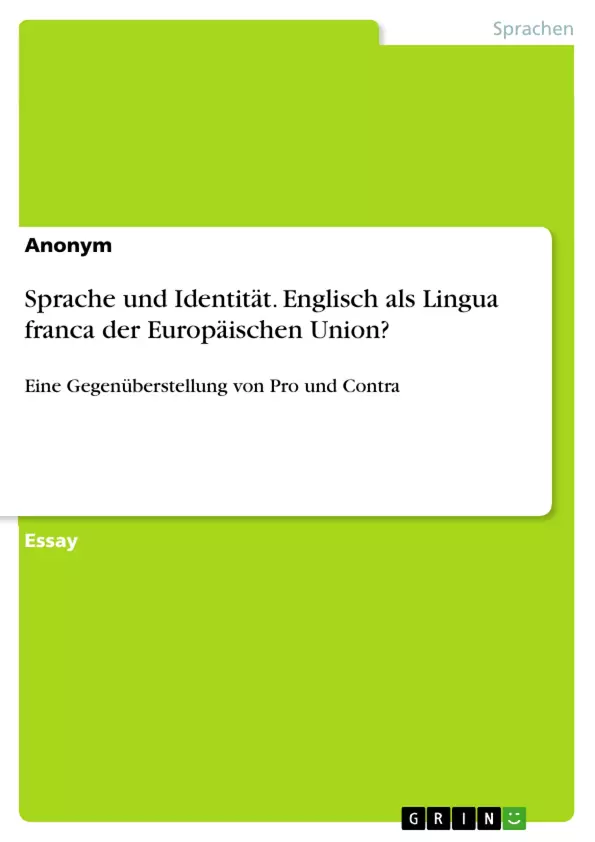Einer Sprache mächtig zu sein, so sagt Konrad Schröder, sei nicht nur eine Möglichkeit des in Kontakttretens mit der Umwelt, sondern viel mehr eine „Grundvoraussetzung des Menschseins“. Spreche man eine Sprache, so besitze man sie.
Auf dieser Basis hat die Europäische Union, in der sich 23 verschiedene Amtssprachen vereinen, im Vertrag von Maastricht eine aktivere Förderungspolitik für das Erlernen von Fremdsprachen eingeleitet. Besonders das Englische, die meist gesprochene Sprache der Welt, ist in dieser Förderung natürlich ein wichtiges Element. Die Vorteile scheinen einleuchtend: Die Menschen sind eher in der Lage, sich dynamischer auf dem europäischen Markt zu bewegen und die Arbeitskräfte sind flexibler über Ländergrenzen hinweg einsetzbar. Hinzukommend bringt das Fehlen von Sprachbarrieren z.B. auch in der Urlaubsgestaltung neue Vorteile und Vereinfachungen mit sich.
Doch wie sehr sollte man einer einheitlichen Sprache in allen Ländern der EU zustimmen? Inwieweit geht mit der Reduzierung der Muttersprache aufgrund einer vermeintlich übermäßigen Ausbildung einer oder mehrerer Fremdsprachen ein Verlust der eigenen Kultur einher? Die Vor- und Nachteile werden im Folgenden anhand zweier Plädoyers von Konrad Schröder und Jürgen Gerhards erläutert und in einem Fazit gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenüberstellung Pro und Contra: Englisch als Lingua franca
- Contra: Konrad Schröder (1995)
- Pro: Jürgen Gerhards (2015)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile der Einführung von Englisch als Lingua franca in der Europäischen Union. Sie analysiert die Argumente für und gegen eine solche Entwicklung, indem sie zwei gegensätzliche Positionen vergleicht und kontrastiert.
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Identität
- Die Rolle der Muttersprache für die kulturelle Identität
- Die Auswirkungen einer Lingua franca auf die sprachliche Vielfalt
- Das Konfliktpotential zwischen Nationalstaaten und Regionen
- Die Notwendigkeit einer europäischen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Rolle von Englisch als Lingua franca in der EU. Sie betont die Bedeutung von Sprache für die Identität und führt die Notwendigkeit der Förderung von Fremdsprachen in der EU an, wobei Englisch als besonders wichtig hervorgehoben wird. Die Arbeit kündigt eine Gegenüberstellung von Argumenten für und gegen Englisch als Lingua franca an, basierend auf den Positionen von Konrad Schröder und Jürgen Gerhards.
Gegenüberstellung Pro und Contra: Englisch als Lingua franca: Dieses Kapitel präsentiert die gegensätzlichen Positionen von Konrad Schröder (Contra) und Jürgen Gerhards (Pro) bezüglich Englisch als Lingua franca. Es stellt die Argumente beider Autoren systematisch gegenüber und bildet die Grundlage für die abschließende Bewertung im Fazit.
Schlüsselwörter
Sprache, Identität, Lingua franca, Englisch, Europäische Union, Mehrsprachigkeit, kulturelle Identität, Sprachpolitik, Nationalstaaten, Regionalsprachen, Konfliktpotential, europäische Identität.
FAQ: Sprachliche und Kulturelle Identität in der EU - Englisch als Lingua Franca
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile der Einführung von Englisch als Lingua franca in der Europäischen Union. Sie analysiert die Argumente für und gegen eine solche Entwicklung, indem sie zwei gegensätzliche Positionen vergleicht und kontrastiert. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Identität, die Rolle der Muttersprache, die Auswirkungen auf die sprachliche Vielfalt und das Konfliktpotential zwischen Nationalstaaten und Regionen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie den Zusammenhang zwischen Sprache und Identität, die Bedeutung der Muttersprache für die kulturelle Identität, die Auswirkungen einer Lingua franca auf die sprachliche Vielfalt, das Konfliktpotential zwischen Nationalstaaten und Regionen, und die Notwendigkeit einer europäischen Identität. Der Fokus liegt auf der Analyse der Argumente für und gegen die Verwendung von Englisch als Lingua franca in der EU.
Welche Positionen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die gegensätzlichen Positionen von Konrad Schröder (Contra Englisch als Lingua franca) und Jürgen Gerhards (Pro Englisch als Lingua franca). Die Argumente beider Autoren werden systematisch gegenübergestellt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel mit der Gegenüberstellung der Positionen von Schröder und Gerhards, und einem Fazit. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Hauptkapitel analysiert die Argumente für und gegen Englisch als Lingua franca. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant beschreiben, sind: Sprache, Identität, Lingua franca, Englisch, Europäische Union, Mehrsprachigkeit, kulturelle Identität, Sprachpolitik, Nationalstaaten, Regionalsprachen, Konfliktpotential, europäische Identität.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Vor- und Nachteile der Einführung von Englisch als Lingua franca in der Europäischen Union zu untersuchen und zu analysieren. Durch den Vergleich gegensätzlicher Positionen soll ein umfassendes Bild der Thematik vermittelt werden.
Welche Zusammenfassung der Kapitel gibt es?
Die Einleitung präsentiert die zentrale Fragestellung und die Bedeutung von Sprache für die Identität. Das Kapitel zur Gegenüberstellung der Positionen von Schröder und Gerhards analysiert systematisch die Argumente für und gegen Englisch als Lingua franca. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine abschließende Bewertung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Sprache und Identität. Englisch als Lingua franca der Europäischen Union?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346754