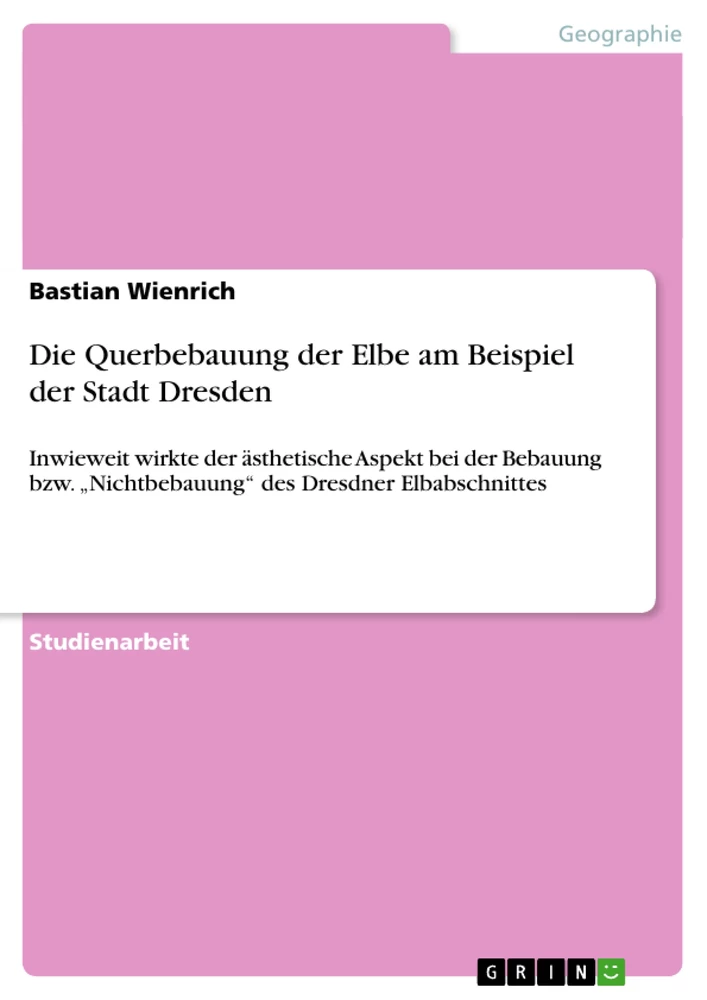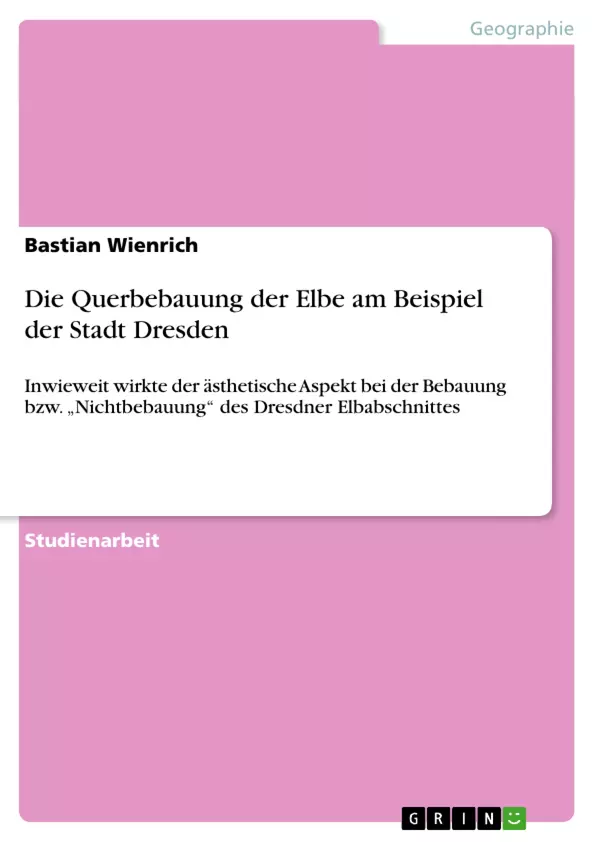Ein gemeinsames Merkmal großer Städte ist ihre Lage an einem größeren Fluß, sei es Wien an der Donau, Prag an der Moldau, Köln am Rhein oder Berlin an der Spree. Die Besiedlung einer günstigen Stelle an einem Wasserlauf bedeutete einige strategische Vorteile. Vor allem entwickelten sich diese Städte zu wichtigen Handelsknotenpunkten, da hier zumeist eine Brücke die ‚Verkehrswege’ beider Ufer verband. Gleichfalls dienten die Städte als Halte- und Umschlagspunkt für den Wasserverkehr. Das 19. Jahrhundert bedeutet in der Fluß- und Stadtentwicklung eine Zeit massivster Veränderungen. Der Beginn der Moderne, getragen durch neue soziale und politische Strukturen und durch revolutionäre technische Entwicklungen, die das wirtschaftliche und gleichzeitig das vorherrschende Wertegefüge nachhaltig veränderten, löste einen ungeahnten Wachstumsboom der Städte aus.
In der Beschreibung dieses Prozesses wird der Einfluß der Ströme aber auch der Einfluß der Städte auf die Flüsse oftmals marginalisiert oder ganz und gar vergessen. Dabei ist der oben genannte Siedlungsvorteil auch in dieser Epoche eine die Entwicklung beeinflußende Größe. Diese kann in zwei verschiedenen Dimensionen untersucht werden: einmal aus der Sicht des Flusses (Längsbebauung) und einmal aus der Sicht einer Stadt (Querbebauung). Diese Arbeit konzentriert sich auf die Querbebauung der Elbe aus der Sicht der Stadt Dresden in der zweiten Hälfte des 19. Jhd.. Dabei ist die Elbe aus städtebaulicher Sicht zu betrachten, sozusagen als Abschnitt der Stadt mit den typischen Eigenschaften und Wirkungen einer Wasserstraße.
Der Fluß wird in diesem Kontext verschiedenartig wahrgenommen. Der Fokus dieser Ausführungen liegt dabei in der Beantwortung der Frage, inwieweit die (relativ) naturnahe Flußlandschaft als ästhetischer Aspekt die Querbebauung beeinflußte. Vorab behandeln vier abstracts die für diese Zeit wichtigen Rahmenbedingungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- von der Residenzstadt zur bürgerlichen Metropole
- die Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Dresden
- Industrialisierung in Dresden
- Der Ausbau der Elbe zur Wasserstraße – eine Übersicht der Rahmendaten
- Hauptteil
- Die Wahrnehmung der Elbe – der Fluß als integraler Bestandteil der Stadt
- Der ästhetische Aspekt – Dresden, die bewahrte Stadt
- Der Generalbauplan 1859-62 und die „Normierung der Elbe“
- Das „Ortsstatut betreff der Industrieflächen“ von 1878
- Die Bauordnung von 1905
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Querbebauung der Elbe in Dresden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Fokus steht die Frage, inwieweit der ästhetische Aspekt der relativ naturnahen Flusslandschaft die Bebauung beeinflusste. Die Analyse betrachtet die städtebauliche Entwicklung Dresdens im Kontext der Industrialisierung und der damit verbundenen Veränderungen.
- Die Transformation Dresdens von einer Residenzstadt zu einer bürgerlichen Metropole
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die Stadtentwicklung
- Die Wahrnehmung der Elbe als integraler Bestandteil der Stadt
- Die Rolle städtebaulicher Planungen und Bauordnungen (Generalbauplan, Ortsstatut, Bauordnung 1905)
- Der ästhetische Aspekt der Elbelandschaft und dessen Bedeutung für die Bebauung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie die Bedeutung von Flüssen für die Entwicklung großer Städte hervorhebt und die spezifische Fragestellung nach dem Einfluss des ästhetischen Aspekts der Elbelandschaft auf die Querbebauung in Dresden formuliert. Es wird auf die vielschichtige Literaturlage hingewiesen und die verwendeten Quellen (u.a. Werke von Pampel, Geyer, Löffler, Schmidt, Helas, Forberger, Kiesewetter, Korndörfer und Jüngel) sowie die Archivalien im Sächsischen Hauptstaatsarchiv und Dresdner Stadtarchiv erwähnt. Die Arbeit konzentriert sich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und kündigt eine Beschreibung vorbereitender Fakten in Form von Abstracts an.
Die Wahrnehmung der Elbe – der Fluß als integraler Bestandteil der Stadt: Dieses Kapitel würde die verschiedenen Perspektiven auf die Elbe als Teil der Dresdner Stadtlandschaft beleuchten. Es würde untersuchen, wie die Elbe von der Bevölkerung und den städtischen Planern wahrgenommen wurde – sowohl als Verkehrsweg, als auch als Landschaftsmerkmal. Die sich verändernden Nutzungen des Flusses im Kontext der Industrialisierung und deren Auswirkungen auf das Stadtbild wären zentrale Themen dieses Kapitels. Die Untersuchung würde wahrscheinlich auf historischen Karten, Plänen und schriftlichen Quellen beruhen, um die Wahrnehmung und die Nutzung der Elbe zu rekonstruieren.
Der ästhetische Aspekt – Dresden, die bewahrte Stadt: Dieses Kapitel würde sich eingehend mit dem ästhetischen Aspekt der Elbelandschaft und dessen Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung befassen. Es würde analysieren, wie städtebauliche Planungen und Bauordnungen (z.B. der Generalbauplan von 1859-62, das Ortsstatut von 1878, die Bauordnung von 1905) versuchten, die Bebauung entlang der Elbe zu regulieren und gleichzeitig den ästhetischen Wert der Landschaft zu erhalten oder zu fördern. Konkrete Beispiele von Baumaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Landschaft würden diskutiert. Die Analyse würde beleuchten, wie der Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen (Industrialisierung, Ausbau der Infrastruktur) und dem Wunsch nach einer ästhetisch ansprechenden Stadtlandschaft gelöst oder nicht gelöst wurde.
Schlüsselwörter
Dresden, Elbe, Querbebauung, Stadtentwicklung, Industrialisierung, Ästhetik, Stadtplanung, Bauordnungen, Generalbauplan, Ortsstatut, 19. Jahrhundert, Residenzstadt, bürgerliche Metropole, Flusslandschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Querbebauung der Elbe in Dresden im 19. Jahrhundert
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Querbebauung der Elbe in Dresden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des ästhetischen Aspekts der Elbelandschaft auf die Bebauung im Kontext der Industrialisierung und der Transformation Dresdens von einer Residenzstadt zu einer bürgerlichen Metropole.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte herausfinden, inwieweit der ästhetische Aspekt der relativ naturnahen Flusslandschaft die Bebauung entlang der Elbe beeinflusste. Analysiert werden die städtebauliche Entwicklung, der Einfluss der Industrialisierung und die Rolle von städtebaulichen Planungen und Bauordnungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Transformation Dresdens, den Einfluss der Industrialisierung, die Wahrnehmung der Elbe, die Rolle städtebaulicher Planungen (Generalbauplan, Ortsstatut, Bauordnung 1905) und den ästhetischen Aspekt der Elbelandschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Kapiteln zur Wahrnehmung der Elbe und dem ästhetischen Aspekt) und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt den Kontext, die Fragestellung und die verwendeten Quellen. Der Hauptteil analysiert die verschiedenen Perspektiven auf die Elbe und den Einfluss städtebaulicher Regelungen auf die Bebauung. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Werke (u.a. von Pampel, Geyer, Löffler, Schmidt, Helas, Forberger, Kiesewetter, Korndörfer und Jüngel) sowie Archivalien aus dem Sächsischen Hauptstaatsarchiv und dem Dresdner Stadtarchiv.
Wie wird der ästhetische Aspekt behandelt?
Das Kapitel "Der ästhetische Aspekt – Dresden, die bewahrte Stadt" analysiert, wie städtebauliche Planungen (Generalbauplan 1859-62, Ortsstatut 1878, Bauordnung 1905) versuchten, die Bebauung entlang der Elbe zu regulieren und den ästhetischen Wert der Landschaft zu erhalten oder zu fördern. Der Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Wunsch nach einer ästhetisch ansprechenden Stadtlandschaft wird beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Industrialisierung?
Die Industrialisierung wird als wichtiger Kontextfaktor betrachtet, der die Stadtentwicklung und die Nutzung der Elbe beeinflusste. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Industrialisierung auf das Stadtbild und die Wahrnehmung der Elbe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Dresden, Elbe, Querbebauung, Stadtentwicklung, Industrialisierung, Ästhetik, Stadtplanung, Bauordnungen, Generalbauplan, Ortsstatut, 19. Jahrhundert, Residenzstadt, bürgerliche Metropole, Flusslandschaft.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere detaillierte Informationen finden sich im vollständigen Text der Arbeit.
- Quote paper
- Bastian Wienrich (Author), 2004, Die Querbebauung der Elbe am Beispiel der Stadt Dresden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34682