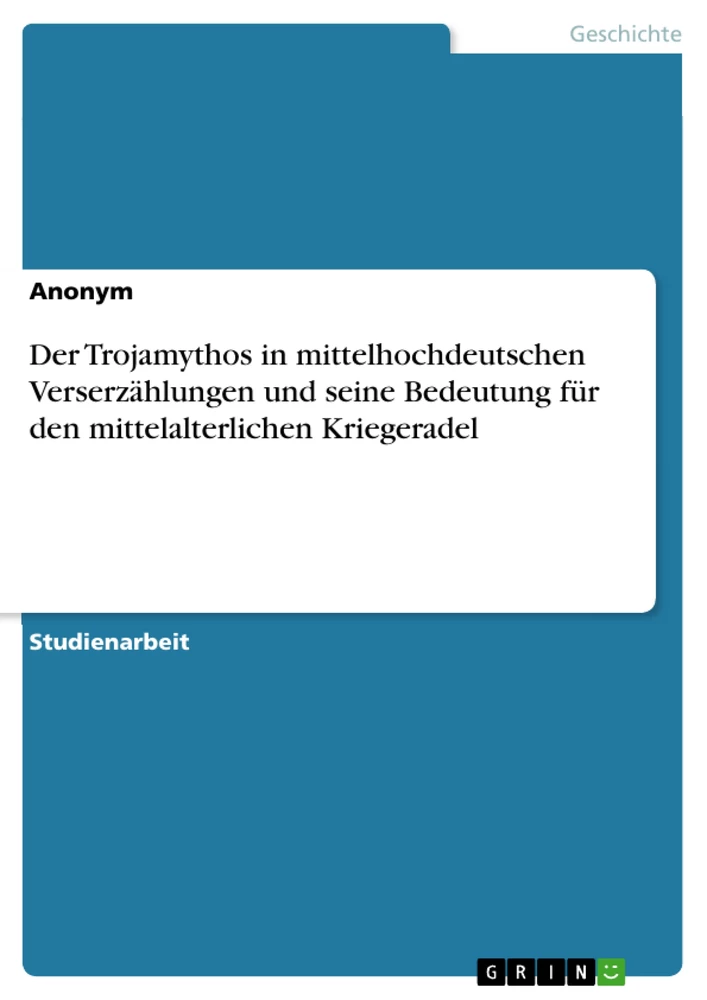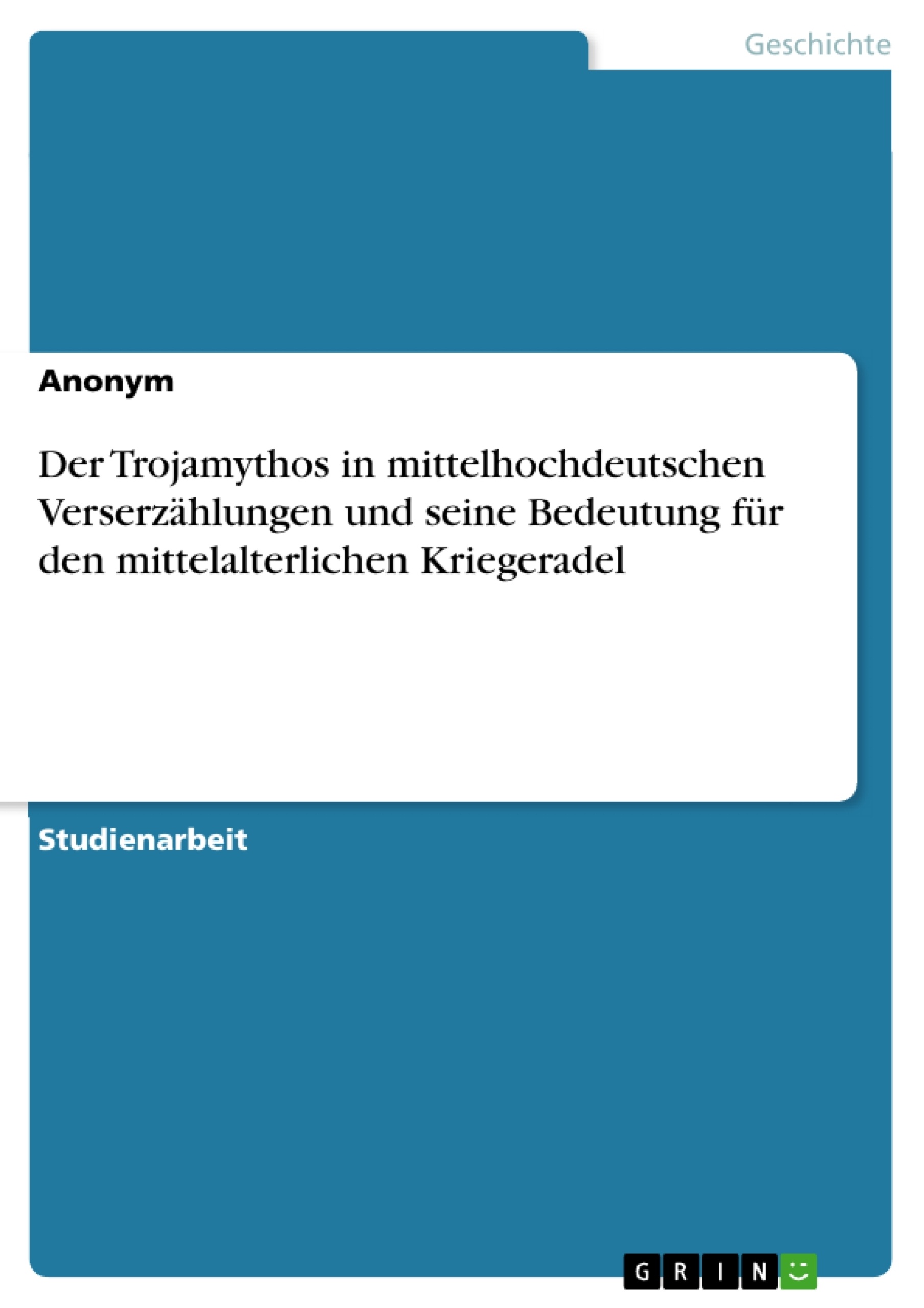Die deutschsprachige Troja-Rezeption in literarischen Werken lässt sich bis spät ins 12. Jahrhundert zurückdatieren, als Heinrich von Veldeke den „Eneasroman“ verfasste. Er gilt als inhaltliche Fortsetzung des von Herbort von Fritzlar geschaffenen „Liet von Troye“ und legte den Fokus auf den Titelhelden Aeneas. In diesen Zeitraum verortet man auch die Versdichtung „Mauritius von Craûn“ eines anonymen Urhebers.
Im Zuge der Arbeit soll unter Berücksichtigung der mittelalterlichen Texte erschlossen werden, welche Rolle der Trojamythos für das Selbstverständnis des ritterlichen Standes spielte. Dazu wird der Trojanische Krieg auf die Attraktivität bezüglich ritterlicher Motive untersucht. Weiter soll erörtert werden, ob und auf welche Weise diese ihren Weg in die mittelalterlichen Texte gefunden haben. Hier ist es spannend herauszufinden, auf welches antike Werk man sich beruft - Homer oder jüngere Vorlagen? Auf einer Metaebene soll außerdem erschlossen werden, welchen Wert die Rückbesinnung auf den Trojanischen Krieg dem Werk bietet. Und Troja somit als Wiege des Rittertums angesehen werden kann.
In diesem Zusammenhang gilt es zu klären, wie präsent der Trojastoff im Gedächtnis der zeitgenössischen Rezipienten war. Hierbei sollte man auch die Rolle des damaligen Geschichtsbewusstseins nicht unterschätzen, daher erfolgt auch eine Auseinandersetzung mit diesem. Unvermeidbar ist es, sich über die Grenzen der Geschichtswissenschaft hinauszubewegen, denn das Eindringen in den mediävistischen Bereich der Germanistik gestaltet sich als unausweichlich, um Rittertum, Minne und Heldentaten besser greifen zu können. In das Feld der Romanistik wird sich diese Arbeit hingegen nicht weit hineinwagen, doch sollte man nicht außer Acht lassen, dass deutsche, literarische Werke meistens auf französische Vorbilder zurückzuführen sind; die Leistung des deutschen Dichters lag nicht in einer Neuschöpfung, sondern in der Übersetzung, welche im Mittelalter eher eine Adaption war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Trojamythos im Mittelalter
- Idee der translatio imperii
- Legitimation der weltlichen Adelsherrschaft
- Die Quellen des Trojamythos im Mittelalter
- Homer
- Die römischen Dichter
- Die vermeintlichen Augenzeugenberichte
- Ephemeris belli Troiani
- Acta diurna belli Troiani
- Literarisches Potenzial im Kampf um die ideelle Ritterschaft
- Die antiken Helden des Krieges
- Das ritterliche Heldenideal
- Troja in der mittelhochdeutschen Versdichtung anhand von drei Beispielen
- Mediaevalisierung - das Geschichtsbewusstsein in der Literatur im hohen Mittelalter
- Heinrich von Veldekes Eneas
- Herbort von Fritzlars Liet von Troye
- Mauricius von Craûn
- Die Idee der translatio militiae im Promythion
- Die parodierte Trojahandlung im Hauptteil
- Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Trojamythos für das Selbstverständnis des ritterlichen Standes im Mittelalter, insbesondere anhand mittelhochdeutscher Verserzählungen. Die Zielsetzung besteht darin, die Rezeption des Trojanischen Krieges in der mittelalterlichen Literatur zu analysieren und zu ergründen, welche ritterlichen Motive aus dem Mythos übernommen und in den Texten verarbeitet wurden. Weiterhin soll geklärt werden, welche antiken Quellen (Homer oder spätere Bearbeitungen) den mittelalterlichen Autoren dienten und welchen Wert die Rückbesinnung auf Troja für die jeweiligen Werke hatte.
- Die Rezeption des Trojamythos im hohen Mittelalter
- Die Übernahme ritterlicher Motive aus dem Trojamythos in die mittelhochdeutsche Literatur
- Die verwendeten antiken Quellen und deren Einfluss auf die mittelalterliche Darstellung
- Die Bedeutung des Geschichtsbewusstseins im Mittelalter für die Interpretation des Trojamythos
- Troja als Wiege des Rittertums im mittelalterlichen Verständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschsprachigen Troja-Rezeption im späten 12. Jahrhundert ein und benennt die zentralen Werke von Heinrich von Veldeke, Herbort von Fritzlar und den anonymen Autor von Mauritius von Craûn. Sie skizziert die Forschungsfrage nach der Rolle des Trojamythos für das Selbstverständnis des Rittertums und kündigt die methodische Vorgehensweise an, welche die Analyse mittelalterlicher Texte mit der Erforschung der antiken Quellen verbindet. Die Arbeit positioniert sich an der Schnittstelle von Mediävistik und Germanistik, wobei der Bezug zu französischen Vorbildern berücksichtigt, aber nicht im Detail behandelt wird.
Der Trojamythos im Mittelalter: Dieses Kapitel beschreibt die weitverbreitete Präsenz und den hohen Stellenwert des Trojamythos im hohen Mittelalter. Er war fester Bestandteil der Bildung und wurde als historische Wahrheit betrachtet. Der Text beleuchtet die Gründe für die Popularität des Mythos: seine exotische Ferne, sein hohes Alter und seine enge Verbindung zur römischen Geschichte. Es wird betont, dass das mittelalterliche Geschichtsverständnis eher heilsgeschichtlich als historisch war, mit einer Einteilung der Geschichte in Reiche oder Weltzeitalter. Der Untergang Trojas wird als wichtiges Datum der Weltgeschichte und als Bezugspunkt für die Stadtgründung Roms dargestellt. Die Rolle des Mythos im Kontext der fränkischen Stammesgeschichte und der Legitimation der Herrschaft wird angedeutet.
Die Quellen des Trojamythos im Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die Quellen, auf die sich die mittelalterlichen Autoren bezogen haben. Es erwähnt Homer und römische Dichter als klassische Quellen. Besonderes Augenmerk wird auf vermeintliche Augenzeugenberichte wie die Ephemeris belli Troiani und Acta diurna belli Troiani gelegt. Die Unterscheidung und Bewertung dieser unterschiedlichen Quellen und deren Einfluss auf die literarische Bearbeitung des Trojamythos werden angekündigt, ohne diese jedoch bereits zu analysieren.
Literarisches Potenzial im Kampf um die ideelle Ritterschaft: Dieses Kapitel analysiert das literarische Potenzial des Trojamythos für die Darstellung des ritterlichen Heldenideals im Mittelalter. Es thematisiert die Übertragung antiker Heldenfiguren und deren Anpassung an mittelalterliche Vorstellungen von Ritterschaft, Tapferkeit und Minne. Der Fokus liegt auf der Konstruktion und der Funktionalität des ritterlichen Ideals in der mittelalterlichen Literatur. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen mittelhochdeutschen Texten wird für den nächsten Abschnitt angekündigt.
Troja in der mittelhochdeutschen Versdichtung anhand von drei Beispielen: Dieses Kapitel analysiert drei Beispiele mittelhochdeutscher Versdichtungen – die Werke von Heinrich von Veldeke, Herbort von Fritzlar und Mauricius von Craûn – um die Verarbeitung des Trojamythos im Detail zu untersuchen. Es wird die Mediaevalisierung des Stoffes und die Rolle des Geschichtsbewusstseins der Zeit in der literarischen Gestaltung thematisiert. Die jeweiligen individuellen Interpretationen und Adaptionen des Mythos durch die einzelnen Autoren und die damit verbundenen Veränderungen und Weiterentwicklungen des Troja-Stoffes werden thematisiert.
Schlüsselwörter
Trojamythos, Mittelalter, ritterlicher Stand, mittelhochdeutsche Literatur, Heinrich von Veldeke, Herbort von Fritzlar, Mauricius von Craûn, translatio imperii, Geschichtsbewusstsein, Heldenideal, antike Quellen, Romanistik, Germanistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Rezeption des Trojamythos
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Trojamythos für das Selbstverständnis des ritterlichen Standes im hohen Mittelalter, insbesondere anhand mittelhochdeutscher Verserzählungen. Sie analysiert die Rezeption des Trojanischen Krieges in der mittelalterlichen Literatur und ergründet, welche ritterlichen Motive aus dem Mythos übernommen und in den Texten verarbeitet wurden. Weiterhin wird untersucht, welche antiken Quellen den mittelalterlichen Autoren dienten und welchen Wert die Rückbesinnung auf Troja für die jeweiligen Werke hatte.
Welche mittelhochdeutschen Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei zentrale Beispiele mittelhochdeutscher Versdichtungen: Heinrich von Veldekes Eneas, Herbort von Fritzlars Liet von Troye und den anonymen Mauricius von Craûn. Diese Texte dienen als Fallstudien zur Untersuchung der Verarbeitung des Trojamythos.
Welche antiken Quellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt sowohl Homer als auch römische Dichter als klassische Quellen des Trojamythos. Besonderes Augenmerk wird auf vermeintliche Augenzeugenberichte wie die Ephemeris belli Troiani und Acta diurna belli Troiani gelegt. Die Analyse untersucht den Einfluss dieser unterschiedlichen Quellen auf die literarische Bearbeitung des Mythos im Mittelalter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Rezeption des Trojamythos im hohen Mittelalter; die Übernahme ritterlicher Motive aus dem Trojamythos in die mittelhochdeutsche Literatur; die verwendeten antiken Quellen und deren Einfluss; die Bedeutung des Geschichtsbewusstseins im Mittelalter für die Interpretation des Trojamythos; und Troja als Wiege des Rittertums im mittelalterlichen Verständnis.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Trojamythos im Mittelalter, ein Kapitel über die Quellen des Mythos, ein Kapitel über das literarische Potenzial des Mythos für die Darstellung des ritterlichen Ideals, ein Kapitel mit der detaillierten Analyse dreier mittelhochdeutscher Texte und ein Schlussfazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Methodik vor, während die einzelnen Kapitel die oben genannten Themenschwerpunkte detailliert behandeln.
Welche Rolle spielt das Geschichtsbewusstsein des Mittelalters?
Das mittelalterliche Geschichtsverständnis, geprägt von einer heilsgeschichtlichen Perspektive und einer Einteilung der Geschichte in Reiche oder Weltzeitalter, spielt eine wichtige Rolle bei der Interpretation des Trojamythos. Der Untergang Trojas wird als wichtiges Datum der Weltgeschichte und als Bezugspunkt für die Stadtgründung Roms dargestellt. Das Geschichtsbewusstsein beeinflusst die Art und Weise, wie der Mythos in der mittelalterlichen Literatur verarbeitet und interpretiert wird.
Welche Bedeutung hat der Trojamythos für das Rittertum?
Der Trojamythos hatte eine große Bedeutung für das Selbstverständnis des Rittertums im Mittelalter. Die Arbeit untersucht, wie antike Heldenfiguren in die mittelalterliche Vorstellung von Ritterschaft, Tapferkeit und Minne integriert wurden und wie der Mythos zur Konstruktion und Funktionalisierung des ritterlichen Ideals in der Literatur diente. Troja wird als eine Art "Wiege des Rittertums" im mittelalterlichen Verständnis präsentiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Trojamythos, Mittelalter, ritterlicher Stand, mittelhochdeutsche Literatur, Heinrich von Veldeke, Herbort von Fritzlar, Mauricius von Craûn, translatio imperii, Geschichtsbewusstsein, Heldenideal, antike Quellen, Romanistik, Germanistik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Der Trojamythos in mittelhochdeutschen Verserzählungen und seine Bedeutung für den mittelalterlichen Kriegeradel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347044