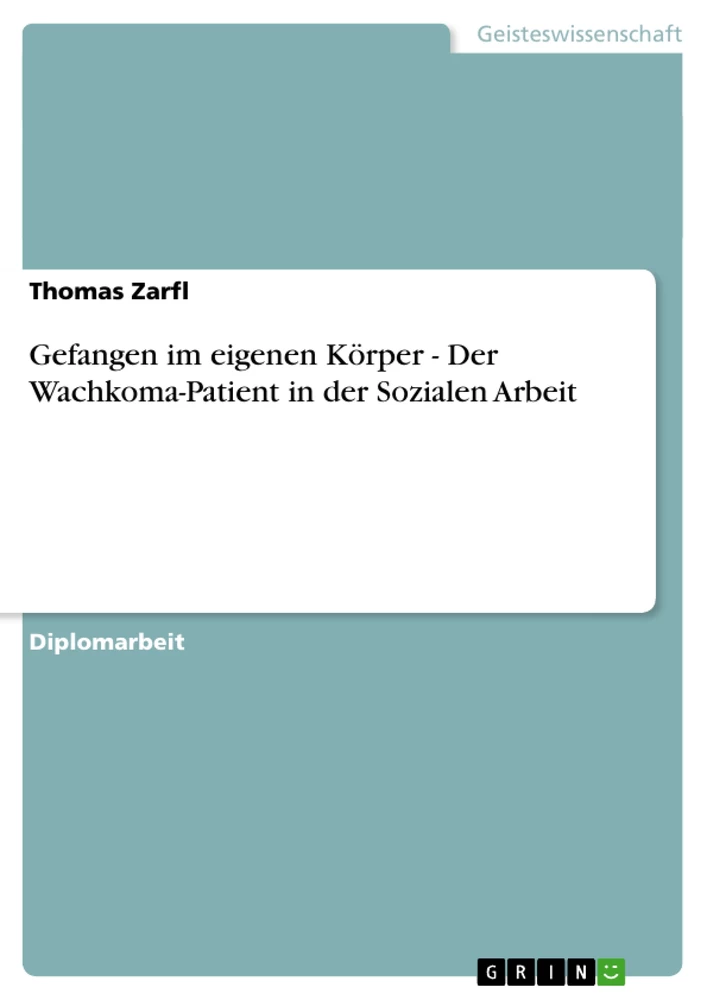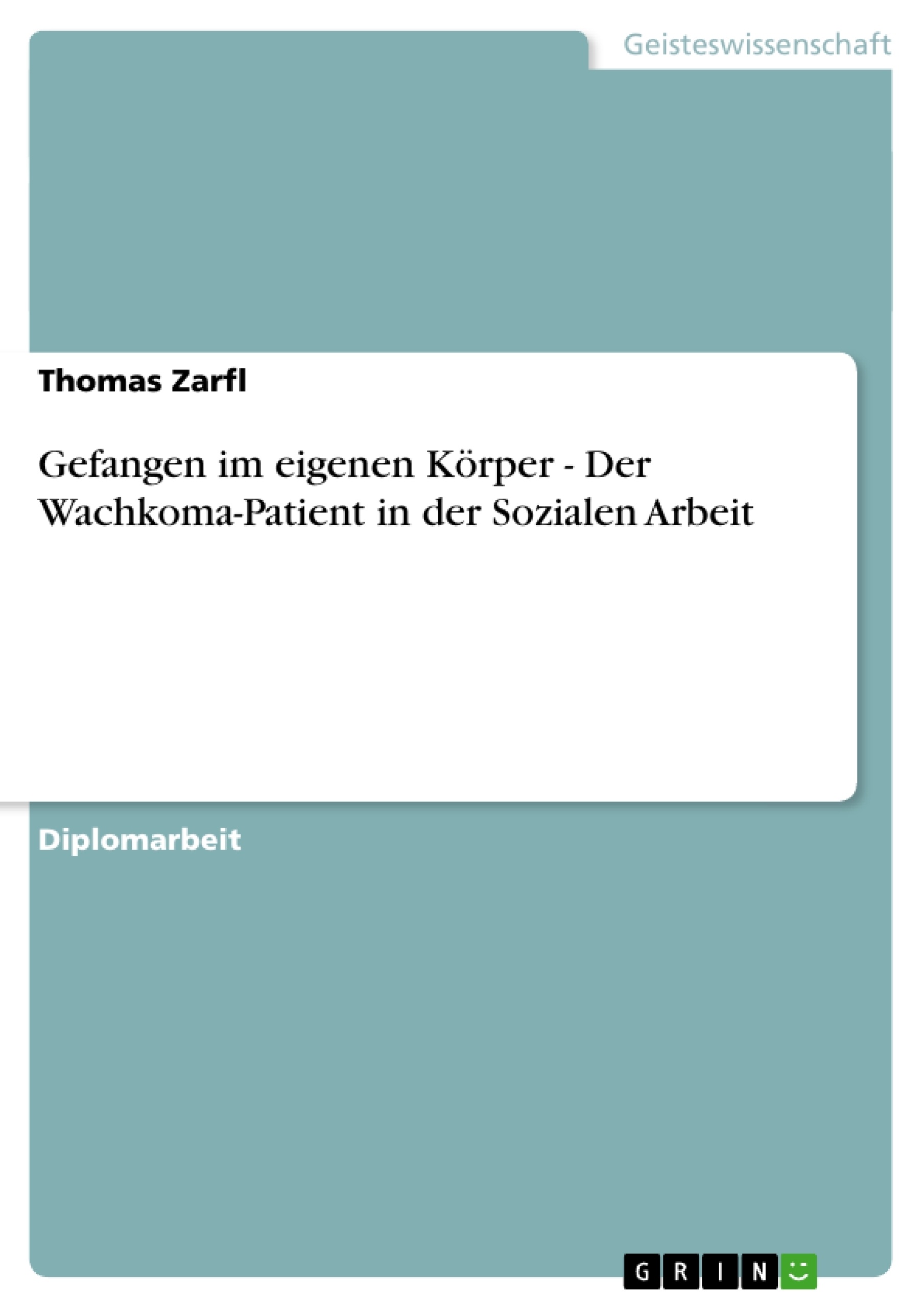Ich möchte die Aufmerksamkeit für ein eher seltenes Thema gewinnen. In Zeiten knapper ökonomischer Ressourcen, geprägt von „Sparmaßnahmen“ allerorts und primär im Sozial- und Gesundheitswesen, wird oftmals die Versorgungslage und Existenz von scheinbar unheilbaren Schwerstkranken zuerst in Frage gestellt. Menschen im Wachkoma oder ähnlich schwierigen Lebenssituationen wird in zunehmendem Maße das Recht auf Leben und adäquater Versorgung streitig gemacht - sie gelten als vermeidbarer Kostenfaktor und finden kaum Beachtung in unserer Gesellschaft. Dabei gibt es für die neuerdings immer wieder aufkommenden Forderungen nach Behandlungsabbruch („ Sterbehilfe“) weniger ärztliche oder medizinische Gründe als wirtschaftliche.
Mir ist es ein großes Anliegen auf diesen spannenden Themenbereich näher einzugehen, ihn in seiner Komplexität zu behandeln und damit Aufklärungsarbeit zu leisten. Dem breiten Umfang der Themenstellung wird im Aufriss vorliegender Arbeit Rechnung getragen:
Zunächst gilt es, im ersten Kapitel das vielschichtige Krankheitsbild aus medizinischer Sicht angemessen zu beschreiben, umfasst die Diagnose „Wachkoma“ doch eine Fülle unterschiedlicher Symptome und Krankheitsverläufe. Das zweite Kapitel greift die Rehabilitationsmöglichkeiten der betroffenen Personen auf. Menschen im Wachkoma benötigen dringend eine qualifizierte Behandlung, um mit der Krankheit leben zu lernen und sich mit den Realitäten zu Recht finden zu können. Abschnitt drei der Arbeit rückt die schwierige Situation der Angehörigen Schädel-Hirn-Verletzter ins Blickfeld. Ohne Frage sind nicht nur die Patienten selbst, sondern auch nahe stehende Personen aus ihrem sozialen Umfeld, sprich Familienmitglieder, Freunde und Bekannte betroffen. Die ethischen Überlegungen des vierten Kapitels zeigen auf, wodurch das Leben der Kranken bedroht ist und wie ein angemessener Umgang auf der ethisch-moralischen Ebene möglich ist. Der analytische Teil der Arbeit mündet im fünften Kapitel in eine Sichtung des Entwicklungsstandes einer sich professionalisierenden Sozialen Arbeit im Umgang mit Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen. Sozialpädagogische Erkenntnisse aus dem Bereich der klinischen Sozialarbeit bilden die literarische Basis der Untersuchung. Die Arbeit schließt im sechsten Kapitel mit einer Veranschaulichung praktischer Herangehensweisen im stationären Umgang mit den Adressaten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das apallische Syndrom
- Entstehungsursachen des apallischen Syndroms
- Symptome von Menschen im Wachkoma
- Heilungschancen von Wachkoma-Patienten
- Anzeichen einer möglichen Remission
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Die Rehabilitation des Wachkoma-Patienten
- Überlebenssicherung durch Intensivversorgung im Krankenhaus
- Die Frührehabilitation
- Bewusstseinsförderung durch gezielte Stimulation
- Schulische, berufliche und soziale Wiedereingliederung
- Die Langzeitversorgung schwerst-hirngeschädigter Menschen
- Die Mitwirkung der Angehörigen
- Beziehungs- und Kommunikationsaufbau mit dem Wachkoma-Patienten
- Belastungen
- Entlastung der Angehörigen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Ethische Aspekte im Umgang mit Wachkoma-Patienten
- Biomedizinisches Denkmodell als Gefahr für Wachkoma-Patienten
- Die Beachtung der Menschenwürde als Grundprinzip für ethisch handelnde Menschen
- Die Ethik der Achtsamkeit: mögliche Orientierung für Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Umgang mit Wachkoma-Patienten
- Soziale Arbeit mit Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen in stationären Einrichtungen
- Ausgangspunkt der Sozialen Arbeit: Das Prinzip der Ganzheitlichkeit
- Die psychosoziale Beratung der Leidtragenden
- Angehörigenarbeit
- Zusammenarbeit mit anderen Personen und Diensten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Konzeptionelle Überlegungen im stationären Umgang mit Wachkoma-Patienten am Beispiel von Einrichtungen der aktivierenden Dauerpflege
- Definition, Funktion und Inhalt von Konzepten
- Notwendigkeit von Konzepten
- Die Konzeptentwicklung
- Möglichkeiten der Betreuung und Begleitung apallischer Bewohner innerhalb einer Altenpflegeeinrichtung
- Konzeptionelle Überlegungen einer Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit erworbenen Schädel-Hirnverletzungen
- Fazit
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die komplexe Situation von Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen. Ziel ist es, die medizinischen, rehabilitativen, ethischen und sozialarbeiterischen Aspekte dieser Thematik umfassend darzustellen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Versorgung dieser Patientengruppe zu beleuchten. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderungen der Langzeitversorgung und die Notwendigkeit angepasster Konzepte in stationären Einrichtungen.
- Das apallische Syndrom und seine medizinischen Aspekte
- Rehabilitationsmöglichkeiten und -strategien für Wachkoma-Patienten
- Die psychosoziale Belastung der Angehörigen und deren Unterstützung
- Ethische Fragestellungen im Umgang mit Wachkoma-Patienten
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der stationären Langzeitversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung der adäquaten Versorgung von Wachkoma-Patienten angesichts knapper Ressourcen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
Das apallische Syndrom: Dieses Kapitel beschreibt das apallische Syndrom aus medizinischer Sicht. Es beleuchtet Entstehungsursachen, Symptome, Heilungschancen und Anzeichen einer möglichen Remission. Die Beschreibung der verschiedenen Symptome und Krankheitsverläufe unterstreicht die Heterogenität dieser Erkrankung.
Die Rehabilitation des Wachkoma-Patienten: Das Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Phasen der Rehabilitation, von der intensivmedizinischen Versorgung bis hin zur langfristigen Betreuung. Es werden Bewusstseinsförderung durch Stimulation, sowie schulische, berufliche und soziale Wiedereingliederung thematisiert. Die Bedeutung einer ganzheitlichen, individuell angepassten Rehabilitation wird hervorgehoben.
Die Mitwirkung der Angehörigen: Hier wird die herausfordernde Situation der Angehörigen von Wachkoma-Patienten im Fokus betrachtet. Das Kapitel behandelt den Aufbau von Beziehungen und Kommunikation, die psychischen Belastungen der Angehörigen sowie Möglichkeiten zur Entlastung und Unterstützung. Die Bedeutung der sozialen Einbindung und des Informationsaustauschs wird unterstrichen.
Ethische Aspekte im Umgang mit Wachkoma-Patienten: Dieses Kapitel diskutiert ethische Dilemmata im Umgang mit Wachkoma-Patienten. Es beleuchtet die Gefahren eines rein biomedizinischen Denkansatzes und betont die Bedeutung der Wahrung der Menschenwürde. Die „Ethik der Achtsamkeit“ wird als Orientierungshilfe für Sozialarbeiter vorgestellt.
Soziale Arbeit mit Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen in stationären Einrichtungen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit in der Versorgung von Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit bildet den Ausgangspunkt. Die Kapitel behandelt die psychosoziale Beratung, Angehörigenarbeit und die Zusammenarbeit mit anderen Diensten. Die Bedeutung einer ganzheitlichen, klientenzentrierten Herangehensweise wird hervorgehoben.
Konzeptionelle Überlegungen im stationären Umgang mit Wachkoma-Patienten am Beispiel von Einrichtungen der aktivierenden Dauerpflege: Dieses Kapitel präsentiert konzeptionelle Überlegungen zweier Einrichtungen zur Langzeitversorgung von Wachkoma-Patienten. Es analysiert verschiedene Konzepte und deren praktische Umsetzung, beleuchtet die Notwendigkeit individueller Betreuung und Begleitung und vergleicht verschiedene Ansätze zur Pflege und Begleitung apallischer Bewohner.
Schlüsselwörter
Wachkoma, apallisches Syndrom, Rehabilitation, Angehörige, soziale Arbeit, Langzeitversorgung, stationäre Einrichtungen, Ethik, Bewusstseinsförderung, Ganzheitlichkeit, Konzepte, aktivierende Dauerpflege, Schädel-Hirn-Verletzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Wachkoma-Patienten und deren Angehörige
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit der komplexen Situation von Wachkoma-Patienten und ihren Angehörigen. Sie untersucht die medizinischen, rehabilitativen, ethischen und sozialarbeiterischen Aspekte und beleuchtet insbesondere die Rolle der Sozialen Arbeit in der Versorgung dieser Patientengruppe, mit besonderem Fokus auf die Herausforderungen der Langzeitversorgung und die Notwendigkeit angepasster Konzepte in stationären Einrichtungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das apallische Syndrom und seine medizinischen Aspekte, Rehabilitationsmöglichkeiten und -strategien für Wachkoma-Patienten, die psychosoziale Belastung der Angehörigen und deren Unterstützung, ethische Fragestellungen im Umgang mit Wachkoma-Patienten, sowie die Rolle der Sozialen Arbeit in der stationären Langzeitversorgung. Es werden verschiedene Phasen der Rehabilitation, von der Intensivversorgung bis zur Langzeitbetreuung, sowie die Bedeutung einer ganzheitlichen, individuell angepassten Rehabilitation beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Das apallische Syndrom (Entstehung, Symptome, Heilungschancen), Die Rehabilitation des Wachkoma-Patienten (Intensivversorgung, Frührehabilitation, Bewusstseinsförderung, Wiedereingliederung, Langzeitversorgung), Die Mitwirkung der Angehörigen (Beziehungsaufbau, Belastungen, Entlastung), Ethische Aspekte im Umgang mit Wachkoma-Patienten (Biomedizinisches Denkmodell, Menschenwürde, Ethik der Achtsamkeit), Soziale Arbeit mit Wachkoma-Patienten und deren Angehörigen in stationären Einrichtungen (Ganzheitlichkeit, psychosoziale Beratung, Angehörigenarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Diensten), Konzeptionelle Überlegungen im stationären Umgang mit Wachkoma-Patienten (Konzepte, Notwendigkeit, Entwicklung, Betreuungsmöglichkeiten in verschiedenen Einrichtungen), Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die komplexe Situation von Wachkoma-Patienten und ihren Angehörigen umfassend darzustellen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Versorgung dieser Patientengruppe zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen der Langzeitversorgung und der Notwendigkeit angepasster Konzepte in stationären Einrichtungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wachkoma, apallisches Syndrom, Rehabilitation, Angehörige, soziale Arbeit, Langzeitversorgung, stationäre Einrichtungen, Ethik, Bewusstseinsförderung, Ganzheitlichkeit, Konzepte, aktivierende Dauerpflege, Schädel-Hirn-Verletzung.
Wie wird die Rolle der Sozialen Arbeit dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit in der Versorgung von Wachkoma-Patienten und ihren Angehörigen, ausgehend vom Prinzip der Ganzheitlichkeit. Sie beschreibt die psychosoziale Beratung, die Angehörigenarbeit und die Zusammenarbeit mit anderen Diensten. Die Bedeutung einer ganzheitlichen, klientenzentrierten Herangehensweise wird hervorgehoben.
Welche ethischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit diskutiert ethische Dilemmata im Umgang mit Wachkoma-Patienten. Sie beleuchtet die Gefahren eines rein biomedizinischen Denkansatzes und betont die Bedeutung der Wahrung der Menschenwürde. Die „Ethik der Achtsamkeit“ wird als Orientierungshilfe für Sozialarbeiter vorgestellt.
Wie wird die Situation der Angehörigen beleuchtet?
Die Arbeit betrachtet die herausfordernde Situation der Angehörigen von Wachkoma-Patienten. Sie behandelt den Aufbau von Beziehungen und Kommunikation, die psychischen Belastungen der Angehörigen sowie Möglichkeiten zur Entlastung und Unterstützung. Die Bedeutung der sozialen Einbindung und des Informationsaustauschs wird unterstrichen.
Welche Konzepte zur Langzeitversorgung werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert konzeptionelle Überlegungen zur Langzeitversorgung von Wachkoma-Patienten in stationären Einrichtungen. Sie analysiert verschiedene Konzepte und deren praktische Umsetzung, beleuchtet die Notwendigkeit individueller Betreuung und Begleitung und vergleicht verschiedene Ansätze zur Pflege und Begleitung apallischer Bewohner.
- Quote paper
- Thomas Zarfl (Author), 2004, Gefangen im eigenen Körper - Der Wachkoma-Patient in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34714