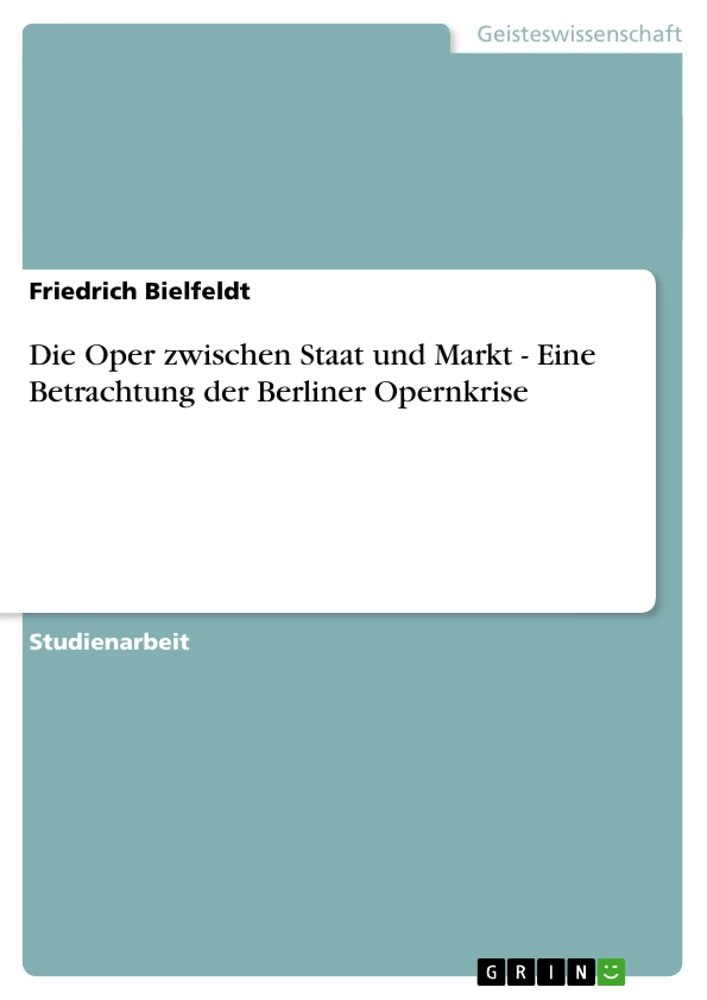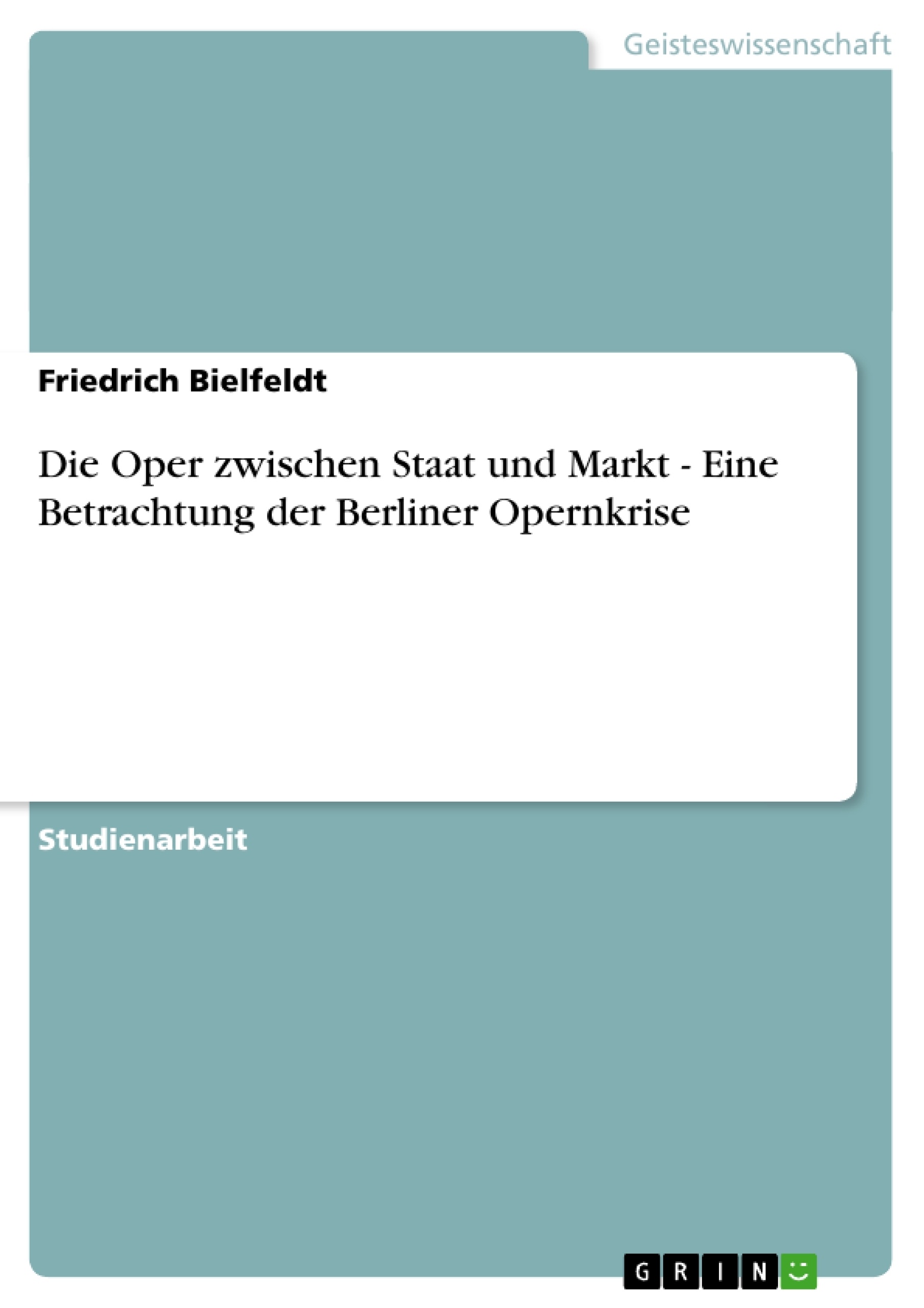Immer häufiger wird in der Öffentlichkeit über das Problem der Finanzierung von
Opernbetrieben, die hier stellvertretend für alle staatlich subventionierten
Kulturbetriebe gesetzt werden (Theater, Orchester, Museen etc.), diskutiert. Die sehr
hohen Subventionen für Opernhäuser, die bei der Hamburgischen Staatsoper
beispielsweise € 76.- je Platz und Abend betragen, verleiten viele Politiker in
Deutschland dazu, über den (Un-)Sinn der Kultursubventionierung zu lamentieren,
gerade in der Zeit knapper öffentlicher Kassen. Sehr zum Unmut der Hamburgischen
Staatstheater wurde in den Jahren 1998 bis 2001 der Hamburger Kultusetat von
1,2% auf 0,9% des Hamburger Landeshaushaltes abgesenkt1, was sich als erstes in
der Qualität und im Umfang der Spielpläne niederschlagen dürfte, ohne dass über
die daraus entstehenden Finanzierungsprobleme für die Theater ansatzweise
diskutiert wurde. Ebenso mangelt es heute an neuen Finanzierungskonzepten,
welche die Hamburger Kulturszene stabilisieren und handlungsfähiger machen
könnte. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass der Kultusetat von 1950 bis
1992 kontinuierlich auf das Niveau von 1,2% angewachsen ist, ausgehend von 0,4%
(1950)2. Am offenkundigsten wird das Finanzierungsproblem derzeit in Berlin, auf
das hier später noch genauer eingegangen wird. Immerhin wurde in Berlin durch die
rechtliche und finanzielle Neustrukturierung des Berliner Philharmonischen
Orchesters zumindest ein Schritt in eine neue und richtige Richtung getan, indem
das Orchester weithin in eine private Stiftung überführt wurde; ein Schritt aus dem
man lernen könnte für künftige Umstrukturierungen im kulturellen Bereich. Dass dies
jedoch nicht heißen darf, man könne sämtliche Opern, Orchester und Theater
privatisieren und sich selbst überlassen, muss den verantwortlichen Politikern dabei
ebenfalls klar werden, da der Markt allein die Kultur nicht erhalten kann, ebenso wie
die Bildung, das Gesundheitswesen oder die Altersvorsorge nicht rein über den
Markt finanziert werden können. [...]
1 Aus: http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/finanzbehoerde/haushalt/haushalt-2002/finanzbericht-
2002,property=source.pdf, Stand 04.05. 2003. Insgesamt sind dies ca. 40,2 Mio. € nur für die Staatsoper in 2002.
2 Ebd.; mittlerweile hat der neue Senat die Kulturausgaben auf 2,0% des Gesamthaushaltes in 2002 aufgestockt,
was umgerechnet 193,6 Mio. € entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Die Problematik der Opernhäuser
- Die Kultur und der Markt
- Die Finanzen der Opernhäuser
- Der „Opernmarkt“
- Theaterformen am Markt
- Kooperativ betriebene Theater
- Profitorientierte Theater
- Staatlich subventionierte Theater
- Die Frage der Kultursubventionen
- Warum Subventionen?
- „Positive externe Effekte“
- Umwegrentabilität als zusätzlicher positiver Effekt
- Schwächen der Argumentation
- „Die Berliner Opernkrise“
- Die strukturellen Probleme der Berliner Opernhäuser
- Das Konzept zur Sanierung der Berliner Opernlandschaft
- Ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Finanzierung von Opernhäusern und analysiert die Problematik der staatlichen Subventionierung im Kultursektor. Sie untersucht die ökonomischen Aspekte der Kultur und des Kunstmarktes, insbesondere im Kontext der Oper.
- Finanzierungsprobleme von Opernhäusern
- Ökonomische Analyse des Kunstmarktes
- Relevanz von Kultursubventionen
- „Berliner Opernkrise“ als Beispiel für strukturelle Herausforderungen
- Alternative Finanzierungsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Finanzierungsprobleme von Opernhäusern und zeigt auf, warum die hohen Subventionen für viele Politiker in Deutschland ein Problem darstellen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Ökonomie der Kultur und des Kunstmarktes, wobei insbesondere die Finanzen der Opernhäuser und die Funktionsweise des „Opernmarktes“ analysiert werden. In Kapitel 3 wird die Frage der Kultursubventionen diskutiert, wobei die Argumentation für und gegen Subventionen erläutert wird. Abschließend analysiert Kapitel 4 die „Berliner Opernkrise“ als Beispiel für die strukturellen Probleme, die Opernhäusern im heutigen Kontext begegnen.
Schlüsselwörter
Oper, Kulturökonomie, Kunstmarkt, Kultursubventionen, „positive externe Effekte“, Umwegrentabilität, „Berliner Opernkrise“, Finanzierungsprobleme, staatliche Subventionen, alternative Finanzierungsmodelle.
- Arbeit zitieren
- Friedrich Bielfeldt (Autor:in), 2003, Die Oper zwischen Staat und Markt - Eine Betrachtung der Berliner Opernkrise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35093