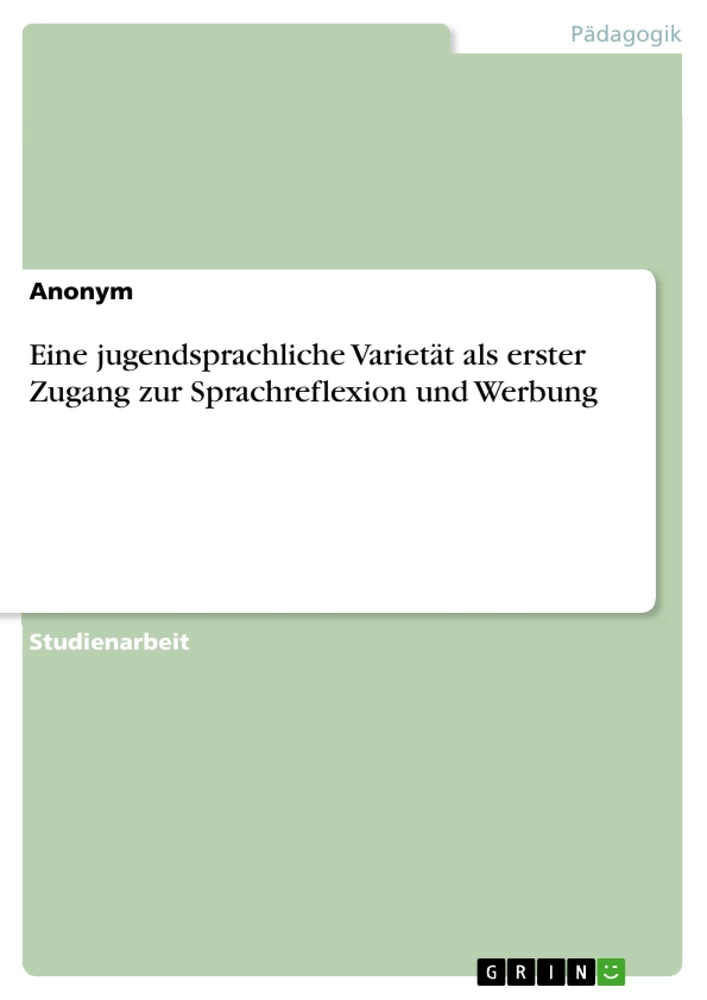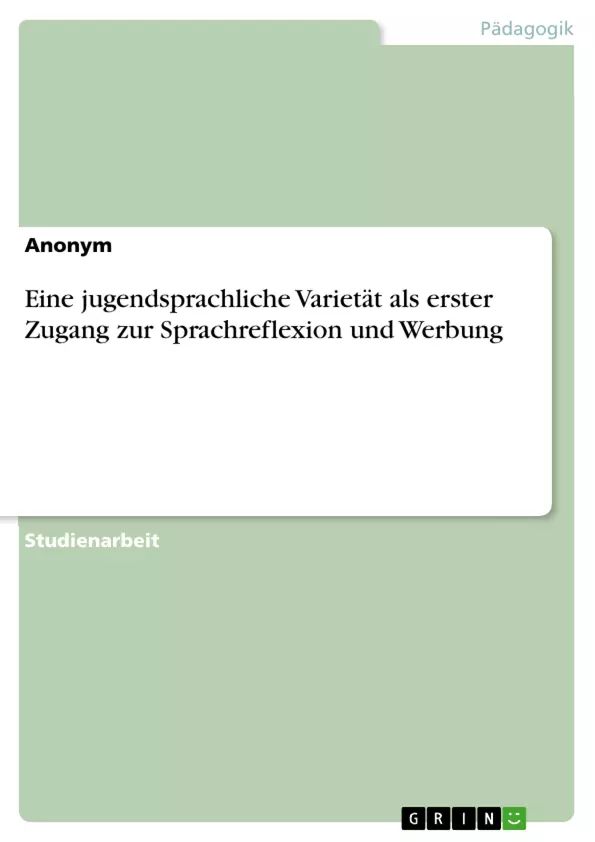Das Ziel dieser Hausarbeit ist es zu zeigen wie die jugendsprachliche Varietät Kiezdeutsch im Unterricht thematisiert werden kann, um den Schülerinnen und Schülern (SuS) einen ersten Zugang zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache zu liefern.
Als Hinführung dazu wird zunächst ein Überblick über die Bedeutung und die Bestandteile von Kultur und Interkulturalität gegeben. Der Begriff der Interkulturalität subsumiert dabei weitere Aspekte wie die interkulturelle Kommunikation oder die interkulturellen Einflüsse in Deutschland. Im Zuge dessen wird die jugendsprachliche Varietät Kiezdeutsch mit ihren Merkmalen fokussiert. Im weiteren Verlauf werden die Eigenschaften interkultureller Werbung thematisiert und aus fachdidaktischer Perspektive beleuchtet.
Die Analyse eines exemplarischen Werbespots eröffnet darauffolgend die interkulturellen Einflüsse in deutscher TV- Werbung.
Am Ende der Hausarbeit zeigt eine ausführliche Unterrichtsstunde, in der der analysierte Werbespot im Fokus steht, eine Möglichkeit diese jugendsprachliche Varietät mit den SuS zu behandeln und für die Sprachreflexion zu nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Kulturbegriff
- 3. Interkulturalität
- 3.1 Interkulturelle Kommunikation
- 3.2 Interkulturelle Einflüsse in Deutschland
- 3.2.1 Eine jugendsprachliche Varietät - das Kiezdeutsch
- 3.2.2 Merkmale des Phänomens Kiezdeutsch
- 3.3 Interkulturelle Werbung
- 3.4 Interkulturelle Werbung aus fachdidaktischer Perspektive
- 3.4.1 Voraussetzungen der Schülerschaft
- 3.4.2 Werbung als Medium zur Sprachreflexion
- 3.5 Interkulturelle Werbung im Unterricht
- 3.5.1 Betrachtung der Werbemaßnahme von EDEKA in Hinblick auf die jugendsprachliche Varietät und den interkulturellen Einfluss
- 3.5.2 Darstellung einer Unterrichtsstunde
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Möglichkeiten der jugendsprachlichen Varietät „Kiezdeutsch“ im Deutschunterricht. Ziel ist es, Schülern einen ersten Zugang zur kritischen Auseinandersetzung mit Sprache zu ermöglichen. Die Arbeit erörtert die Bedeutung von Kultur und Interkulturalität, wobei der Fokus auf interkulturelle Kommunikation und deren Einfluss in Deutschland liegt. Dabei wird die jugendsprachliche Varietät „Kiezdeutsch“ und ihre Merkmale näher betrachtet.
- Die Relevanz von Kultur und Interkulturalität für den Deutschunterricht
- Die Rolle von „Kiezdeutsch“ als jugendsprachliche Varietät
- Die Nutzung von Werbung zur Sprachreflexion
- Interkulturelle Werbung und ihre didaktischen Möglichkeiten
- Ein Beispiel für eine Unterrichtsstunde, die „Kiezdeutsch“ und interkulturelle Werbung integriert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Herausforderungen des Deutschunterrichts in heterogenen Schulklassen, insbesondere in großstädtischen Regionen mit vielfältigen Sprachstilen. Das Ziel der Arbeit ist die Verwendung von „Kiezdeutsch“ im Unterricht, um Schülern einen ersten Zugang zur Sprachreflexion zu ermöglichen.
Kapitel 2 erläutert den vielschichtigen Kulturbegriff und seine verschiedenen Perspektiven. Kultur wird als Produkt kreativer Arbeit, als Lebensart einer bestimmten Gruppe und als Gesamtheit materieller, sozialer und ideeller Schöpfungen beschrieben. Die Sprache wird als Hauptbestandteil einer Kultur hervorgehoben.
Kapitel 3 widmet sich dem Begriff der Interkulturalität. Interkulturelle Kommunikation wird als Dialog zwischen Mitgliedern verschiedener Kulturen definiert, wobei Unterschiede in der Sprache und im nonverbalen Verhalten zu Missverständnissen führen können.
Kapitel 3.1 fokussiert auf die interkulturelle Kommunikation und erläutert, wie verschiedene Kulturkreise durch Sprache und nonverbale Kommunikation interagieren.
Kapitel 3.2 beleuchtet interkulturelle Einflüsse in Deutschland, insbesondere die jugendsprachliche Varietät „Kiezdeutsch“ und ihre Merkmale.
Kapitel 3.3 behandelt die Eigenschaften interkultureller Werbung und deren Bedeutung für die Sprachreflexion im Unterricht.
Kapitel 3.4 diskutiert die Voraussetzungen der Schülerschaft und die Rolle der Werbung als Medium zur Sprachreflexion im interkulturellen Kontext.
Kapitel 3.5 stellt eine Unterrichtsstunde vor, die einen Werbespot unter dem Aspekt der jugendsprachlichen Varietät und des interkulturellen Einflusses analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Hausarbeit sind Kultur, Interkulturalität, Sprachreflexion, „Kiezdeutsch“ als jugendsprachliche Varietät, interkulturelle Kommunikation und Werbung als Medium zur Sprachreflexion im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Kiezdeutsch“?
Kiezdeutsch ist eine jugendsprachliche Varietät, die in urbanen Räumen mit hoher sprachlicher Vielfalt entsteht und besondere grammatische Merkmale aufweist.
Wie kann Kiezdeutsch im Unterricht genutzt werden?
Es dient als erster Zugang zur Sprachreflexion, indem Schüler Unterschiede zwischen Alltagssprache, Jugendsprache und Standardsprache kritisch hinterfragen.
Was versteht man unter interkultureller Werbung?
Werbung, die gezielt kulturelle Einflüsse, verschiedene Sprachen oder Lebensstile aufgreift, um eine diverse Zielgruppe anzusprechen.
Welches Beispiel für Werbung wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert eine Werbemaßnahme von EDEKA im Hinblick auf jugendsprachliche Einflüsse und Interkulturalität.
Warum ist Sprachreflexion für Schüler wichtig?
Sie fördert das Verständnis für den Aufbau der deutschen Grammatik und sensibilisiert für die Wirkung von Sprache in verschiedenen sozialen Kontexten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Eine jugendsprachliche Varietät als erster Zugang zur Sprachreflexion und Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350948