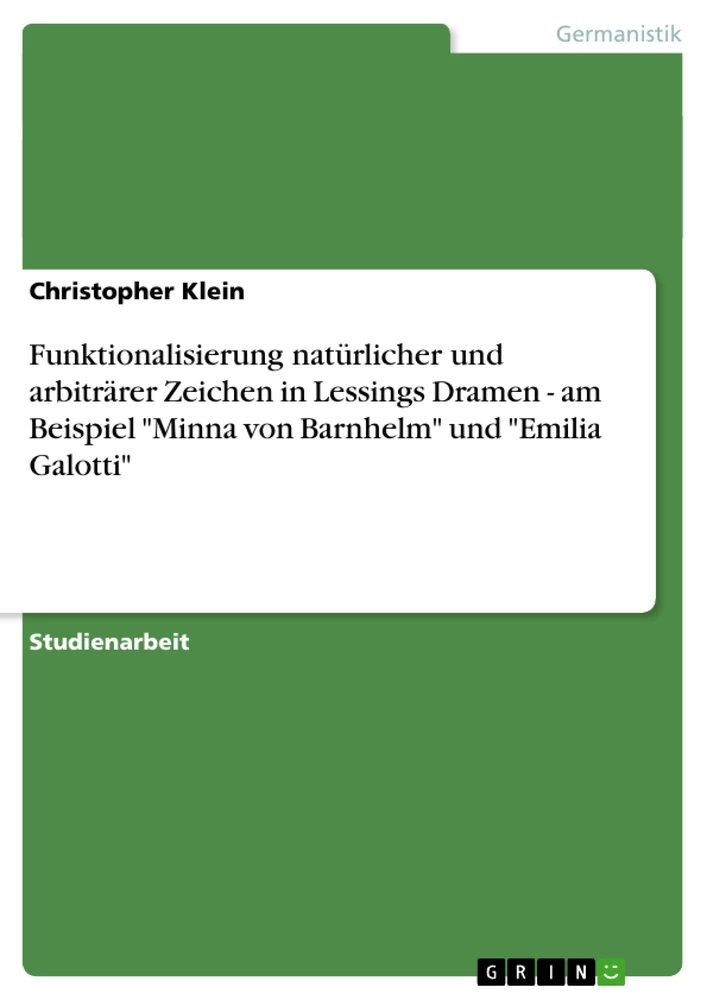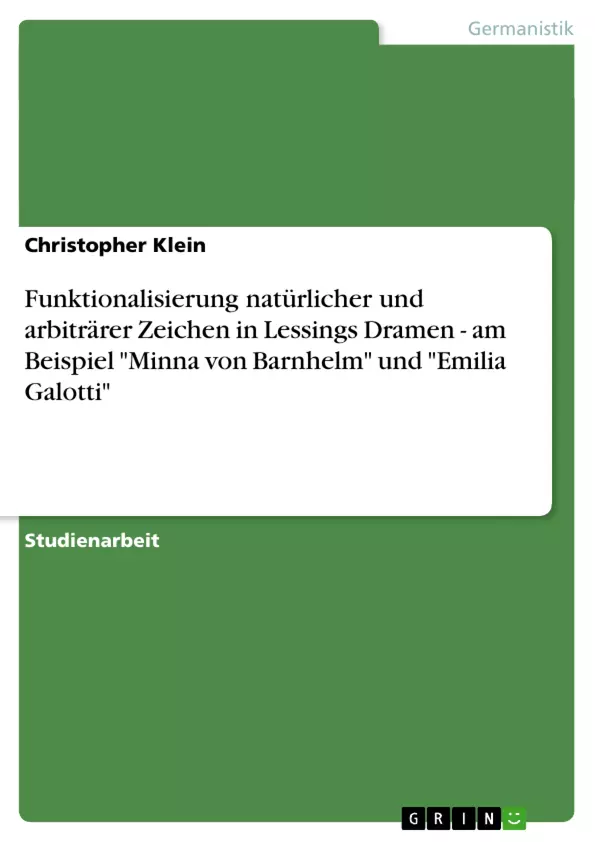Der Verlauf und die Anordnung der Arbeit richtet sich zunächst an einer theoretischen Betrachtung von Zeichen aus, wobei zum einen generell die Veränderung in der Auffassung sprachlicher Transparenz über die Epochen im Zentrum steht. Lessings Reflexionen bezüglich der Zeichen soll daraufhin dazu ins Verhältnis gesetzt werden, um zu sehen, in welcher Weise Lessing sich theoretisch von den Theoremen seiner Epoche ausgrenzt, bzw. in dieser zu verorten ist. Am Ende des ersten Teils wird dann die spezifische Zeichenauffassung Lessings in Bezug zur Gattung Drama gesetzt und es muss an dieser Stelle untersucht werden, in welcher Weise das Theater für ihn einen Ort darstellt, an dem die vorher herausgearbeiteten zeichentheoretischen Ansätze fruchtbar werden können und wie er zu diesem Behelf vorgeht. In den darauffolgenden Teilen werden dann Minna von Barnhelm und Emilia Galotti unter den vorher dargestellten Prämissen besprochen. An Lessing lässt sich eine Rehabilitation der Rhetorik im Ausgang des 18. Jahrhunderts zeigen, deren Ausläufer bis in die Moderne reichen. Dieses läuft aber den klassischen Untersuchungen nicht zuwider, sondern es untermauert sie vielmehr, indem sie die Bildersprache als Sprache der Affekte einsetzt, was in direkter Relation zu Lessings Mitleidstheorie steht. Es ist die Vielschichtigkeit und Tiefe Lessings Werk, das eine unermüdliche literaturwissenschaftliche Betrachtung seines Schaffens aus vielen verschiedenen Blickwinkeln ermöglicht. Und nicht zu letzt wird damit ebenfalls im Sinne Lessings gehandelt, denn das Suchen nach Wahrheitsmöglichkeiten in den Dramen spiegelt die Läuterungsintention von ihm wieder, mit der Darstellung einer guten Geschichte das Publikum dazu anzuhalten, wahr zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Natürliche und willkürliche Zeichen
- Im Wandel vom Zeitalter der Ähnlichkeit zum âge classique
- Neudefinierung der Zeichen im Laokoon
- Zeichen mit doppeltem Charakter
- Der uneigentliche Ausdruck ist das Eigentliche
- Theater und Geste
- Minna von Barnhelm
- Innere Handlungsbedingung und Affektkontrolle
- Geld und Wertediskurs
- Der Barnhelmsche Diskurs oder wie Minna das Denken generiert und Tellheim durch La Mancha reitet
- Emilia Galotti - Wenn Worte Dinge Berühren
- Höfische Referenz
- Wie Worte töten können – bürgerliche Sprachtransparenz
- Vorausdeutende Metaphern - Performanz der Sprache
- Natürliche und willkürliche Zeichen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Funktionalisierung natürlicher und arbiträrer Zeichen in Lessings Dramen am Beispiel von "Minna von Barnhelm" und "Emilia Galotti". Ziel ist es, Lessings Einsatz von Zeichen im Kontext seiner theoretischen Ausführungen im "Laokoon" zu analysieren und die Auswirkungen auf die Stücke sowie die Wirkungsästhetik zu untersuchen.
- Die Veränderungen in der Auffassung sprachlicher Transparenz über die Epochen hinweg
- Lessings spezifische Zeichenauffassung in Bezug auf die Gattung Drama
- Der Einfluss von Metaphern und Geste auf die Darstellung von Affekten und das Schaffen von Wahrheitspotenzial
- Die Verbindung zwischen Lessings Rhetorik und seiner Mitleidstheorie
- Die unterschiedlichen Handlungsbedingungen in Komödie und Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Lessings Dramen in den Kontext der literaturwissenschaftlichen Forschung. Sie erläutert die Relevanz der zeichentheoretischen Analyse und die Bedeutung von Lessings "Laokoon" für die Lessingforschung.
- Natürliche und willkürliche Zeichen: Dieses Kapitel beschreibt die klassische Definition natürlicher und willkürlicher Zeichen und beleuchtet den Wandel in der Auffassung von sprachlicher Transparenz über die Zeit. Der Fokus liegt auf Lessings "Laokoon" und seiner theoretischen Abgrenzung von den Ansätzen seiner Epoche.
- Minna von Barnhelm: Dieses Kapitel untersucht Lessings "Minna von Barnhelm" im Hinblick auf die Verwendung von Zeichen. Die Analyse umfasst die innere Handlungsbedingung und die Affektkontrolle, den Wertediskurs und die Funktion des Barnhelmschen Diskurses für die Generierung von Denken und Handlung.
- Emilia Galotti - Wenn Worte Dinge Berühren: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Lessings "Emilia Galotti" und analysiert die Verwendung von Zeichen in Bezug auf höfische Referenz, die Macht von Worten und die performative Funktion der Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Zeichentheorie, Dramenanalyse, Lessing, "Laokoon", "Minna von Barnhelm", "Emilia Galotti", natürliche und arbiträre Zeichen, Metaphern, Geste, Mitleidstheorie, sprachliche Transparenz, Wirkungsästhetik, Rhetorik, Affekte, Handlungsbedingungen, Komödie, Tragödie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Dramen von Lessing werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von "Minna von Barnhelm" und "Emilia Galotti" unter zeichentheoretischen Aspekten.
Welche Rolle spielt Lessings Werk "Laokoon" in der Analyse?
Im "Laokoon" definiert Lessing seine spezifische Auffassung von natürlichen und willkürlichen Zeichen neu, was als theoretische Grundlage für die Untersuchung der Dramen dient.
Was wird unter der "Funktionalisierung von Zeichen" verstanden?
Es geht darum, wie Lessing sprachliche Mittel, Gesten und Metaphern einsetzt, um Affekte darzustellen und die Wirkungsästhetik im Theater zu steuern.
Wie hängen Rhetorik und Mitleidstheorie zusammen?
Die Bildersprache wird als Sprache der Affekte eingesetzt, was in direktem Bezug zu Lessings Theorie des Mitleids steht, um beim Publikum eine emotionale Reaktion hervorzurufen.
Was ist das Ziel der zeichentheoretischen Betrachtung?
Ziel ist es, zu zeigen, wie das Theater für Lessing ein Ort ist, an dem zeichentheoretische Ansätze fruchtbar werden, um Wahrheitsmöglichkeiten und Handlungsmaximen zu vermitteln.
- Quote paper
- Christopher Klein (Author), 2004, Funktionalisierung natürlicher und arbiträrer Zeichen in Lessings Dramen - am Beispiel "Minna von Barnhelm" und "Emilia Galotti", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35161