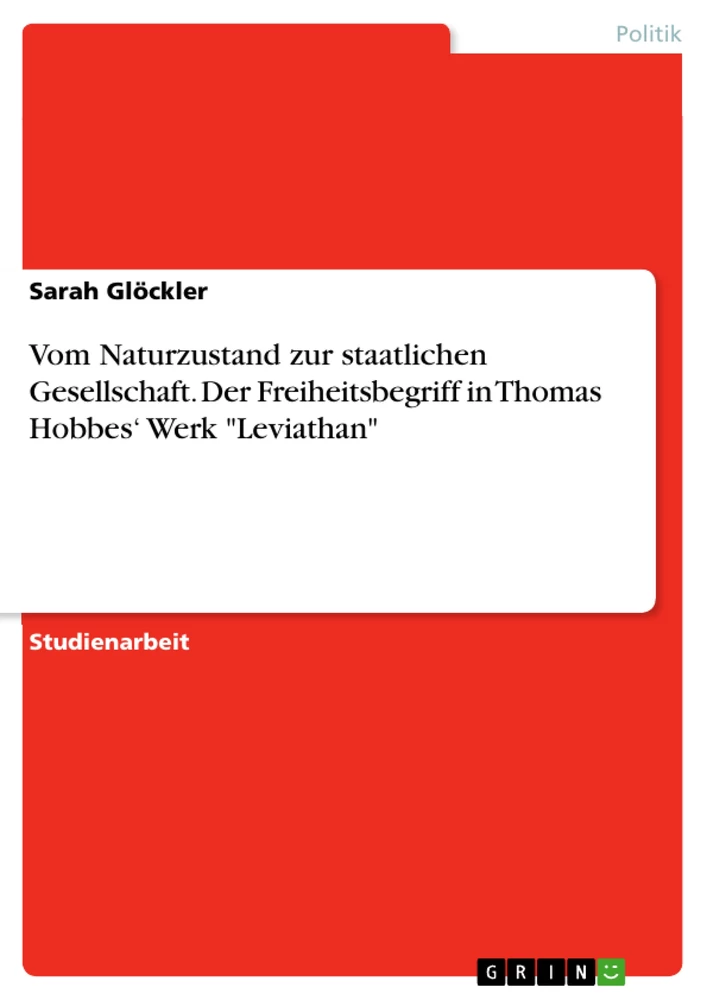In dieser Arbeit wird der Begriff der Freiheit nach Thomas Hobbs im Hinblick auf Naturzustand und dessen Entwicklung zur staatlichen Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt. Zunächst soll der Naturzustand betrachtet und unter dem Aspekt des Naturrechts sowie der natürlichen Gesetze erläutert werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Übergang vom Naturzustand hin zur staatlichen Gesellschaft. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf dem Gesellschaftsvertrag und der Rolle des Souveräns gelegt. Der dritte und letzte Teil – die Freiheit der Untertanen – gliedert sich in die Punkte Recht und Gesetz, die jeweils getrennt betrachtet werden. Von großer Bedeutung sind hier die bürgerlichen Gesetze sowie das die Freiheit im „Schweigen der Gesetze.“
Mit seinem im Jahre 1651 erschienen Werk Leviathan schafft Thomas Hobbes die Grundlage einer modernen, neuzeitlichen Staatsphilosophie und den Beginn der Kontraktualismus-Ära. Er gilt als Erster, der das Individuum in den Fokus seiner politischen Theorie rückt, was ihn zum „radikale[n] Denker der Moderne“ macht. Hobbes versteht die Gesellschaft (oder, was bei Hobbes synonym ist, der Staat) als die Gesamtheit der vielen einzelnen Menschen, aus denen sie besteht. Um das Funktionieren der Gesellschaft sicherzustellen, muss der Mensch als Einzelner in seinem Wesen, seiner Natur und seinen Antrieben vollständig begriffen werden. Diese Erkenntnisse über den Menschen fungieren als Ausgangspunkt für Hobbes‘ politische Überlegungen, aus denen schließlich der optimale Staat resultieren soll. Die Anerkennung des Individuums als Ausgangspunkt für die Gesellschaft und den Staat gilt als „der Motor aller modernen Entwicklungen von Recht und Staat“. Eine entscheidende Rolle für diese Entwicklung spielt hier vor allem der Aspekt der Freiheit des Individuums, was Hobbes zum „Wegbereiter des modernen Freiheitsbegriffs“ macht.
Aus diesem Grund widmet sich die vorliegende Arbeit dem Verständnis von Freiheit, das Thomas Hobbes in seinem Werk Leviathan zum Ausdruck bringt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Bedeutungswandel des Freiheitsbegriffs herauszuarbeiten und zu untersuchen, inwieweit der Mensch als Bürger seine Freiheit verliert bzw. gewinnt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I Einleitung.
- II 1. Der Naturzustand
- 1.1 Das Naturrecht..
- 1.2 Die natürlichen Gesetze..
- 2 Der Übergang vom Naturzustand zum Staat.
- 2.1 Der Gesellschaftsvertrag
- 2.2 Die Rolle des Souveräns.
- 3 Die Freiheit der Untertanen.
- 3.1 Gesetz.
- 3.1.1 Die bürgerlichen Gesetze
- 3.2 Recht..
- 3.2.1 Die Freiheit im Schweigen der Gesetze
- 3.1 Gesetz.
- III Schluss...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit analysiert den Freiheitsbegriff in Thomas Hobbes‘ Leviathan. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Wandel des Freiheitsbegriffs von der natürlichen Freiheit im Naturzustand zur bürgerlichen Freiheit innerhalb der staatlichen Gesellschaft zu untersuchen.
- Der Naturzustand und seine Eigenschaften
- Das Naturrecht und die natürlichen Gesetze
- Der Gesellschaftsvertrag und die Rolle des Souveräns
- Die Freiheit der Untertanen im Kontext von Recht und Gesetz
- Die Rolle des Individuums in der staatlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet den Naturzustand, in dem der Mensch von staatlichen Gesetzen unabhängig ist und über ein Naturrecht verfügt, das ihm die Freiheit zur Selbsterhaltung gewährt. Dieses Kapitel behandelt auch die natürlichen Gesetze, die im Naturzustand als Orientierungshilfe dienen.
Im zweiten Kapitel wird der Übergang vom Naturzustand zur staatlichen Gesellschaft durch den Gesellschaftsvertrag analysiert. Hierbei wird die Rolle des Souveräns und seine Macht im Rahmen des Staates beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die Freiheit der Untertanen im Kontext von Gesetz und Recht. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die bürgerlichen Gesetze und die Freiheit im "Schweigen der Gesetze" gelegt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf den Freiheitsbegriff in Thomas Hobbes‘ Leviathan und untersucht dessen Wandel im Kontext des Naturzustands, des Gesellschaftsvertrags und der staatlichen Gesellschaft. Wichtige Schlüsselwörter sind: Naturzustand, Naturrecht, natürliche Gesetze, Gesellschaftsvertrag, Souverän, bürgerliche Freiheit, Recht, Gesetz, individueller Wille, Selbsterhaltung.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Thomas Hobbes den „Naturzustand“?
Der Naturzustand ist ein hypothetischer Zustand ohne staatliche Gewalt, geprägt durch den „Krieg aller gegen alle“, in dem der Mensch absolute, aber unsichere Freiheit besitzt.
Was ist der Gesellschaftsvertrag im „Leviathan“?
Ein Vertrag, bei dem Individuen ihre Rechte und Freiheit auf einen Souverän übertragen, um im Gegenzug Schutz, Frieden und Ordnung zu erhalten.
Was bedeutet „Freiheit im Schweigen der Gesetze“?
Untertanen genießen Freiheit in allen Bereichen, die der Souverän nicht ausdrücklich durch bürgerliche Gesetze geregelt hat.
Warum gilt Hobbes als Wegbereiter des modernen Freiheitsbegriffs?
Weil er das Individuum und dessen Drang zur Selbsterhaltung ins Zentrum seiner politischen Theorie rückt und Freiheit als Abwesenheit von äußeren Hindernissen definiert.
Verliert der Mensch im Staat seine gesamte Freiheit?
Er verliert die schrankenlose natürliche Freiheit, gewinnt aber bürgerliche Freiheit und Sicherheit unter dem Schutz des Gesetzes.
- Quote paper
- Sarah Glöckler (Author), 2015, Vom Naturzustand zur staatlichen Gesellschaft. Der Freiheitsbegriff in Thomas Hobbes‘ Werk "Leviathan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353574