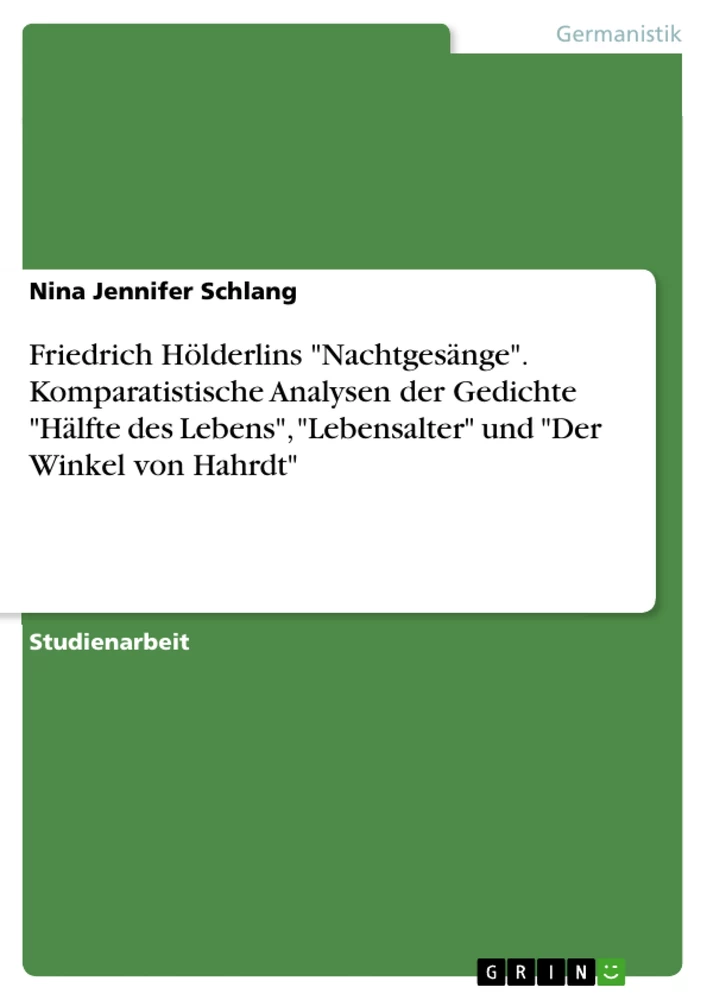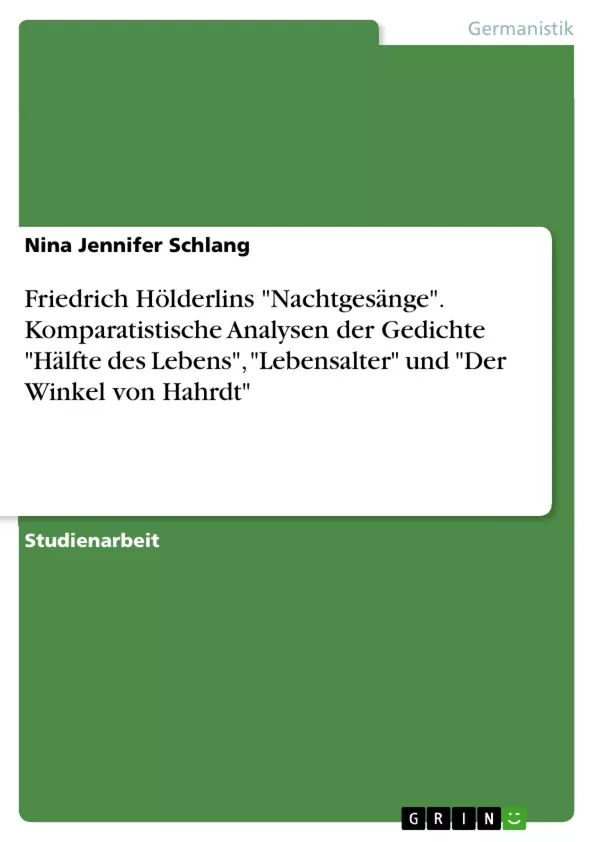In dieser Arbeit setzt sich die Autorin mit den „Nachtgesängen“ von Friedrich Hölderlin auseinander und analysiert seine Gedichte „Hälfte des Lebens“, „Lebensalter“ und „Der Winkel von Hahrdt“ mit besonderem Blick auf die verwendeten Naturmotive.
Johann Christian Friedrich Hölderlin ist einer der angesehensten deutschen Schriftsteller aller Zeiten. Sein Roman „Hyperion“ sowie sein unvollendeter Roman „Der Tod des Empedokles“ zählen bis heute zu seinen wichtigsten Werken. Doch Hölderlin ist nicht nur für seine Romane, sondern auch für die zahlreichen von ihm verfassten Gedichte bekannt. Auffallend bei seinen Gedichten ist das häufige Vorkommen der Natur, welcher Hölderlin eine sehr große Bedeutung zukommen lässt.
Die um 1803 von ihm verfassten „Nachtgesänge“ umfassen neun Gedichte, von denen sechs ein Versmaß aufweisen und die restlichen drei aus freien Rhythmen bestehen. Es wird vermutet, dass diese an seine tragische Geliebte Susette Gontard gerichtet sind und er womöglich mit ihnen versucht hat, ihren Verlust zu verarbeiten und seine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Auch das folgende Zitat Hölderlins kann auf seinen seelischen Zustand nach diesem Verlust und seine psychische Erkrankung hinweisen. „Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen, Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen, April und Mai und Junius sind ferne, Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!“
Auffallend ist, wie Hölderlin mit der Natur und den Jahreszeiten spielt. In dem Zitat schreibt er, dass April, Mai und Juni vergangen sind und er nun nicht mehr gerne lebt. Die drei von ihm genannten Monate stehen für die von Leben erfüllten Jahreszeiten Frühling und Sommer, welche die Sinnbilder für Wärme und Freude sind. Nachdem diese vergangen sind, kommen die Jahreszeiten Herbst und Winter, in denen die Wärme der Kälte weicht und der Tod Einzug hält. Doch nicht nur die Jahreszeiten können als ein Zyklus beschrieben werden, sondern auch Hölderlins „Nachtgesänge“ selbst weisen bei genauerer Betrachtung einen solchen auf.
Zu Hölderlins Zeiten wurden seine „Nachtgesänge“ oft als unverständlich angesehen und erhielten schlechte Kritiken. Heute ist dies jedoch nicht mehr der Fall, sowohl Hölderlin als auch seine Werke sind wichtige Bestandteile der deutschen Literaturgeschichte.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Friedrich Hölderlin – Lebenslauf
- Nachtgesänge
- Nachtgesänge Allgemein
- Nachtgesänge- Form
- Georg Philipp Friedrich von Hardenberg - Novalis
- Edward Young
- Hälfte des Lebens
- Gedicht
- Hälfte des Lebens - Inhalt
- Lebensalter
- Gedicht
- Lebensalter – Inhalt
- Der Winkel von Hahrdt
- Gedicht
- Der Winkel von Hahrdt – Inhalt
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die „Nachtgesänge“ von Friedrich Hölderlin mit dem Ziel, die Gedichte „Hälfte des Lebens“, „Lebensalter“ und „Der Winkel von Hahrdt“ eingehend zu analysieren. Dabei werden die poetischen Besonderheiten der Werke, ihre Entstehungszeit sowie die biographischen Einflüsse Hölderlins auf seine Dichtung beleuchtet.
- Das Verhältnis von Natur und Mensch in Hölderlins „Nachtgesängen“
- Die Rolle der Liebe und des Verlustes in Hölderlins Werk
- Die Gestaltung von Zeit und Erinnerung in den Gedichten
- Der Einfluss von Klassik und Romantik auf Hölderlins poetische Sprache
- Die Bedeutung von Form und Rhythmus in den „Nachtgesängen“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Besonderheiten von Hölderlins „Nachtgesängen“ und skizziert den Forschungsstand. Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über das Leben Friedrich Hölderlins und stellt die wichtigsten Stationen seiner Biografie dar. Das dritte Kapitel widmet sich den „Nachtgesängen“ als Ganzes, analysiert ihre Form und ihren Kontext und untersucht die Einflüsse von Novalis und Edward Young. Die Kapitel 4, 5 und 6 befassen sich mit den Einzelanalysen der Gedichte „Hälfte des Lebens“, „Lebensalter“ und „Der Winkel von Hahrdt“.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Friedrich Hölderlin, „Nachtgesänge“, Romantik, Klassik, Lyrik, Natur, Liebe, Verlust, Zeit, Erinnerung, Form, Rhythmus, Gedichtanalyse, Biographie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Nachtgesänge" von Friedrich Hölderlin?
Die um 1803 verfassten Nachtgesänge sind eine Gruppe von neun Gedichten, in denen Hölderlin unter anderem den Verlust seiner Geliebten Susette Gontard verarbeitet.
Welche Gedichte werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die drei Gedichte „Hälfte des Lebens“, „Lebensalter“ und „Der Winkel von Hahrdt“.
Welche Rolle spielt die Natur in Hölderlins Lyrik?
Die Natur ist ein zentrales Motiv. Hölderlin nutzt Jahreszeiten wie Herbst und Winter oft als Sinnbilder für Kälte, Trauer und den Übergang zum Tod.
Welche literarischen Einflüsse sind in den Nachtgesängen erkennbar?
Die Arbeit untersucht Einflüsse von Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg) und dem englischen Dichter Edward Young.
Wie wurden die Nachtgesänge zu Hölderlins Lebzeiten aufgenommen?
Damals wurden sie oft als unverständlich kritisiert. Heute gelten sie als Meisterwerke und wichtige Bestandteile der deutschen Literaturgeschichte.
Was ist das Besondere an der Form der Nachtgesänge?
Sechs der Gedichte weisen ein festes Versmaß auf, während die übrigen drei in freien Rhythmen verfasst sind.
- Quote paper
- Nina Jennifer Schlang (Author), 2017, Friedrich Hölderlins "Nachtgesänge". Komparatistische Analysen der Gedichte "Hälfte des Lebens", "Lebensalter" und "Der Winkel von Hahrdt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353930