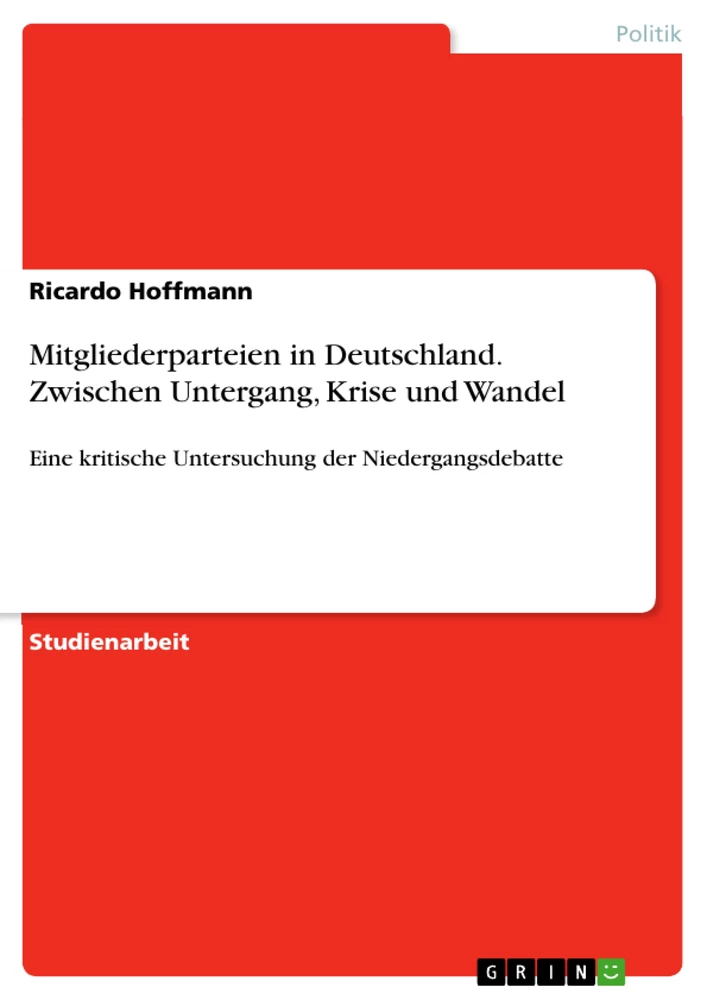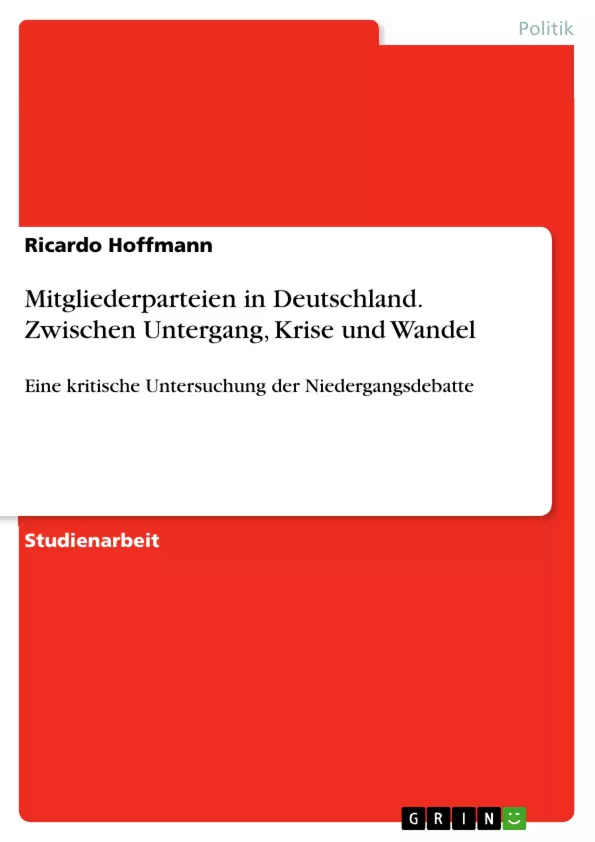Frank Niebuhr spricht Parteimitgliedern eine große Bedeutung für die Parteiarbeit zu, indem er sie unter anderem als den „Ideenmotor einer Partei“ und weitergehend als „Multiplikatoren vor Ort“ betitelt. Diese Ansicht des derzeitigen Beauftragten für Mitglieder- und Bürgerbetreuung der CDU-Bundespartei kann allerdings stark in Kontrast zu der allgemein in Öffentlichkeit und Wissenschaft kontrovers diskutierten These vom Niedergang der politischen Mitgliederparteien in der Bundesrepublik Deutschland gesehen werden. Die häufig angeführten Argumente für die Diagnose eines Niedergangs der Mitgliederparteien reichen von dem zu beobachtenden quantitativen Mitgliederschwund, über den Attraktivitäts-verlust von Parteien und einer subjektiv wahrgenommenen Politik- und Parteienverdrossenheit der Bevölkerung, hin zu einem insgesamt zu konstatierenden Spannungsfeld zwischen Mitglieder- und Wählerorientierung der Parteien.
Damit einhergehend gilt es zu überprüfen, ob und inwieweit die oft angeführte Behauptung eines Bedeutungsverlustes der Mitglieder beobachtet werden kann und welche Entwicklungs- bzw. Wandlungstendenzen zu erwarten sind. Ist das sogenannte „goldene Zeitalter der Mitgliederparteien“ wirklich vorüber? Hat die Niedergangsdiskussion im zeithistorischen Kontext ihre Berechtigung? Können Parteien überhaupt ohne ihre Mitglieder auskommen? – Diese Fragen gilt es im Rahmen nachfolgender Arbeitshypothese zu beurteilen:
Trotz eines fortdauernd zu beobachtenden Mitgliederschwundes seit der Hochphase der Parteimitgliedschaften in den 1950er / 1960er Jahren gibt es zahlreiche Gründe, die gegen einen Bedeutungsverlust der Mitgliederparteien im Allgemeinen sprechen, jedoch einen Wandel bzw. Erweiterung des Typus der Mitgliederpartei konstatieren.
Ausgangspunkt dieser Hausarbeit stellt demnach der Typus der Mitgliederpartei dar, dessen Merkmale in Kapitel 2 kurz charakterisiert werden. In Kapitel 3 wird der den Parteien vorgeworfene Attraktivitätsverlust inkl. seiner Anreizschwächen problematisiert. Im darauf folgenden Kapitel 4 wird die Frage gestellt, ob die Parteien ihre Mitglieder überhaupt noch brauchen. Dieser Frage anschließend wird Kapitel 5 einen kurzen Ausblick über mögliche Alternativen zum Typus der Mitgliederparteien darlegen. Im Schlussteil (Kapitel 6) wird die Frage nach Wandel oder Krise der Mitgliederparteien beantwortet und die zuvor analysierten Aspekte zu einem Fazit gebündelt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale des Typus der Mitgliederparteien
- Der Begriff der Mitgliederparteien: Ein Annäherungsversuch
- Der Typus der Mitgliederpartei nach Wiesendahl
- Der Attraktivitätsverlust von Parteien: Ausgangspunkt und Hintergründe
- Die Ausgangslage: Erosion der sozialen Milieus und Organisationsunlust
- Gesellschaftliche Veränderungen als Ursache für den Attraktivitätsverlust
- Die Anreizschwäche der Parteien
- Brauchen Parteien ihre Mitglieder überhaupt noch?
- Exkursion: Alternative Parteitypen zum Typus der Mitgliederpartei
- Die Electoral-Professional-Party nach Panebianco (1988)
- Die Kartellpartei nach Katz / Mair (1995)
- Die Medienkommunikationspartei nach Jun (2004)
- Die Hauptcharakteristika der alternativen Parteitypen – eine Zusammenfassung
- Krise oder doch nur Wandel? - Neue Erkenntnisse, Fazit und Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich kritisch mit der Debatte um den vermeintlichen Niedergang der Mitgliederparteien in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen für den beobachteten Mitgliederschwund und den Attraktivitätsverlust von Parteien. Darüber hinaus werden alternative Parteitypen vorgestellt und die Frage geklärt, ob Parteien ihre Mitglieder überhaupt noch brauchen. Schließlich werden die Ergebnisse zusammengefasst und Zukunftsaussichten für den Typus der Mitgliederpartei aufgezeigt.
- Der Wandel des Typus der Mitgliederparteien
- Ursachen für den Attraktivitätsverlust von Parteien
- Die Rolle von Mitgliedern in modernen Parteien
- Alternative Parteitypen
- Zukunftsaussichten für Mitgliederparteien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Mitgliederschwundes und die kontroverse Diskussion um den Niedergang der Mitgliederparteien in Deutschland vor. Kapitel 2 analysiert die Merkmale des Typus der Mitgliederpartei, wobei der Begriff der Mitgliederpartei definiert und die Charakteristika nach Wiesendahl vorgestellt werden. Kapitel 3 untersucht die Ursachen für den Attraktivitätsverlust von Parteien, wie z.B. die Erosion der sozialen Milieus, gesellschaftliche Veränderungen und die Anreizschwäche der Parteien. Kapitel 4 stellt die Frage, ob Parteien ihre Mitglieder überhaupt noch brauchen. In Kapitel 5 werden alternative Parteitypen vorgestellt, wie z.B. die Electoral-Professional-Party, die Kartellpartei und die Medienkommunikationspartei. Das abschließende Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Zukunftsaussichten für Mitgliederparteien.
Schlüsselwörter
Mitgliederparteien, Parteienentwicklung, Attraktivitätsverlust, Anreizschwäche, alternative Parteitypen, Wandel, Niedergangsdebatte.
Häufig gestellte Fragen
Befinden sich politische Parteien in Deutschland im Niedergang?
Die Arbeit untersucht die These vom Niedergang der Mitgliederparteien kritisch und prüft, ob es sich eher um einen Wandel als um eine Krise handelt.
Was sind die Gründe für den Mitgliederschwund?
Als Ursachen werden die Erosion sozialer Milieus, gesellschaftliche Veränderungen und eine generelle Anreizschwäche der Parteien genannt.
Welche alternativen Parteitypen gibt es zur Mitgliederpartei?
Vorgestellt werden unter anderem die Electoral-Professional-Party, die Kartellpartei und die Medienkommunikationspartei.
Welche Bedeutung haben Mitglieder heute noch für Parteien?
Mitglieder fungieren weiterhin als Ideenmotoren und Multiplikatoren vor Ort, auch wenn sich ihre Rolle im modernen Parteiensystem wandelt.
Was ist das "goldene Zeitalter" der Mitgliederparteien?
Damit wird die Hochphase der Parteimitgliedschaften in den 1950er und 1960er Jahren bezeichnet.
- Quote paper
- Ricardo Hoffmann (Author), 2015, Mitgliederparteien in Deutschland. Zwischen Untergang, Krise und Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354608