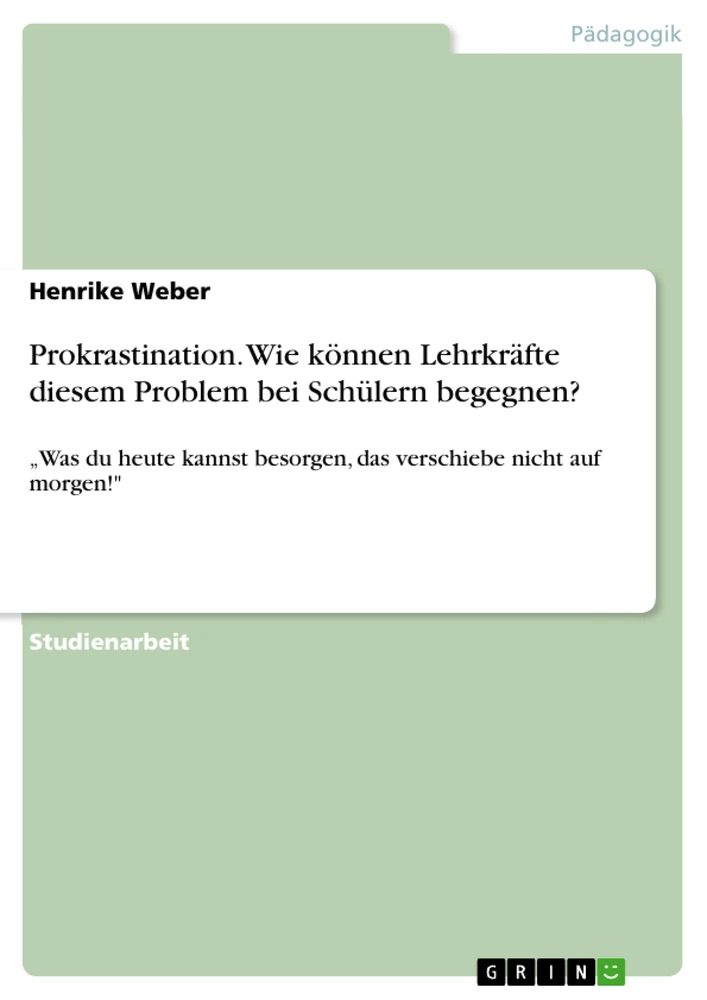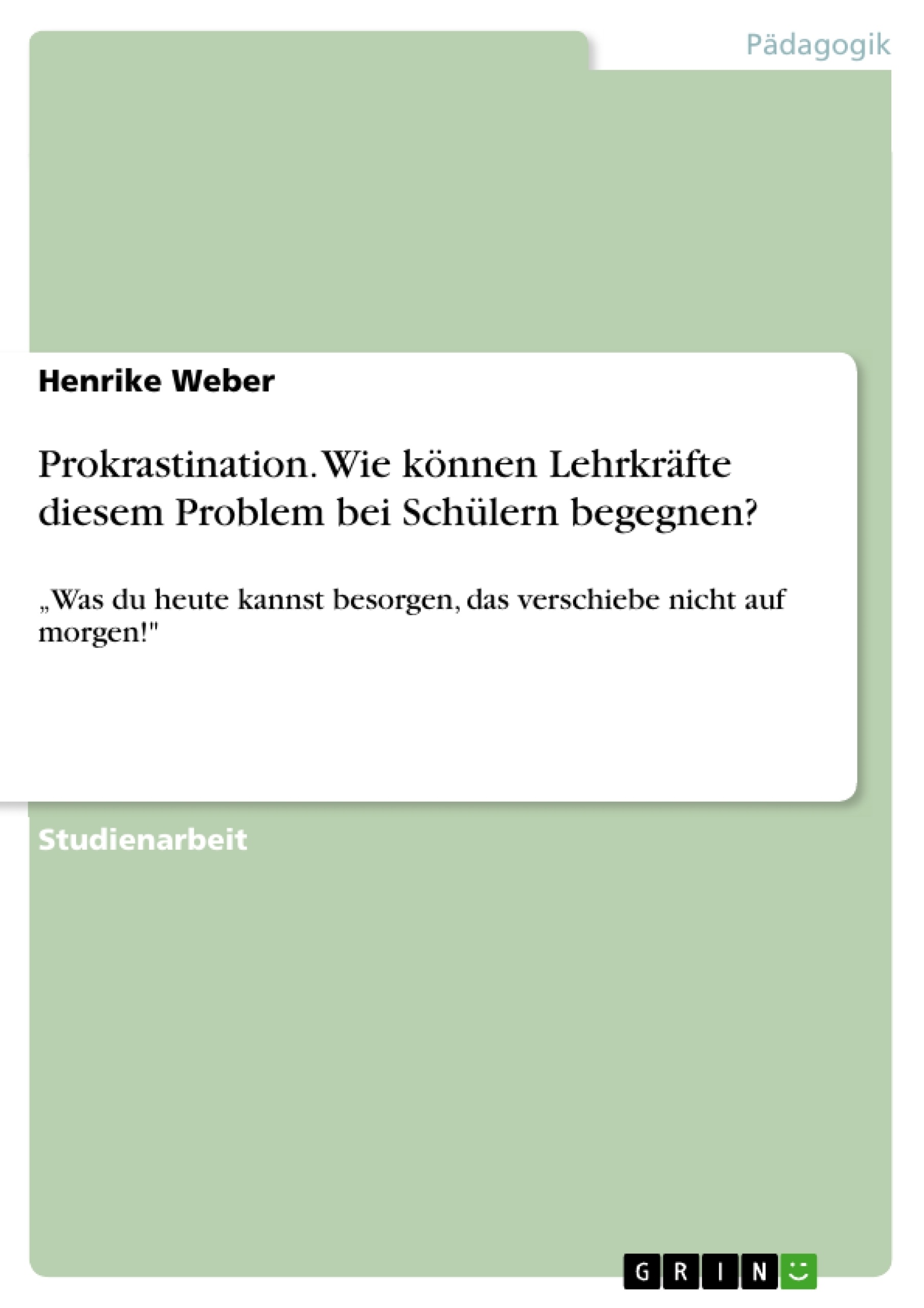Gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, in der es neue Medien, Arbeitsverdichtung und eine starke Bürokratisierung gibt, haben die Menschen viel zu erledigen. Die gesellschaftlichen Erwartungen an den Einzelnen sind hoch, Schnelllebigkeit und Stress kommen hinzu. Die Ausgewogenheit zwischen Freizeit und Verpflichtung kann problematisch sein. Denn bei alledem gilt: Wer fleißig sein Programm erledigt, kann es weit bringen. Wer hingegen ein Ventil sucht, dem Leistungsdruck widersteht und zu Erledigendes vor sich herschiebt, der läuft Gefahr auf der Strecke zu bleiben. Warum werden manche Dinge gern verschoben und nicht sofort erledigt? Was sind die Ursachen dafür? Was sind die Auswirkungen des Verschiebens? Was kann gegen „Verschieberitis“ getan werden? Wie können Lehrkräfte diesem Problem bei Schülern begegnen? Auf diese Fragen soll in den folgenden Kapiteln eingegangen werden.
Das Wort Prokrastination, was so viel wie „Aufschieberitis“ bedeutet, kommt vom Lateinischen procrastinatio = ‚Vertagung‘. Procrastinatio setzt sich aus pro =‚für‘ und cras =‚morgen‘ zusammen. Arbeitssblockade, Aufschieben, Erregungsaufschiebung oder Handlungsaufschub: Dies alles sind Synonyme für ein Verhalten, das notwendige, aber als unangenehm empfundene Arbeiten zu verschieben, anstatt sie zu erledigen. Aufschieben gilt als schlechte Gewohnheit. Drei Kriterien zeichnen ein Verhalten als Prokrastination aus: Kontraproduktivität, mangelnde Notwendigkeit und Verzögerung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wortherkunft und Definition
- Ausgangssituation und Vorstellung des Themas
- Geschichte
- Relevanz des Themas
- ,,Aufschiebertypen“
- Der Erregungsaufschieber
- Der Vermeidungsaufschieber
- Zusammenhänge des Aufschiebens
- Auswirkungen des Aufschiebens
- Bekämpfungsmethoden
- Alltagshilfe
- Behandlungsbedürftigkeit
- Pädagogische Aspekte
- Wie können Eltern von Anfang an vorbeugen?
- Wie können Lehrer Einfluss nehmen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beschäftigt sich mit dem Phänomen der Prokrastination, auch bekannt als „Aufschieberitis". Er beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen dieses Verhaltens, analysiert verschiedene „Aufschiebertypen" und untersucht die Relevanz des Themas in pädagogischen Kontexten. Dabei werden sowohl alltägliche Beispiele als auch wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt.
- Definition und Geschichte der Prokrastination
- Ursachen und Motivationen für das Aufschieben
- Auswirkungen von Prokrastination auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit
- Strategien zur Bekämpfung von Prokrastination
- Pädagogische Implikationen und Handlungsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Das erste Kapitel befasst sich mit der Wortherkunft und Definition von Prokrastination. Es wird die historische Entwicklung des Phänomens beleuchtet und die Relevanz des Themas für verschiedene Lebensbereiche, insbesondere im pädagogischen Kontext, betont.
,,Aufschiebertypen“
Dieses Kapitel beschreibt zwei verschiedene „Aufschiebertypen“: den Erregungsaufschieber und den Vermeidungsaufschieber. Es werden die psychologischen Hintergründe und Motivationen für das Aufschieben bei beiden Typen erläutert.
Zusammenhänge des Aufschiebens
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Faktoren, die mit dem Aufschieben verbunden sind. Es werden Themen wie Perfektionismus, Überforderung, Ablenkung und die eigene Einschätzung der Fähigkeiten erörtert.
Auswirkungen des Aufschiebens
In diesem Kapitel werden die Folgen von Prokrastination untersucht. Dabei geht es um die Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit, und das soziale Umfeld.
Bekämpfungsmethoden
Das Kapitel beleuchtet verschiedene Strategien zur Bewältigung von Prokrastination. Es werden sowohl Alltagstipps als auch medizinische Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt.
Pädagogische Aspekte
Dieses Kapitel widmet sich den pädagogischen Implikationen des Themas. Es wird erörtert, wie Eltern und Lehrer Prokrastination bei Kindern und Jugendlichen vorbeugen können.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieses Textes sind: Prokrastination, Aufschieberitis, Aufschieben, Erregungsaufschieber, Vermeidungsaufschieber, Selbststeuerung, Leistungsdruck, Stress, Zeitmanagement, Motivation, Wohlbefinden, pädagogische Aspekte, Eltern, Lehrer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Definition von Prokrastination?
Prokrastination (Aufschieberitis) ist das Ersetzen notwendiger, aber als unangenehm empfundener Arbeiten durch Ersatzhandlungen. Sie ist durch Kontraproduktivität und unnötige Verzögerung gekennzeichnet.
Was ist ein Erregungsaufschieber?
Dieser Typ benötigt den Zeitdruck kurz vor einer Deadline als Motivationskick, um überhaupt mit der Arbeit zu beginnen.
Was charakterisiert einen Vermeidungsaufschieber?
Hier steht die Angst vor Versagen oder negativer Bewertung im Vordergrund. Die Arbeit wird aufgeschoben, um die Konfrontation mit den eigenen Fähigkeiten zu vermeiden.
Wie können Lehrer Schülern bei Prokrastination helfen?
Durch klare Strukturierung von Aufgaben, das Setzen von Zwischenzielen und die Förderung von Zeitmanagement-Kompetenzen können Pädagogen präventiv wirken.
Welche Rolle spielt Perfektionismus beim Aufschieben?
Übersteigerte Erwartungen an das eigene Ergebnis führen oft dazu, dass man aus Angst, dem Standard nicht zu entsprechen, gar nicht erst mit der Aufgabe beginnt.
- Quote paper
- Henrike Weber (Author), 2015, Prokrastination. Wie können Lehrkräfte diesem Problem bei Schülern begegnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354937