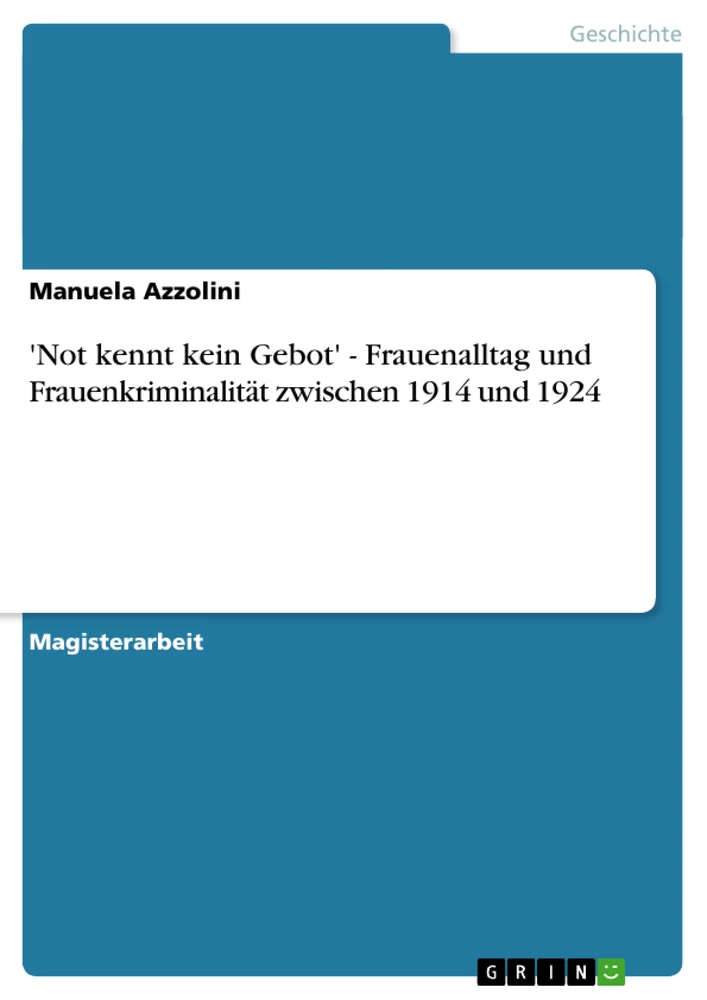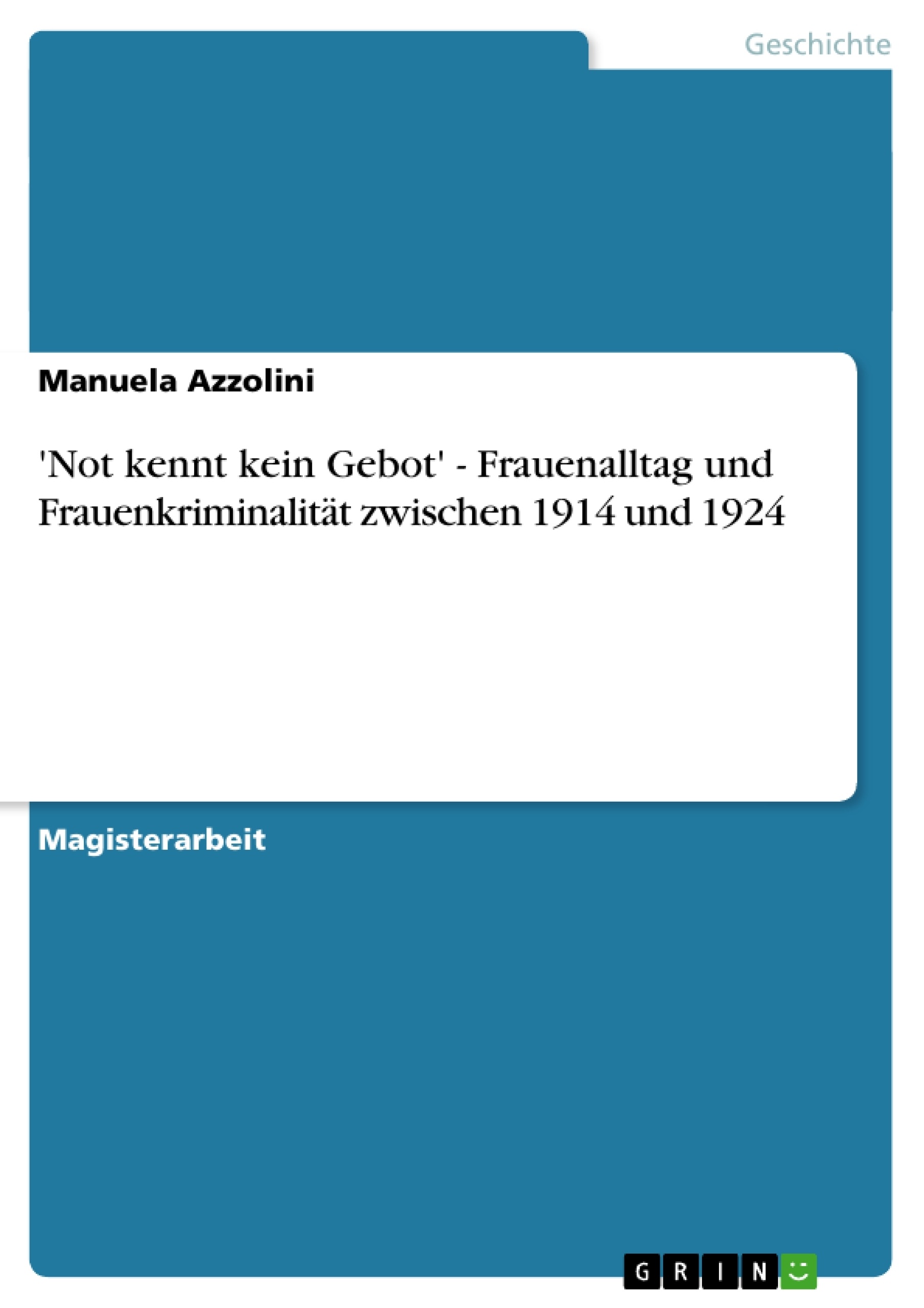Zu Recht werden die Jahre 1914-1924 als „unruhiges Jahrzehnt“2
bezeichnet. Die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Ereignisse wurden von anfänglicher Euphorie begleitet, welche durch Hunger, Not, Teuerung und Mangel bald in Verzweiflung, Friedenssehnsucht und Radikalität umschlug. In der Folge kam es immer öfter zu Protesten, Unruhen, Streiks und Krawallen. Die Revolution beendete zwar das deutsche Kaiserreich und den Krieg, doch das Elend der Bevölkerung wurde durch die Jahre der nun folgenden Inflation eher noch verschärft, und erst Ende 1923, mit der Einführung der Rentenmark und dem Übergang in die Stabilisierungsphase, trat eine Besserung ein. Einen Aspekt dieser Unruhen stellte die Frauenkriminalität dar. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde eine ungewöhnliche Zunahme der Frauenkriminalität, insbesondere der Eigentumsdelikte, konstatiert. Diese Zunahme verlief bis zum Ende der Hyperinflation 1923 zwar ungleichmäßig, aber doch auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Krieg. Die zeitgenössischen Erklärungen und Reaktionen waren sehr unterschiedlich und auch widersprüchlich - aber einig war man sich darin, dass dieser Zustand eine moralische Gefahr für das deutsche Volk sei. Schließlich sei die Frau „als Hausfrau und Mutter“ in ihrer „Stellung innerhalb der sozialen Ordnung so wichtig, dass sie als asozial handelndes Subjekt höchste Beachtung verdient“.3[...]
2 Scholz, Robert, Ein unruhiges Jahrzehnt: Lebensmittelunruhen, Massenstreiks und Arbeitslosenkrawalle in Berlin 1914-1923, in: Gailus (Hg.), Pöbelexzesse und Volkstumulte in Berlin. Zur Sozialgeschichte der Straße (1830-1980), Berlin 1984, S. 79-123. Karin Hartewig betont statt dessen mehr die Unberechenbarkeit der Zeit als Ursache für die Unruhen und bezeichnet die Jahre daher als „unberechenbares Jahrzehnt“: Hartewig, Karin, Das unberechenbare Jahrzehnt. Bergarbeiter und ihre Familien im Ruhrgebiet 1914-1924, München 1993. Letztendlich haben beide Bezeichnungen ihre Berechtigung und Gültigkeit.
3 Bayrisches Statistisches Landesamt (Hg.), 50 Jahre Frauenkriminalität 1882-1932, bearb. von Josef Krug, München 1937, S. 3. Dass diese Sichtweise bis heute Aktualität behalten hat, zeigen: Andriessen, Margo/Japenga, Caren, Die großen Männer der Kriminologie und ihr Frauenbild, in: MschrKrim 68 (1985), S. 313-325; Lamott, Franziska, Der Risikofaktor >Frau<. Kriminalprävention und Mütterlichkeit, in: MschrKrim 68 (1985), S. 325-339.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Strukturfaktoren der Frauenexistenz 1914-1924
- 1.1. Vom Ausbruch des 1. Weltkrieges bis zur Stabilisierung
- 1.2. „Wann mag dieses Elend enden?“: Hunger, Teuerung und Not
- 1.2.1. Materielle Grundlagen: Kriegsunterstützung und Löhne
- 1.2.2. Rationierung und Teuerung der Nahrungsmittel
- 1.2.3. Wohnungsverhältnisse und Wohnungsnot
- 1.2.4. Gesundheitszustand und seelische Befindlichkeit
- 1.3. Frauenerwerbsarbeit
- 1.3.1. Die Entwicklung der Frauenerwerbsarbeit bis 1918
- 1.3.2. Die Rückkehr der Männer und die Demobilmachung der Frauen
- 2. Frauenkriminalität 1914-1924
- 2.1. Allgemeine Entwicklung der Kriminalität
- 2.2. Die Kriminalität nach Hauptdeliktgruppen
- 2.2.1. Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen
- 2.2.2. Diebstahl
- 2.2.3. Außerhalb der Reichskriminalstatistik: Die Übertretungen
- 2.3. Zeitgenössische Erklärungen für die Frauenkriminalität
- 2.3.1. Die Eigenart der Weibesnatur'. Biologistische Erklärungen
- 2.3.2. Vermännlichung' oder vermehrte Gelegenheit: Das Vordringen der Frauen in die Öffentlichkeit
- 2.4. Reaktionen auf die veränderte (Frauen-) Kriminalität
- 2.4.1. Rechtsprechung: Zwischen Sanktionierung und Bagatellisierung
- 2.4.2. Anzeigeverhalten der Bevölkerung
- 3. Alltag, Not und Kriminalität
- 3.1. Frauen und Recht: Zur Analyse der weiblichen Kriminalität
- 3.2. Zur ökonomischen Bedingtheit von Kriminalität
- 3.3. Kriminalität und Sozialer Protest
- 3.3.1. Zur spezifischen Ausprägung der weiblichen Protest- und illegalen Selbsthilfeaktionen 1914-1924
- 3.3.2. Kriminalisierung von Selbsthilfe und Protest
- 3.4. 'Not kennt kein Gebot' - Rechtsbewusstsein und Existenzlogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Lebensbedingungen von Frauen im Deutschen Reich zwischen 1914 und 1924 und untersucht den Zusammenhang zwischen Not und Kriminalität in dieser Zeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen des Krieges und der Nachkriegszeit die Kriminalität von Frauen beeinflusst haben.
- Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf den Alltag der Frauen
- Die Entwicklung der Frauenerwerbsarbeit und die Rückkehr der Männer in den Arbeitsmarkt
- Die Bedeutung der Not und der Armut für die Frauenkriminalität
- Die unterschiedlichen Erklärungen für die steigende Frauenkriminalität in der Zeit
- Die Reaktionen der Gesellschaft auf die veränderte Kriminalität der Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die strukturellen Faktoren, die die Lebensbedingungen von Frauen im Deutschen Reich zwischen 1914 und 1924 prägten. Dabei wird die Entwicklung der Kriegszeit, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, die Auswirkungen der Rationierung und der steigenden Preise sowie die Veränderungen in der Frauenerwerbsarbeit untersucht.
Kapitel 2 fokussiert auf die Entwicklung der Frauenkriminalität in dieser Zeit. Es analysiert die allgemeinen Kriminalitätsentwicklungen, untersucht die verschiedenen Deliktgruppen, insbesondere Verbrechen und Vergehen gegen das Vermögen, und betrachtet die zeitgenössischen Erklärungen für die steigende Kriminalität der Frauen.
Kapitel 3 betrachtet den Zusammenhang zwischen Alltag, Not und Kriminalität der Frauen. Es analysiert die ökonomischen Bedingungen von Kriminalität und untersucht, inwiefern die Kriminalität als Form des sozialen Protests verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Frauenalltag, Frauenkriminalität, Not, Armut, Rationierung, Teuerung, Frauenerwerbsarbeit, Sozialer Protest, Selbsthilfe, Rechtsbewusstsein, Existenzlogik, Erster Weltkrieg, Nachkriegszeit, Deutschland, 1914-1924.
Häufig gestellte Fragen
Warum stieg die Frauenkriminalität zwischen 1914 und 1924 massiv an?
Hauptursachen waren die extreme Not, Hunger und die Hyperinflation. Viele Frauen begingen Eigentumsdelikte wie Diebstahl, um das Überleben ihrer Familien während des Krieges und der Nachkriegszeit zu sichern.
Welche Delikte wurden von Frauen am häufigsten begangen?
Im Vordergrund standen Vermögensdelikte, insbesondere einfacher Diebstahl von Lebensmitteln oder Brennstoffen sowie Verstöße gegen Rationierungsvorschriften.
Wie veränderte der Erste Weltkrieg die Erwerbsarbeit von Frauen?
Da die Männer an der Front waren, drängten Frauen in bisher männlich dominierte Berufe (z.B. Rüstungsindustrie). Nach dem Krieg wurden sie jedoch oft wieder aus diesen Positionen verdrängt.
Was bedeutet der Ausspruch „Not kennt kein Gebot“ in diesem Kontext?
Er beschreibt das Rechtsbewusstsein vieler Frauen, für die das moralische Gebot, die Familie zu ernähren, schwerer wog als die staatlichen Gesetze gegen Diebstahl.
Wie reagierte die Justiz auf die weibliche Kriminalität?
Die Reaktionen schwankten zwischen harter Sanktionierung zur Aufrechterhaltung der Ordnung und einer gewissen Bagatellisierung, da man die verzweifelte Lage der „Hausfrauen und Mütter“ oft erkannte.
Kann man diese Kriminalität als sozialen Protest werten?
Ja, viele illegale Handlungen wie Lebensmittelunruhen oder organisierte Plünderungen waren eine Form des kollektiven Protests gegen die unzureichende Versorgungslage durch den Staat.
- Quote paper
- Manuela Azzolini (Author), 1998, 'Not kennt kein Gebot' - Frauenalltag und Frauenkriminalität zwischen 1914 und 1924, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35593