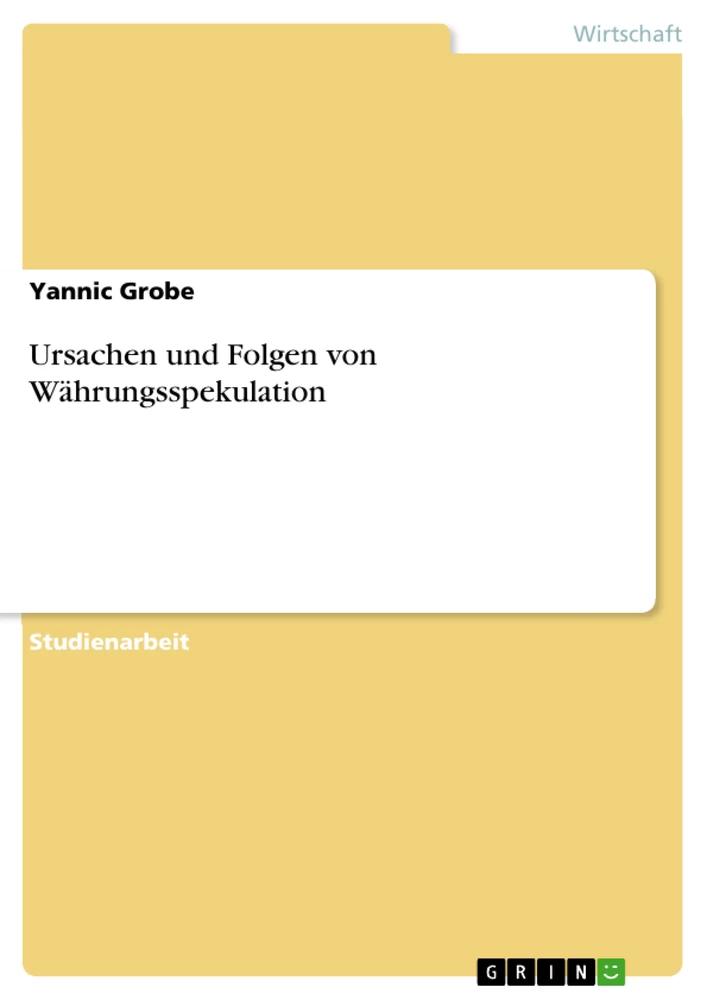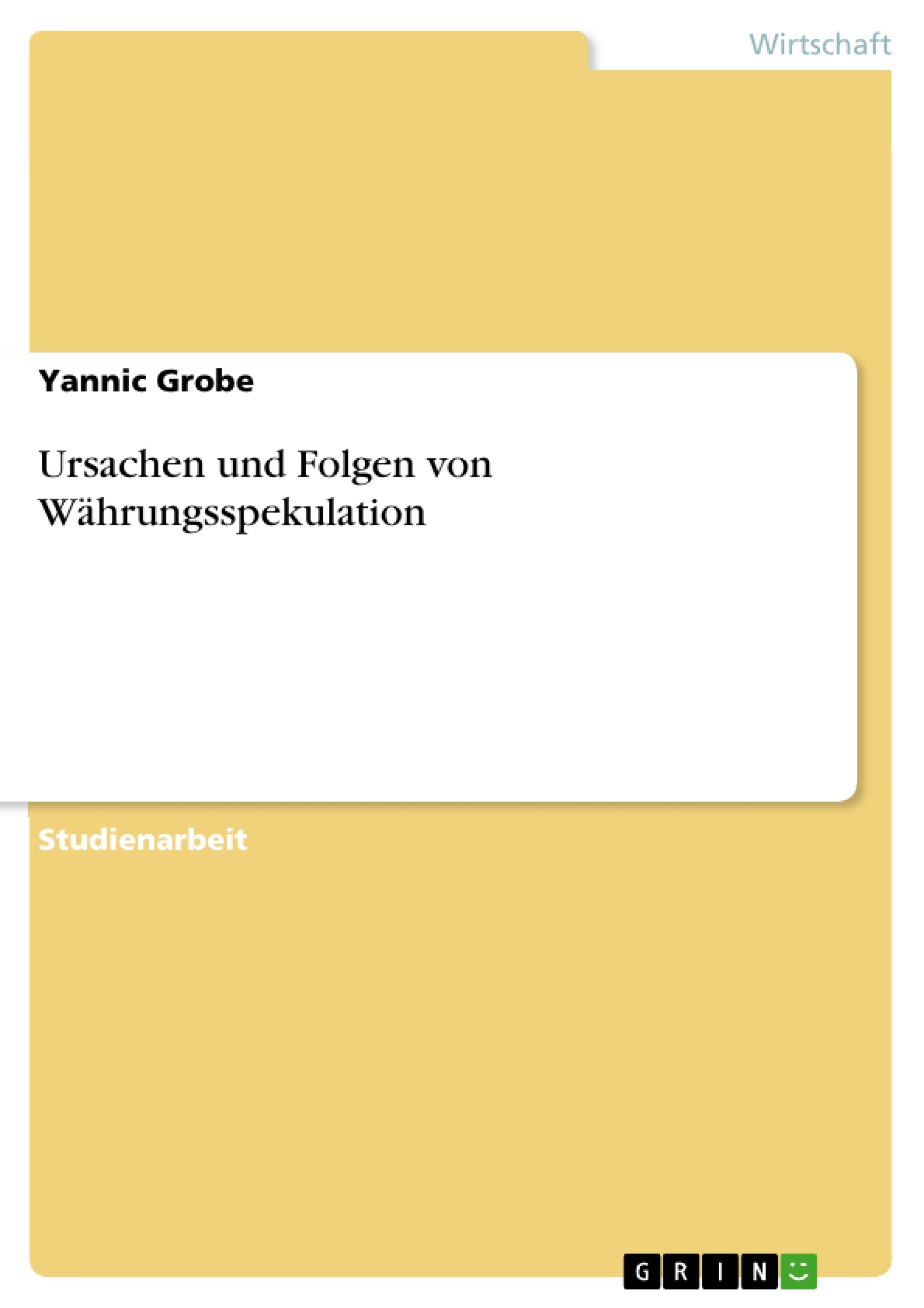Durch die fortwährende Globalisierung der Finanzmärkte haben Kapitalmarktteilnehmer die Möglichkeit, schnell, unkompliziert und kostengünstig ihr Kapital weltweit und jederzeit anzulegen oder sich gegen Risiken abzusichern. Das wird zudem durch die ständige Schaffung neuer und komplexer Derivate unterstützt, aber auch verkompliziert.
Derivate basieren auf der Spekulation, da man mit ihnen auf das Eintreten ungewisser Ereignisse in der Zukunft wettet und so Gewinne erzielen oder sich gegen Risiken absichern möchte. Diese Spekulation mit Derivaten gibt es natürlich auch auf dem Devisenmarkt. Gerade dort handeln viele verschiedene Marktteilnehmer, wie z.B. Unternehmen, Banken, Zentralbanken und Privatpersonen und nehmen Einfluss auf Wechselkurse. Durch diese spekulativen Einflussnahmen am Devisenmarkt kann es zu negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für ganze Volkswirtschaften kommen, welche das Land langfristig beeinflussen können.
Aus der erläuterten Problemstellung lassen sich die folgenden Zielsetzungen ableiten, welche die Ursachen und Folgen von Währungsspekulation verdeutlichen sollen:
1. Welchen Zweck verfolgen Kapitalmarktteilnehmer mit Währungsspekulation?
2. Welche Instrumente stehen den Spekulanten zur Verfügung?
3. Welche Folgen können Währungsspekulationen für Volkswirtschaften und deren Teilnehmern haben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzungen
- Vorgehensweise
- Definitorischer Teil und Grundlagen
- Währung
- Wechselkurs
- Devisen
- Devisenmarkt
- Währungsspekulation
- Ursachen und Instrumente der Währungsspekulation
- Gewinnerzielung am Devisenmarkt
- Devisenarbitrage
- Devisenspekulation
- Devisenkassageschäft
- Devisentermingeschäft
- Devisenswapgeschäft
- Devisenoptionsgeschäft
- Absicherung von Währungsrisiken durch Hedging
- Folgen von Währungsspekulation
- Stabilisierende und destabilisierende Währungsspekulation
- Mögliche Auswirkungen der Devisenspekulation auf Spekulanten
- Entstehung von Währungskrisen
- Entstehung von Spekulationsblasen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen von Währungsspekulation. Ziel ist es, den Zweck der Währungsspekulation für Kapitalmarktteilnehmer zu beleuchten, die verfügbaren Instrumente zu beschreiben und die möglichen Auswirkungen auf Volkswirtschaften und deren Teilnehmer zu analysieren.
- Zweck der Währungsspekulation für Kapitalmarktteilnehmer
- Instrumente der Währungsspekulation
- Auswirkungen von Währungsspekulationen auf Volkswirtschaften
- Einfluss von Währungsspekulation auf Wechselkurse
- Risiken und Chancen der Währungsspekulation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Währungsspekulation ein und beschreibt die Relevanz des Devisenmarktes als größten Finanzmarkt der Welt. Sie definiert die Problemstellung, die durch die Globalisierung der Finanzmärkte und die zunehmende Komplexität von Derivaten verstärkt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Folgen von Währungsspekulation zu erforschen und deren Auswirkungen auf Volkswirtschaften zu analysieren. Das Zitat von André Kostolany verdeutlicht das unsichere Wesen der Spekulation und die potenziell unvorhersehbaren Folgen.
Definitorischer Teil und Grundlagen: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Begriffe fest, die für das Verständnis der Arbeit unerlässlich sind. Es definiert den Begriff "Währung" als die Geldeinheit eines Staates und erläutert die Bedeutung des Wechselkurses und der Devisen. Das Kapitel liefert auch eine Definition des Devisenmarktes und der Währungsspekulation selbst, wobei die unterschiedlichen Akteure am Markt beleuchtet werden. Die klaren Definitionen bilden die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel.
Ursachen und Instrumente der Währungsspekulation: Dieser Abschnitt untersucht die Motive der Marktteilnehmer für Währungsspekulation, vor allem die Gewinnerzielung am Devisenmarkt. Er beschreibt verschiedene Instrumente, die für Spekulation eingesetzt werden, wie Devisenarbitrage, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisenswapgeschäfte und Devisenoptionsgeschäfte. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Funktionsweise dieser Instrumente und deren Einsatzmöglichkeiten zur Gewinnmaximierung oder Risikoabsicherung (Hedging). Die Kapitel verdeutlichen den Umfang und die Komplexität der Möglichkeiten zur Spekulation auf dem Devisenmarkt.
Schlüsselwörter
Währungsspekulation, Devisenmarkt, Wechselkurs, Hedging, Derivate, Währungsrisiken, Volkswirtschaft, Globalisierung, Spekulationsblasen, Währungskrisen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Währungsspekulation
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Währungsspekulation. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Text beleuchtet die Ursachen und Folgen von Währungsspekulation, beschreibt die verwendeten Instrumente und analysiert die Auswirkungen auf Volkswirtschaften.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise), Definitorischer Teil und Grundlagen (Währung, Wechselkurs, Devisen, Devisenmarkt, Währungsspekulation), Ursachen und Instrumente der Währungsspekulation (Gewinnerzielung am Devisenmarkt, verschiedene Handelsformen wie Devisenarbitrage, Kassageschäfte, Termingeschäfte, Swapgeschäfte und Optionsgeschäfte sowie Hedging), Folgen von Währungsspekulation (stabilisierende und destabilisierende Effekte, Auswirkungen auf Spekulanten, Entstehung von Währungskrisen und Spekulationsblasen) und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen der Währungsspekulation. Ziel ist es, den Zweck der Währungsspekulation für Kapitalmarktteilnehmer zu beleuchten, die verfügbaren Instrumente zu beschreiben und die möglichen Auswirkungen auf Volkswirtschaften und deren Teilnehmer zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf dem Zweck der Währungsspekulation für Kapitalmarktteilnehmer, den Instrumenten der Währungsspekulation, den Auswirkungen von Währungsspekulationen auf Volkswirtschaften, dem Einfluss auf Wechselkurse sowie den Risiken und Chancen der Währungsspekulation.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Währungsspekulation, Devisenmarkt, Wechselkurs, Hedging, Derivate, Währungsrisiken, Volkswirtschaft, Globalisierung, Spekulationsblasen, Währungskrisen.
Welche Instrumente der Währungsspekulation werden beschrieben?
Der Text beschreibt verschiedene Instrumente, die für die Währungsspekulation eingesetzt werden, darunter Devisenarbitrage, Devisenkassageschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisenswapgeschäfte und Devisenoptionsgeschäfte.
Welche Auswirkungen von Währungsspekulation werden analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl stabilisierende als auch destabilisierende Auswirkungen der Währungsspekulation. Es werden mögliche Folgen für Spekulanten, die Entstehung von Währungskrisen und Spekulationsblasen untersucht.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich akademisch mit dem Thema Währungsspekulation auseinandersetzen möchten, insbesondere Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Finanzmärkte. Es bietet einen strukturierten und umfassenden Überblick über das komplexe Thema.
- Citar trabajo
- Yannic Grobe (Autor), 2016, Ursachen und Folgen von Währungsspekulation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355952