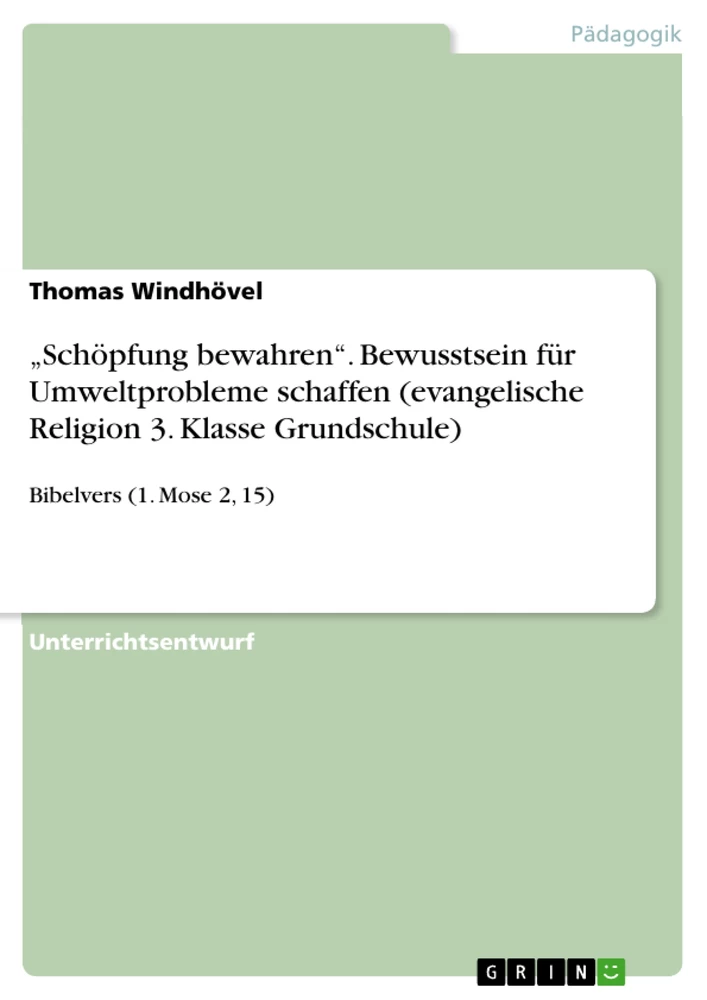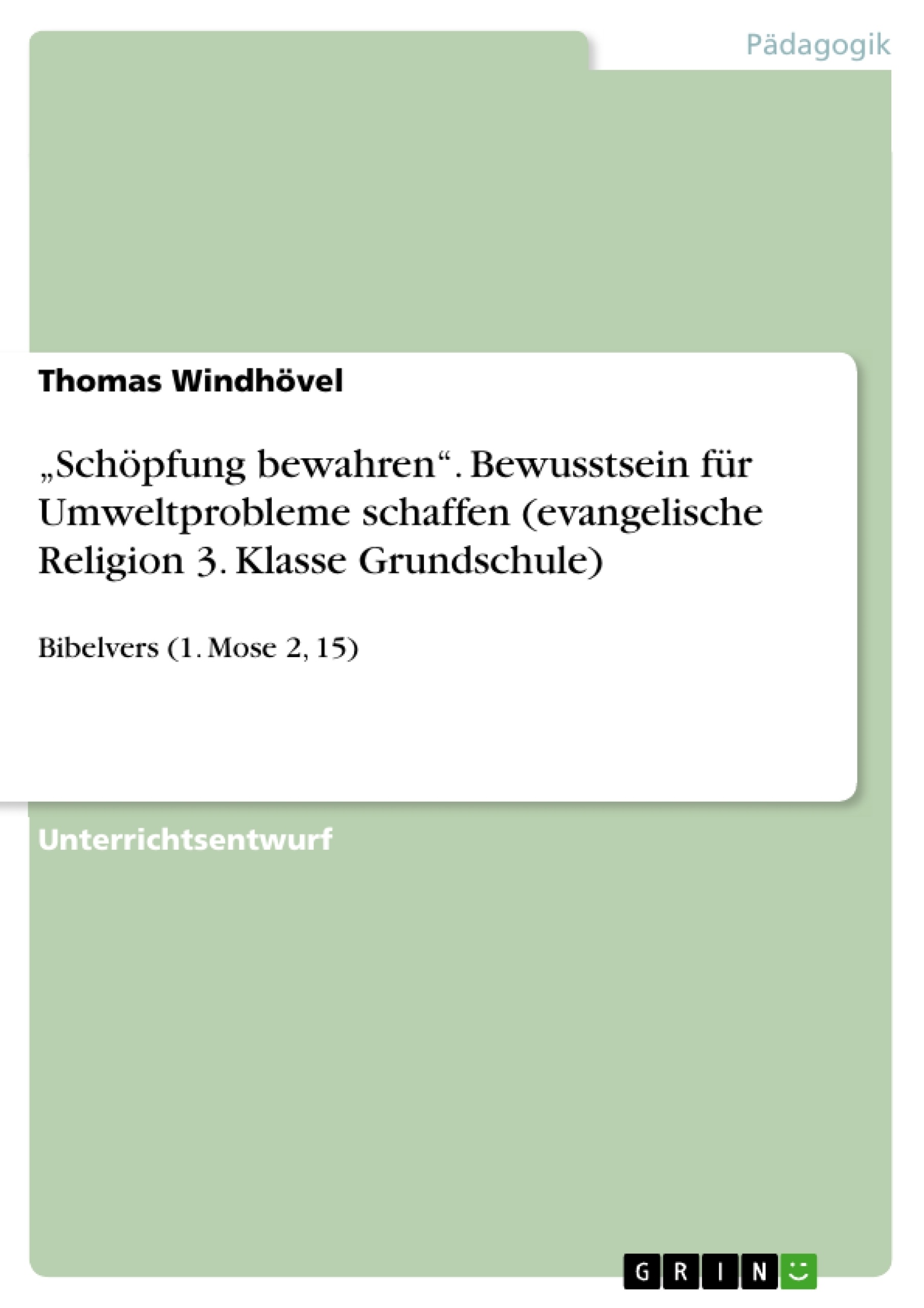Im Unterrichtsentwurf wird auf das Thema „Schöpfung bewahren“ eingegangen. Das Thema weist einen Gegenwartsbezug auf, da sich die Schüler der 3. Klasse in der Grundschule mit gegenwärtigen Umweltproblemen auseinandersetzen. Auch weist es einen Zukunftsbezug auf, da die Schüler in den kommenden Jahren selbst zu verantwortungsbewussten Bürgern heranwachsen werden. Vor allem geht es hier um Gott als Schöpfer und den Schöpfungsauftrag: „Gottes schöne und bedrohte Welt zu schützen.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Didaktische Analyse
- 1. Die Unterrichtsreihe - Die Schöpfung
- 2. Einbettung des Themas in den Lehrplan bzw. das Kerncurriculum
- 3. Kompetenzen und Lernziele
- II. Methodische Analyse
- 1. Methodische Überlegungen
- 2. Situation der Lerngruppe
- 3. Leistungseinschätzung und Sozialverhalten im Fach ev. Religion
- 4. Verlaufsplan
- III. Verzeichnis der Quellen, Internetquellen und Abbildungsnachweise
- IV. Anhang - die Unterrichtsmaterialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, den Schülern anhand des Themas „Schöpfung bewahren“ Umweltprobleme bewusst zu machen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung anzuregen. Die Stunde baut auf vorangegangenen Einheiten zum Paradies auf und verknüpft biblische Texte mit aktuellen Umweltfragen.
- Die Bedeutung des Schöpfungsberichts in 1. Mose
- Der Bezug zwischen dem biblischen Paradies und der heutigen Umwelt
- Die Verantwortung des Menschen für die Bewahrung der Schöpfung
- Konkrete Umweltprobleme und deren Auswirkungen
- Möglichkeiten des individuellen Handelns zum Umweltschutz
Zusammenfassung der Kapitel
I. Didaktische Analyse: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte didaktische Analyse der Unterrichtsreihe "Die Schöpfung". Er beinhaltet eine Übersicht der einzelnen Stunden, deren Schwerpunkte und methodische Vorgehensweisen. Besonders wird die Einbettung des Themas in den Lehrplan und die zu vermittelnden Kompetenzen und Lernziele erläutert. Die Analyse legt den Fokus auf die Verbindung zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und aktuellen Umweltproblemen, was den Gegenwarts- und Zukunftsbezug des Themas unterstreicht. Der didaktische Aufbau der Reihe, inklusive der methodischen Ansätze und der Berücksichtigung unterschiedlicher Lernniveaus, wird hier umfassend dargestellt.
II. Methodische Analyse: Dieser Teil des Unterrichtsentwurfs befasst sich mit den methodischen Aspekten der Unterrichtsstunde. Er beschreibt die gewählten Methoden, berücksichtigt die Lerngruppe und deren spezifische Bedürfnisse, und geht auf die Leistungseinschätzung und das Sozialverhalten der Schüler im Fach Evangelische Religion ein. Der detaillierte Verlaufsplan gibt Aufschluss über den Stundenablauf, die vorgesehenen Aktivitäten und den didaktischen Aufbau der Stunde. Die Auswahl der Methoden dient der aktiven Beteiligung der Schüler und der Vermittlung des Themas auf unterschiedlichen Ebenen, von der Bibelarbeit bis zum kreativen Gestalten.
Schlüsselwörter
Schöpfung, Schöpfungsbewahrung, Umweltprobleme, Bibel, 1. Mose, Verantwortung, Paradies, Umweltschutz, Didaktik, Methodik, Lernziele, Kompetenzen, Gegenwartsbezug, Zukunftsbezug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Unterrichtsentwurf "Die Schöpfung bewahren"
Was beinhaltet der Unterrichtsentwurf "Die Schöpfung bewahren"?
Der Unterrichtsentwurf umfasst eine didaktische und methodische Analyse einer Unterrichtsreihe zum Thema "Schöpfung bewahren". Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel (Didaktische und Methodische Analyse), sowie Schlüsselwörter. Der Entwurf verknüpft den biblischen Schöpfungsbericht mit aktuellen Umweltproblemen und zielt darauf ab, Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung zu sensibilisieren.
Welche Themen werden im Unterrichtsentwurf behandelt?
Die zentralen Themen sind der Schöpfungsbericht aus 1. Mose, der Bezug zwischen dem biblischen Paradies und der heutigen Umwelt, die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung, konkrete Umweltprobleme und deren Auswirkungen, sowie Möglichkeiten des individuellen Handelns zum Umweltschutz. Der Entwurf beleuchtet diese Themen sowohl aus biblischer als auch aus aktueller gesellschaftlicher Perspektive.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in drei Hauptteile: Die Didaktische Analyse (einschließlich Lehrplanbezug, Kompetenzen und Lernziele), die Methodische Analyse (mit methodischen Überlegungen, Lerngruppenbeschreibung, Leistungseinschätzung und Verlaufsplan) und ein Verzeichnis der verwendeten Quellen und Materialien. Zusätzlich enthält er eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche didaktischen Aspekte werden im Entwurf behandelt?
Die didaktische Analyse fokussiert auf die Einbettung des Themas in den Lehrplan, die zu vermittelnden Kompetenzen und Lernziele. Sie beschreibt den didaktischen Aufbau der Unterrichtsreihe, inklusive der methodischen Ansätze und der Berücksichtigung unterschiedlicher Lernniveaus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und aktuellen Umweltproblemen.
Welche methodischen Aspekte werden im Entwurf behandelt?
Die methodische Analyse beschreibt die gewählten Methoden, berücksichtigt die Lerngruppe und deren Bedürfnisse, und geht auf die Leistungseinschätzung und das Sozialverhalten der Schüler ein. Ein detaillierter Verlaufsplan gibt Aufschluss über den Stundenablauf und die vorgesehenen Aktivitäten. Die Methoden zielen auf die aktive Beteiligung der Schüler und die Vermittlung des Themas auf verschiedenen Ebenen ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsentwurf?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Schöpfung, Schöpfungsbewahrung, Umweltprobleme, Bibel, 1. Mose, Verantwortung, Paradies, Umweltschutz, Didaktik, Methodik, Lernziele, Kompetenzen, Gegenwartsbezug, Zukunftsbezug.
Für wen ist dieser Unterrichtsentwurf gedacht?
Der Unterrichtsentwurf richtet sich an Lehrkräfte im Fach Evangelische Religion, die eine Unterrichtsreihe zum Thema "Schöpfung bewahren" planen und durchführen möchten. Er bietet eine detaillierte Anleitung und Hilfestellung für die Unterrichtsvorbereitung.
- Quote paper
- Thomas Windhövel (Author), 2016, „Schöpfung bewahren“. Bewusstsein für Umweltprobleme schaffen (evangelische Religion 3. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/356700