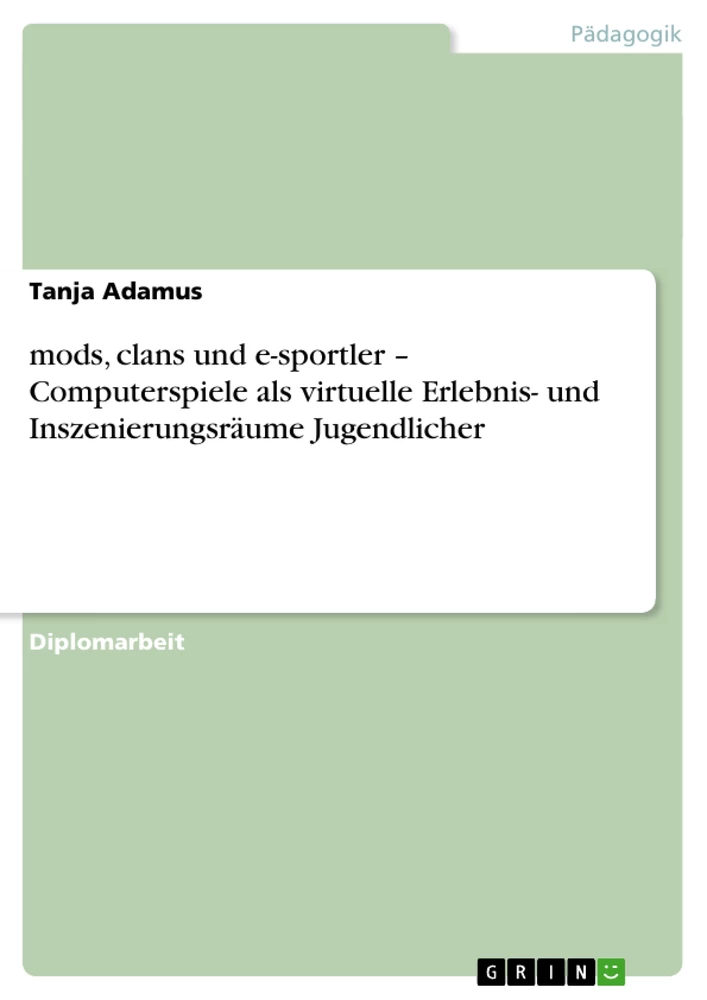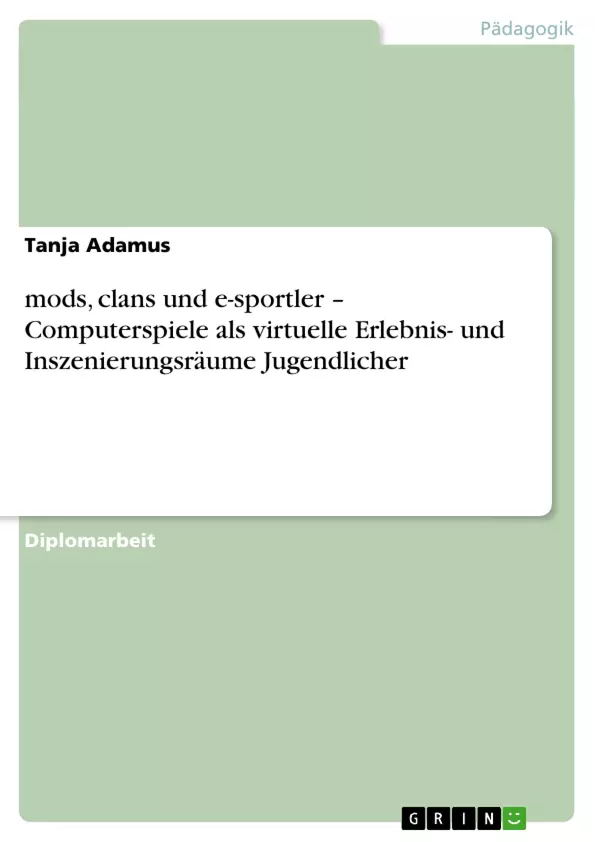Im August diesen Jahres erschienen in verschiedenen Medien Berichte uber
einen Mordfall in Grosbritannien, bei dem ein 14-jahriger Junge mit einem
Hammer getotet wurde. Da der Tater ebenfalls noch ein Jugendlicher und gerade
einmal drei Jahre alter als sein Opfer war, kam bald die Frage nach dem Beweggrund
fur diese Tat auf. Schnell war in diesem Zusammenhang der vermeintliche
und alleinige Schuldige gefunden: das Computerspiel „Manhunt“, von dem der
17-Jahrige angeblich nahezu „besessen“ gewesen sein soll (vgl. ausfuhrlicher zu
Manhunt und seiner besonderen Problematik Rotzer 2003h, Willmann 2004 sowie
Rotzer 2004).
An diesem Beispiel lasst sich eine haufig geauserte Sicht in Bezug auf Computerspiele,
insbesondere jene mit gewalttatigen Inhalten, und ihre Auswirkungen
auf die vor allem jugendlichen Nutzer rekonstruieren: Sie werden zumeist misstrauisch
betrachtet und als Gefahrdungen angesehen. So sollen sie im schlimmsten
Fall die Ursache und das Modell fur Gewalthandlungen und aggressives Verhalten
in der Realitat sein, aber doch zumindest beinahe alle anderen Freizeitbeschaftigungen
verdrangen und zur sozialen Isolation der Spieler fuhren. Vereinfacht und
provokant formuliert lasst sich somit sagen, dass Computerspielen unterstellt wird
nahezu alles zu konnen, jedoch keinesfalls einen positiven Nutzen zu besitzen.
Dem soll in dieser Arbeit ein ganzlich anderes Bild entgegen gestellt werden.
Gemas der bereits im Titel geauserten These, soll es das Ziel sein, zu einem neuen
Verstandnis von Computerspielen in der Lebenswelt der Jugendlichen1 zu gelangen,
indem sie als Erlebnis- und Inszenierungsraume in der Virtualitat
verstanden werden. Es soll versucht werden aufzuzeigen, dass viele der
Annahmen uber den Einfluss der Computerspiele und ihre Auswirkungen in der
oben dargelegten ausschlieslich negativen Sichtweise in dieser vereinfachenden
und generalisierenden Form nicht aufrechtzuerhalten sind. Ebenso wie andere
Spiele, bieten jene am Computer den Jugendlichen Raume bzw. Nischen in der
Welt, die es ihnen ermoglichen, sich selbst zu erleben und zu inszenieren. [...]
1 Als jugendlich wird dabei in Anlehnung an die verbreitete Definition dieses Begriffs die Altersgruppe
der 14- bis 21-Jahrigen verstanden (vgl. zu diesem Aspekt unter anderem Raithel
2001b, S. 11, Fusnote 1).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Kategorisierung von Computerspielen
- Definition von Computerspielen
- Die „klassischen“ Kategorien der Computerspiele
- Actionspiele sind zeitkritisch
- Adventurespiele sind entscheidungskritisch
- Strategiespiele sind konfigurationskritisch
- Lokalisierungsmodelle von Computerspielen
- Von den bipolaren „Köpfchen- und Knöpfchenspielen“ zur „dynamischen Landkarte der Bildschirmspiele“
- Das Vektorenmodell der Computerspiele
- Computerspiele in den Medienwelten von Jugendlichen
- Verbreitung und Bedeutung von Computerspielen
- Verbreitung von Computern und ihre Nutzung
- Zur Funktion von Computerspielen für Jugendliche
- Motive für die Beschäftigung mit Computerspielen
- Strukturelle Kopplungen
- Die Erfahrung von Macht und Kontrolle
- Verbreitung und Bedeutung von Computerspielen
- Computerspiele im Spiegel von ausgewählten Theorien des Spiels
- Der phänomenologische Ansatz: Johan Huizinga
- Der funktionalistische Ansatz: Roger Caillois
- Der strukturalistische Ansatz: Spieltheorie in den Wirtschaftswissenschaften
- Bezug der Theorien zu Computerspielen
- Kontrovers diskutierte Aspekte des Computerspiels
- Das Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur: Von totaler Verschmelzung zur perspektivischen Dopplung
- Zur Bedeutung der Inhalte von Computerspielen
- Wenn zu viel Realität im Spiel ist: zur Problematik der Simulationen
- Die Rezeption von Computerspielen
- „Klassische“ Annahmen zur Wirkung von Medieninhalten
- Computerspiele und Gewalt
- Thesen zur Wirkung von Gewalt in Computerspielen
- Computerspiele als Modelle und Verursacher von Gewalt in der Realität?
- Kodieren/ Dekodieren nach Hall
- Das Transfermodell von Fritz
- Ego-shooter und mods: jugendliche Ausdrucksformen symbolischer Kreativität in virtuellen Welten
- Zur Theorie der symbolischen Kreativität nach Willis
- Computerspiele als Raum für notwendige symbolische Arbeit
- DOOM und Co. - die Revolution der ego-shooter auf dem Spielemarkt
- Counter-Strike und mods – die Spieler übernehmen die Macht
- clans und e-sportler: virtuelle Gemeinschaften Jugendlicher
- Entstehung und Formen von clans
- Organisation und Selbstdarstellung von clans
- e-sports als Möglichkeit für Kompetenzerlebnisse Jugendlicher
- Fazit und pädagogische Relevanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht Computerspiele aus der Perspektive von Jugendlichen und analysiert ihre Rolle in der digitalen Kultur.
- Die Entwicklung und Verbreitung von Computerspielen
- Die Motive und Funktionsweisen von Computerspielen für Jugendliche
- Die Bedeutung von Computerspielen als Raum für symbolische Kreativität und soziale Interaktion
- Die Rolle von Computerspielen in Bezug auf Gewalt und Medienrezeption
- Die Bedeutung von Clans und e-Sport für die Jugendkultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Diplomarbeit dar und führt in die Thematik der Computerspiele als virtuelle Erlebnis- und Inszenierungsräume ein.
- Definition und Kategorisierung von Computerspielen: Dieses Kapitel definiert Computerspiele und kategorisiert sie anhand verschiedener Kriterien. Es untersucht verschiedene Lokalisierungsmodelle und zeigt die Entwicklung der Computerspiele auf.
- Computerspiele in den Medienwelten von Jugendlichen: Dieses Kapitel analysiert die Verbreitung und Bedeutung von Computerspielen in der Jugendkultur. Es untersucht die Motive für die Beschäftigung mit Computerspielen und betrachtet die Rolle der Spiele als Mittel zur Strukturierung der Lebenswelt von Jugendlichen.
- Computerspiele im Spiegel von ausgewählten Theorien des Spiels: Dieses Kapitel untersucht Computerspiele im Kontext verschiedener Spieltheorien, darunter der phänomenologische Ansatz von Huizinga, der funktionalistische Ansatz von Caillois und die Spieltheorie in den Wirtschaftswissenschaften.
- Kontrovers diskutierte Aspekte des Computerspiels: Dieses Kapitel beleuchtet kontrovers diskutierte Aspekte von Computerspielen, wie das Verhältnis zwischen Spieler und Spielfigur, die Bedeutung der Inhalte von Computerspielen und die Problematik von Simulationen.
- Die Rezeption von Computerspielen: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption von Computerspielen und analysiert die Wirkung von Medieninhalten. Es untersucht den Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt sowie verschiedene Modelle der Medienrezeption.
- Ego-shooter und mods: jugendliche Ausdrucksformen symbolischer Kreativität in virtuellen Welten: Dieses Kapitel analysiert Ego-Shooter und Mods als Ausdruck von jugendlicher Kreativität in virtuellen Welten. Es betrachtet die Rolle der Mods als Mittel zur individuellen Gestaltung und Erweiterung von Spielwelten und zeigt auf, wie diese Form der symbolischen Kreativität im Kontext von Jugendkultur funktioniert.
- Clans und e-sportler: virtuelle Gemeinschaften Jugendlicher: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Funktionsweise von Clans und e-Sport als Formen virtueller Gemeinschaften von Jugendlichen. Es analysiert die Organisation und Selbstdarstellung von Clans sowie die Bedeutung von e-Sport als Möglichkeit für Kompetenzerlebnisse.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Jugendkultur, virtuelle Erlebnisräume, symbolische Kreativität, Medienrezeption, Gewalt, Clans, e-Sport, Mods, Ego-Shooter, Spieltheorien, Lokalisierungsmodelle, Verbreitung, Nutzung.
Häufig gestellte Fragen
Sind Computerspiele tatsächlich Ursache für Gewalt?
Die Arbeit hinterfragt die rein negative Sichtweise und zeigt auf, dass einfache Kausalzusammenhänge zwischen Spielen und realer Gewalt wissenschaftlich oft nicht haltbar sind.
Welche positiven Funktionen haben Computerspiele für Jugendliche?
Sie dienen als virtuelle Erlebnis- und Inszenierungsräume, ermöglichen Kompetenzerlebnisse, Macht- und Kontrollerfahrungen sowie symbolische Kreativität.
Was sind "Clans" und welche Rolle spielen sie?
Clans sind virtuelle Gemeinschaften, die Jugendlichen soziale Interaktion, Organisation und die Möglichkeit zur Selbstdarstellung in einem kompetitiven Umfeld (E-Sport) bieten.
Was versteht man unter "Mods" im Kontext von Games?
Mods sind Modifikationen von Spielen durch die Nutzer selbst. Sie sind Ausdruck symbolischer Kreativität, bei der Spieler aktiv die Macht über die Spielinhalte übernehmen.
Wie unterscheiden sich die Hauptkategorien von Computerspielen?
Es wird zwischen Actionspielen (zeitkritisch), Adventures (entscheidungskritisch) und Strategiespielen (konfigurationskritisch) unterschieden.
- Quote paper
- Tanja Adamus (Author), 2004, mods, clans und e-sportler – Computerspiele als virtuelle Erlebnis- und Inszenierungsräume Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35681