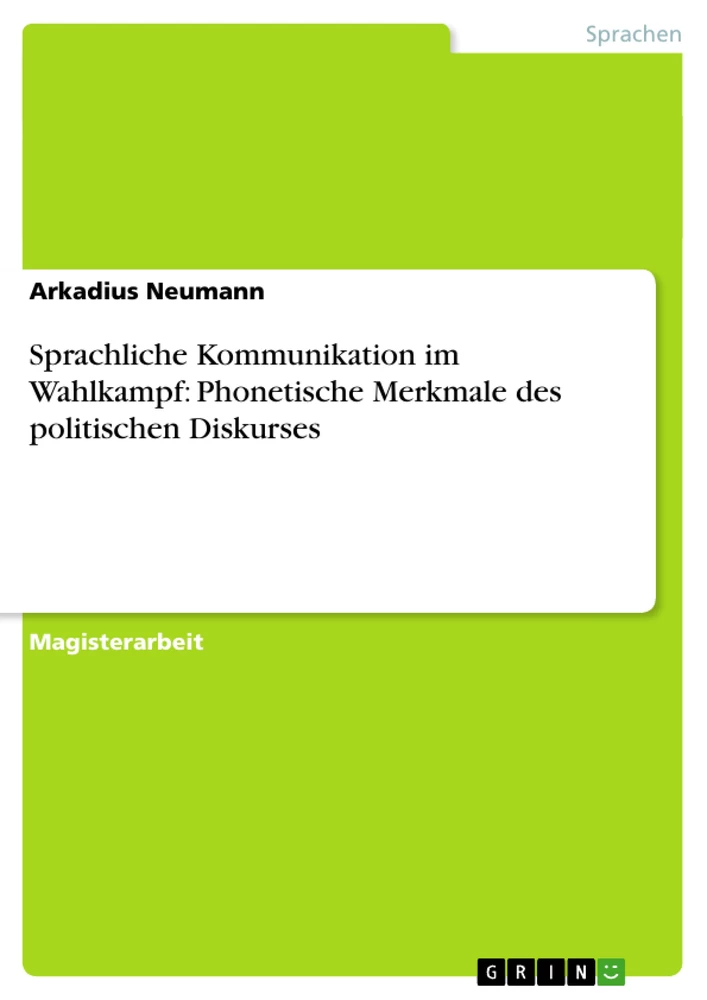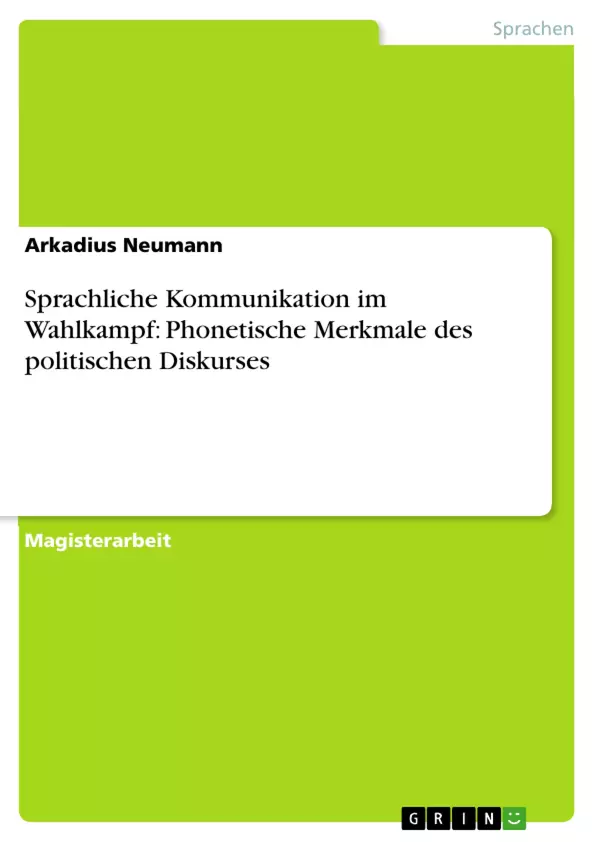„Das Verständnis an der Sprache ist nicht das Wort selber, sondern der Ton, Stärke, Modulation, Tempo, mit denen eine Reihe von Wörtern gesprochen wird - kurz, die Musik hinter den Worten, die Leidenschaft hinter der Musik, die Person hinter der Leidenschaft. Alles das also, was nicht geschrieben werden kann.“ Friedrich Nietzsche. Die vorliegende Arbeit hat die Untersuchung phonetischer Merkmale zum Ziel, die während einer Fernsehauseinandersetzung zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber im Bundestagswahlkampf 2002 aufgetreten sind. Die Beweggründe für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik resultieren aus dem Interesse des Verfassers, die häufig vernachlässigten Berührungspunkte zwischen den Disziplinen Phonetik und Politikwissenschaft zu beleuchten und verständlich zu machen. Die natur- und geisteswissenschaftlichen Methoden der Phonetik eignen sich in hervorragender Weise dazu, um Untersuchungsfelder anderer, scheinbar mit der Phonetik unvereinbaren universitären Fachrichtungen zu verknüpfen und ihre Forschungstechniken dadurch zu unterstützen. Neben den traditionellen akademischen Fächern Politologie, Soziologie und Psychologie sollen auch neue Disziplinen wie Medienwissenschaften, Kommunikationspsychologie sowie Kommunikations- und Politikmanagement an dieser Stelle erwähnt werden. So stellt die vorliegende Untersuchung zwar einen weiteren Beitrag zur Analyse sprachlicher politischer Kommunikation dar, der sich aber durch die Auswahl der Untersuchungsinstrumente von dem Gros anderer wissenschaftlicher Abhandlungen unterscheidet. Der auf der lautsprachlichen Komponente des Informationsaustausches gesetzte Schwerpunkt ist zudem insofern bewusst gewählt worden, als dass bisher kaum phonetische Arbeiten zu dieser Thematik [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sprache und Politik
- 2.1 Sprache als Voraussetzung der Politik
- 2.2 Wahlen
- 2.3 Der Wahlkampf
- 2.4 Kommunikation, Medien und Wahlkampf
- 2.5 Instrumentarium des Wahlkampfes
- 2.5.1 Anfänge
- 2.5.2 Sprache
- 2.5.3 Schrift
- 2.5.4 Hörfunk
- 2.5.5 Fernsehen
- 2.5.6 Internet
- 2.5.7 Fazit
- 3 Wahlkampf 2002: Personalisierung und Fernsehkonzentrierung
- 3.1 Zur Geschichte der TV-Duelle
- 3.2 Vorläufer des Fernsehens
- 3.3 TV-Duelle im US-amerikanischen Fernsehen
- 3.4 TV-Duelle im deutschen Fernsehen vor der Wiedervereinigung
- 3.5 TV-Duelle im deutschen Fernsehen nach der Wiedervereinigung
- 3.6 TV-Duelle 2002
- 3.7 Mediale Darstellung der Politiker als Redner
- 3.7.1 Mediale Darstellung Schröders
- 3.7.1.1 Mediale Darstellung Schröders nach dem 1. TV-Duell
- 3.7.1.2 Mediale Darstellung Schröders nach dem 2. TV-Duell
- 3.7.2 Mediale Darstellung Stoibers
- 3.7.2.1 Mediale Darstellung Stoibers nach dem 1. TV-Duell
- 3.7.2.2 Mediale Darstellung Stoibers nach dem 2. TV-Duell
- 3.7.1 Mediale Darstellung Schröders
- 4 Theoretische Grundlagen
- 4.1 Verzögerungsphänomene
- 4.1.1 Pausen
- 4.1.1.1 Definition
- 4.1.1.2 Phonetischer Aufbau
- 4.1.1.3 Funktionen
- 4.1.1.4 Pausenlänge
- 4.1.2 Häsitationen
- 4.1.2.1 Definition
- 4.1.2.2 Problematik der Abgrenzung: Pausen vs. Häsitationen
- 4.1.2.3 Phonetischer Aufbau
- 4.1.2.4 Funktionen
- 4.1.1 Pausen
- 4.2 Sprechtempo
- 4.2.1 Definition
- 4.2.2 Funktionen
- 4.3 Silbe
- 4.3.1 Definition
- 4.3.2 Aufbau und phonologische Merkmale
- 4.3.3 Silbenabgrenzung
- 4.4 Akzent
- 4.4.1 Wortakzent
- 4.4.2 Satzakzent
- 4.4.3 Phonologische Eigenschaften
- 4.5 Flüssigkeit der Sprache
- 4.6 Grundfrequenz
- 4.6.1 Definition
- 4.6.2 Anatomisch-phonetische Voraussetzungen
- 4.1 Verzögerungsphänomene
- 5 Durchführung
- 5.1 Vor- und Aufbereitung der Sprachproben
- 5.2 Untersuchung der Pausen
- 5.3 Untersuchung der Flüssigkeit der Sprache
- 5.4 Untersuchung der Häsitationen
- 5.5 Untersuchung der Sprechgeschwindigkeit
- 5.5.1 Untersuchung der mittleren Sprechgeschwindigkeit pro Sequenz
- 5.5.2 Untersuchung des Sprechgeschwindigkeitsverlaufs
- 5.5.3 Untersuchung der Sprechgeschwindigkeitsbeschleunigung
- 5.6 Untersuchung der Grundfrequenz
- 5.6.1 Untersuchung der mittleren Grundfrequenz pro Sprachsequenz
- 5.6.2 Untersuchung des Grundfrequenzverlaufs
- 5.6.3 Untersuchung der Grundfrequenzschwankung
- 5.7 Akzentuntersuchung
- 5.7.1 Wortakzentuntersuchung
- 5.7.2 Untersuchung des Satz- bzw. Phrasenakzents
- 6 Auswertung der Ergebnisse und Diskussion
- 6.1 Pausen
- 6.1.1 Pausen von Schröder
- 6.1.2 Pausen von Stoiber
- 6.1.3 Zusammenfassung der Pausenuntersuchung
- 6.2 Häsitationen
- 6.2.1 Häsitationen von Schröder
- 6.2.2 Häsitationen von Stoiber
- 6.2.3 Zusammenfassung der Häsitationsuntersuchung
- 6.3 Sprechtempo
- 6.3.1 Sprechtempo von Schröder
- 6.3.2 Sprechtempo von Stoiber
- 6.3.3 Zusammenfassung der Sprechtempountersuchung
- 6.3.3.1 Zusammenfassung der Sprechtempountersuchung Schröders
- 6.3.3.2 Zusammenfassung der Sprechtempountersuchung Stoibers
- 6.4 Grundfrequenz
- 6.4.1 Grundfrequenz von Schröder
- 6.4.2 Grundfrequenz von Stoiber
- 6.4.3 Zusammenfassung der Grundfrequenzuntersuchung
- 6.4.3.1 Zusammenfassung der Grundfrequenzuntersuchung Schröders
- 6.4.3.2 Zusammenfassung der Grundfrequenzuntersuchung Stoibers
- 6.5 Wortakzent
- 6.5.1 Wortakzent von Schröder
- 6.5.1.1 Wortakzent in Funktionswörtern von Schröder
- 6.5.1.2 Wortakzent in lexikalischen Wörtern von Schröder
- 6.5.2 Wortakzent von Stoiber
- 6.5.2.1 Wortakzent in Funktionswörtern von Stoiber
- 6.5.2.2 Wortakzent in lexikalischen Wörtern von Stoiber
- 6.5.3 Zusammenfassung der Wortakzentuntersuchung
- 6.5.1 Wortakzent von Schröder
- 6.6 Satzakzent
- 6.6.1 Satzakzent von Schröder
- 6.6.2 Satzakzent von Stoiber
- 6.6.3 Zusammenfassung der Satzakzentuntersuchung
- 6.1 Pausen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Kommunikation im Wahlkampf 2002, insbesondere die phonetischen Merkmale des politischen Diskurses von Gerhard Schröder und Edmund Stoiber. Ziel ist es, Unterschiede in ihrer Sprechweise aufzuzeigen und diese im Kontext der medialen Darstellung zu analysieren.
- Phonetische Analyse der Reden von Schröder und Stoiber
- Vergleich der Sprechweisen beider Politiker
- Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung der politischen Kommunikation
- Analyse von Pausen, Häsitationen und Sprechtempo
- Untersuchung von Akzentuierung und Grundfrequenz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der sprachlichen Kommunikation im Wahlkampf ein und beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Es skizziert die Bedeutung der phonetischen Analyse für das Verständnis des politischen Diskurses und benennt die untersuchten Politiker und den zeitlichen Rahmen der Untersuchung.
2 Sprache und Politik: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung. Er beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Politik, die Rolle von Sprache im Wahlkampf und die Bedeutung verschiedener Kommunikationsmedien. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wahlkampfes als komplexes Kommunikationssystem, in dem Sprache ein zentrales Instrument darstellt. Die verschiedenen Kommunikationskanäle (Schrift, Hörfunk, Fernsehen, Internet) werden in ihrem Einfluss auf den politischen Diskurs betrachtet und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile werden beleuchtet.
3 Wahlkampf 2002: Personalisierung und Fernsehkonzentrierung: Dieses Kapitel analysiert den Bundestagswahlkampf 2002 mit besonderem Augenmerk auf die Personalisierung und die starke Konzentration auf das Fernsehen als zentrales Medium. Es beschreibt die Geschichte der Fernsehduelle im deutschen und amerikanischen Kontext und analysiert die mediale Darstellung von Schröder und Stoiber im Hinblick auf ihre rhetorischen Fähigkeiten und ihr Auftreten im Fernsehen. Die Kapitel unterstreichen, wie die Inszenierung im Fernsehen die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst.
4 Theoretische Grundlagen: Das Kapitel etabliert die phonetischen Konzepte, die für die Analyse der Sprachproben relevant sind. Es definiert und beschreibt detailliert Pausen, Häsitationen, Sprechtempo, Silbenstruktur, Akzentuierung und Grundfrequenz. Die Beschreibung der phonetischen Merkmale beinhaltet sowohl ihre Definition als auch ihre funktionale Bedeutung im Kontext der mündlichen Kommunikation. Die Abgrenzung von ähnlichen Phänomenen, wie Pausen und Häsitationen, wird ebenfalls thematisiert.
5 Durchführung: Hier wird die Methodik der Arbeit detailliert dargestellt. Es beschreibt die Vorbereitung der Sprachproben, die Auswahl der Daten und die angewandten Analysemethoden für die Untersuchung der verschiedenen phonetischen Parameter. Die Beschreibung der verwendeten Methoden und Werkzeuge garantiert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und die Transparenz des Forschungsansatzes. Der Abschnitt erklärt die detaillierte Vorgehensweise bei der Analyse der Pausen, der Sprechgeschwindigkeit, der Häsitationen, der Grundfrequenz und der Akzentuierung.
Schlüsselwörter
Sprachliche Kommunikation, Wahlkampf, Phonetik, Politischer Diskurs, Gerhard Schröder, Edmund Stoiber, Fernsehduell, Mediale Darstellung, Pausen, Häsitationen, Sprechtempo, Grundfrequenz, Akzent, Analysemethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der sprachlichen Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2002
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sprachliche Kommunikation im deutschen Bundestagswahlkampf 2002, insbesondere die phonetischen Merkmale der Reden von Gerhard Schröder und Edmund Stoiber. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ihrer Sprechweisen und der Analyse des Einflusses der medialen Darstellung auf die öffentliche Wahrnehmung.
Welche Aspekte der Sprache werden untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene phonetische Merkmale wie Pausen, Häsitationen, Sprechtempo, Grundfrequenz und Akzentuierung (Wort- und Satzakzent). Diese Merkmale werden detailliert beschrieben und im Kontext des politischen Diskurses interpretiert.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der Datenaufbereitung und -analyse. Es werden die ausgewählten Sprachproben, die angewandten Analysemethoden und die verwendeten Werkzeuge spezifiziert, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf phonetische Theorien zur Beschreibung und Interpretation der untersuchten Sprachmerkmale. Pausen, Häsitationen, Sprechtempo, Silbenstruktur, Akzentuierung und Grundfrequenz werden definiert und ihre funktionale Bedeutung im Kontext der mündlichen Kommunikation erläutert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Analyse werden Kapitel für Kapitel präsentiert, beginnend mit der Beschreibung der Pausen und Häsitationen beider Politiker, gefolgt von einer Untersuchung des Sprechtempos, der Grundfrequenz und der Akzentuierung. Die Ergebnisse werden sowohl einzeln für Schröder und Stoiber als auch vergleichend dargestellt und diskutiert.
Wie wird der Einfluss der Medien berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet den Einfluss der Medien, insbesondere des Fernsehens, auf die öffentliche Wahrnehmung der politischen Kommunikation. Der Wahlkampf 2002 wird als stark vom Fernsehen geprägtes Ereignis analysiert, und die mediale Darstellung der Politiker wird in die Interpretation der Ergebnisse einbezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Sprache und Politik, Wahlkampf 2002, Theoretische Grundlagen, Durchführung und Auswertung der Ergebnisse und Diskussion. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse, von der Einführung in die Thematik über die Beschreibung der Methoden bis hin zur Interpretation und Diskussion der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Kommunikation, Wahlkampf, Phonetik, Politischer Diskurs, Gerhard Schröder, Edmund Stoiber, Fernsehduell, Mediale Darstellung, Pausen, Häsitationen, Sprechtempo, Grundfrequenz, Akzent, Analysemethoden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit sprachlicher Kommunikation, Politikwissenschaft, Medienwissenschaft und Phonetik beschäftigen. Sie bietet detaillierte Einblicke in die sprachliche Gestaltung des politischen Diskurses und den Einfluss der Medien auf die öffentliche Wahrnehmung.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Der detaillierte Inhaltsverzeichnisses ist im oberen Teil des Dokuments zu finden und zeigt die umfassende Strukturierung der Arbeit auf, die von der Einleitung bis zur detaillierten Auswertung der Ergebnisse reicht.
- Arbeit zitieren
- Arkadius Neumann (Autor:in), 2004, Sprachliche Kommunikation im Wahlkampf: Phonetische Merkmale des politischen Diskurses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35832