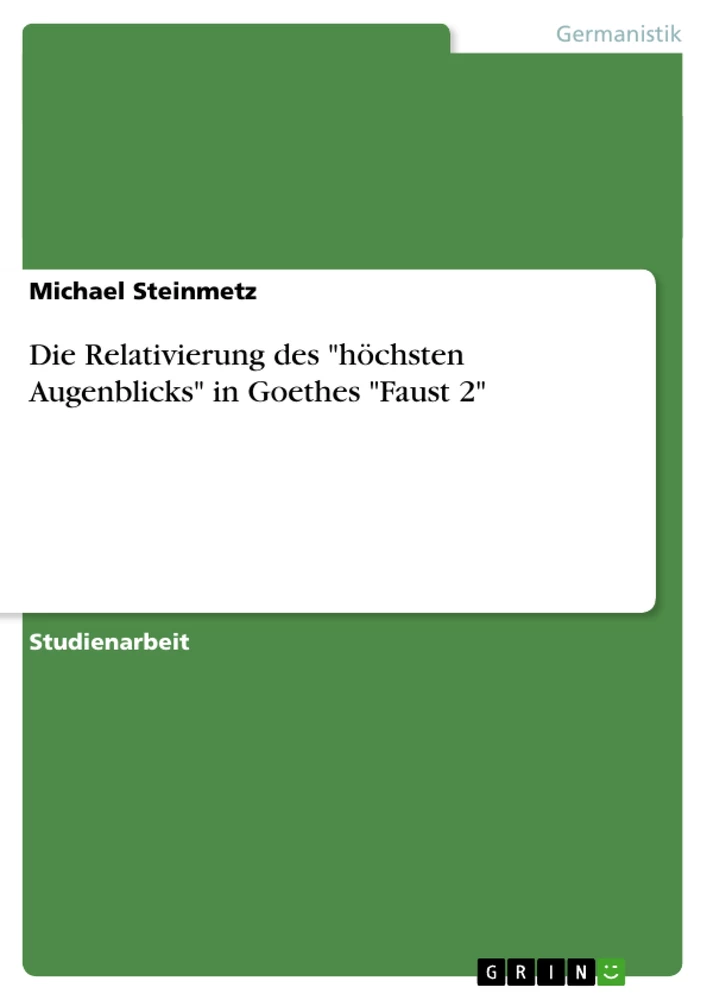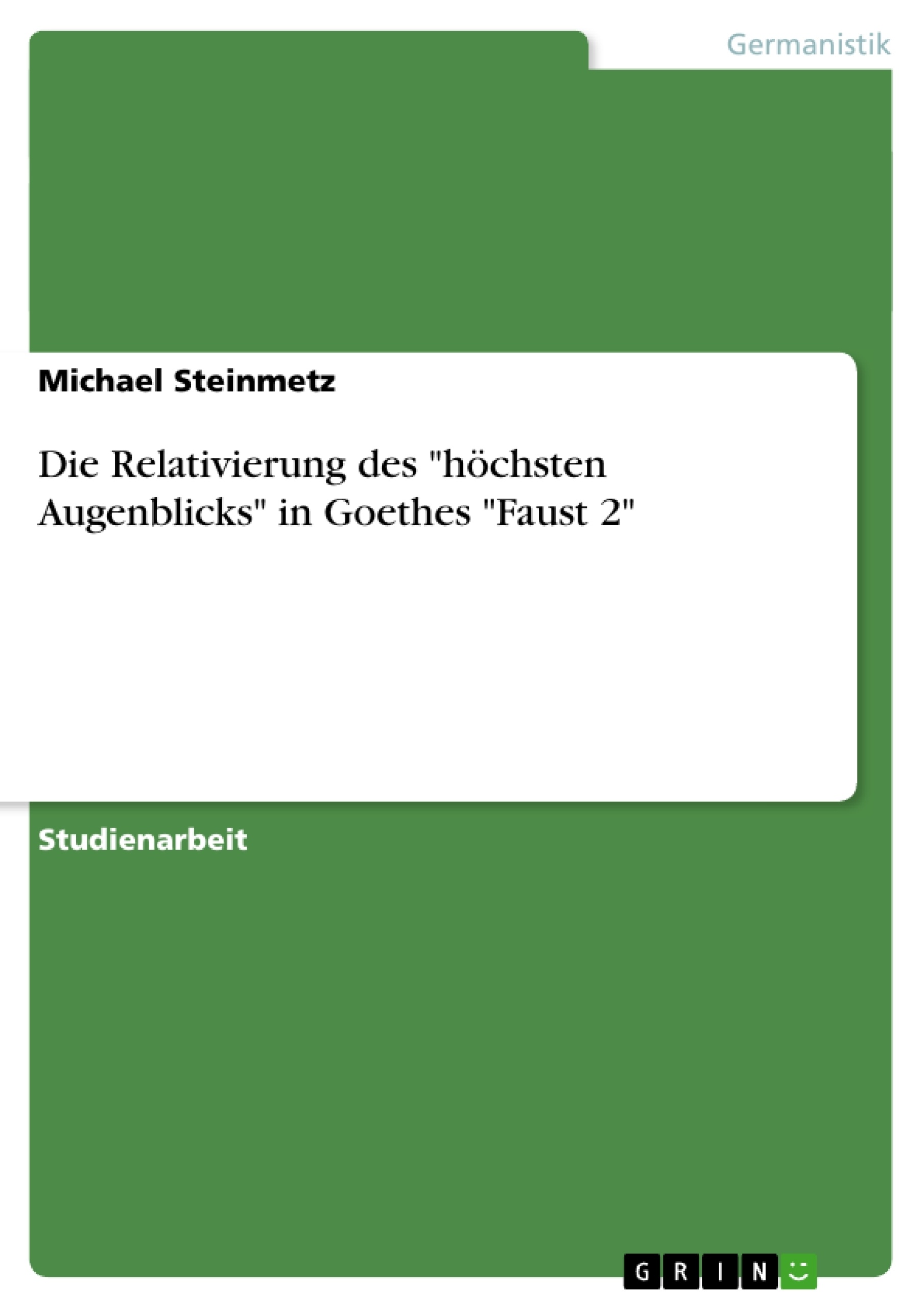Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungene
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das letzte wär das Höchsterrungene;
Diese Worte eröffnen die - literaturwissenschaftlich äußerst kontrovers diskutierte - letzte Rede Fausts vor seinem Ableben, welche, eben weil sie die letzten Ausführungen eines zeitlebens nach Erfahrung, Genuss und letztlich Macht strebenden Gelehrten markiert, besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Als Schlusswort eines Menschheitsdramas, welches heut als das zentrale Werk der deutschen Dichtung gehandelt und zugleich in den Kanon der Weltliteratur eingeordnet wird, scheint ein stark akzentuierendes, ja möglicherweise programmatisches Fazit mehr als plausibel. Doch beanspruchte Goethe mit jenen letzten Worten tatsächlich ein visionäres Zukunftsbild, ja eine Ideologie als realisierbare Gesellschaftstheorie zu erschaffen? Zumindest ist dies eine weit verbreitete Auffassung! Noch heut wird der ‚Schlussmonolog’ an vielen Schulen Deutschlands als „Vision einer künftigen Gesellschaft“ behandelt. In der DDR beispielsweise wurde der ‚Monolog’ mehrfach politisch instrumentalisiert und nicht selten als Goethes Prophezeiung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung dargestellt.
Doch kann Fausts letzte Rede unter Berücksichtigung des szenischen Kontextes diesem Anspruch überhaupt gerecht werden, sind die letzten Worte Fausts bei diesen Deutungen überhaupt als Teil des Ganzen beachtet? Wird bei diesen Deutungen nicht vielmehr der Inhalt des Monologes gegen die szenische Darstellung isoliert, die Rede quasi separat, inhaltlich autark und somit inadäquat gedeutet? Neue Literaturwissenschaftler gehen jedenfalls von letzterem aus. Demgemäß ist ein komplett neues, alten Deutungen oft gänzlich entgegengesetztes Bild des fünften Aktes geschaffen. Auch wenn dieses neuartige Verständnis die öffentliche, ‚populärwissenschaftliche’ Leserschaft bisher nur sporadisch berührt, so ist es doch in Fachkreisen heute nahezu etabliert.
Unter der zentralen Fragestellung: ‚Inwiefern kann das Erfahrungs-, Genuss- und später auch Machtstreben Fausts die im ‚Schlussmonolog’ angedeutete Sättigung erfahren?’, wird Fausts Entwicklung durch die Analyse seines stetig anwachsenden Machthungers im fünften Akt dargestellt. Dabei wird aufgezeigt, dass Goethe die Figur Faust bewusst als amoralischen Wert konstituiert und somit die Gültigkeit des im ‚Endmonolog’ inhaltlich Dargestellten mittels grotesker Verzerrung weitgehend relativiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ein Wort zum Beginn
- 1.1 Der „Schlussmonolog“ im wissenschaftlichen Disput
- 1.2 Grundriss der Untersuchung
- 1.3 Erste Deutung
- 2 Faust als negativer Wert
- 2.1 Philemon und Baucis contra Faust – Aufeinandertreffen zweier Welten
- 2.2 Zerstörung der alten Ordnung in divergenter Bewertung
- 3 Fausts idealistische Perspektive
- 3.1 Die Erblindung
- 3.2 „Endmonolog“
- 3.2.1 Szenischer Kontext
- 3.2.2 Inhalt und Deutung
- 3.2.2.1 Gefahren der Naturgewalten
- 3.2.2.2 Fausts Hinwendung zum „höchsten Augenblick“
- 4 Fazit
- 4.1 Fausts Hochgefühl in der Relation
- 4.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relativierung des „höchsten Augenblicks“ in Goethes „Faust II“, insbesondere im Kontext des „Schlussmonologs“. Die zentrale Fragestellung befasst sich damit, inwiefern Fausts Streben nach Erfahrung, Genuss und Macht die im „Schlussmonolog“ angedeutete Sättigung beeinflusst. Die Analyse fokussiert auf Fausts Entwicklung im fünften Akt und hinterfragt seine Darstellung als amoralischen Wert.
- Die kontroverse Interpretation des „Schlussmonologs“ in der Literaturwissenschaft
- Fausts Entwicklung als Machtstrebender und seine amoralische Konstitution
- Der Kontrast zwischen Fausts idealistischer Perspektive und dem szenischen Kontext
- Die Gegenüberstellung von Fausts Weltanschauung und der von Philemon und Baucis
- Goethes mögliche Kritik an der aufkommenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Ein Wort zum Beginn: Dieses einleitende Kapitel diskutiert die kontroversen Interpretationen des „Schlussmonologs“ in Faust II. Es beleuchtet die unterschiedlichen Lesarten, von der Vision einer zukünftigen Gesellschaft bis hin zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem grenzenlosen Machtdrang. Das Kapitel legt den Grundstein für die Untersuchung, indem es die zentrale Forschungsfrage formuliert und den methodischen Ansatz beschreibt. Die bisherigen Deutungen des Schlussmonologs werden kritisch hinterfragt, insbesondere die politische Instrumentalisierung in der DDR.
2 Faust als negativer Wert: Dieses Kapitel analysiert die Gegenüberstellung von Faust und dem Ehepaar Philemon und Baucis als Repräsentanten gegensätzlicher Weltanschauungen. Während Philemon und Baucis ein Leben der Genügsamkeit und Nächstenliebe führen, verkörpert Faust ein stetig wachsendes Streben nach Macht und Omnipotenz. Der Kontrast verdeutlicht die unterschiedlichen Konzepte von Glück und die Kritik an Fausts amoralischer Entwicklung. Die Szene „Offene Gegend“ wird im Detail betrachtet, um die antagonistische Begegnung beider Welten zu beleuchten. Der Gegensatz zwischen dem bescheidenen Glück der alten Welt und Fausts Streben nach Macht wird hervorgehoben.
3 Fausts idealistische Perspektive: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Fausts Erblindung, sowohl physisch als auch geistig, und deren Auswirkungen auf den „Endmonolog“. Es wird argumentiert, dass Fausts subjektiv gefärbte Wahrnehmung im Kontrast zum szenischen Kontext steht und den „höchsten Augenblick“ als eine Illusion darstellt. Der „Endmonolog“ wird als groteske Illustration von Fausts geistiger Verblendung interpretiert, die die Unmöglichkeit der Befriedigung seines Machtdrangs unterstreicht. Der Fokus liegt auf der Relativierung des "höchsten Augenblicks" im Kontext von Fausts Handlung und seiner geistigen Entwicklung.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust II, Schlussmonolog, Machtstreben, amoralisch, Idealistische Perspektive, Philemon und Baucis, kapitalistische Gesellschaftsordnung, Kulturkritik, „höchster Augenblick“, literaturwissenschaftliche Interpretation.
Goethe's Faust II: Eine Analyse des "Schlussmonologs" - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert den "Schlussmonolog" in Goethes Faust II und untersucht die Relativierung des "höchsten Augenblicks" im Kontext von Fausts Streben nach Macht, Erfahrung und Genuss. Ein Schwerpunkt liegt auf der Gegenüberstellung von Fausts Weltanschauung mit der von Philemon und Baucis und der kritischen Auseinandersetzung mit Fausts amoralischer Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die kontroversen Interpretationen des "Schlussmonologs" in der Literaturwissenschaft, Fausts Entwicklung als machtstrebender und amoralisch dargestellter Protagonist, den Kontrast zwischen Fausts idealistischer Perspektive und dem szenischen Kontext, den Vergleich zwischen Fausts und Philemon und Baucis' Weltanschauungen sowie die mögliche Kritik Goethes an der aufkommenden kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung und diskutiert verschiedene Interpretationen des "Schlussmonologs". Kapitel 2 analysiert Faust als negativen Wert im Vergleich zu Philemon und Baucis. Kapitel 3 konzentriert sich auf Fausts idealistische Perspektive und dessen Erblindung, sowohl physisch als auch geistig, in Bezug auf den "Schlussmonolog". Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Wie wird der "Schlussmonolog" interpretiert?
Der "Schlussmonolog" wird in dieser Arbeit kritisch hinterfragt. Es wird argumentiert, dass Fausts subjektiv gefärbte Wahrnehmung im Kontrast zum szenischen Kontext steht und den "höchsten Augenblick" als Illusion darstellt. Die Interpretation des Monologs als groteske Illustration von Fausts geistiger Verblendung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Philemon und Baucis?
Philemon und Baucis repräsentieren eine gegensätzliche Weltanschauung zu Fausts. Der Kontrast zwischen ihrem Leben der Genügsamkeit und Nächstenliebe und Fausts unersättlichem Streben nach Macht verdeutlicht die verschiedenen Konzepte von Glück und dient als kritische Auseinandersetzung mit Fausts amoralischer Entwicklung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Fausts Streben nach Macht und sein "höchster Augenblick" im Kontext seines Handelns und seiner geistigen Entwicklung relativiert werden müssen. Fausts subjektive Wahrnehmung und seine Verblendung werden als zentrale Aspekte seines Scheiterns interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Goethe, Faust II, Schlussmonolog, Machtstreben, amoralisch, idealistische Perspektive, Philemon und Baucis, kapitalistische Gesellschaftsordnung, Kulturkritik, „höchster Augenblick“, literaturwissenschaftliche Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Michael Steinmetz (Autor:in), 2004, Die Relativierung des "höchsten Augenblicks" in Goethes "Faust 2", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35875