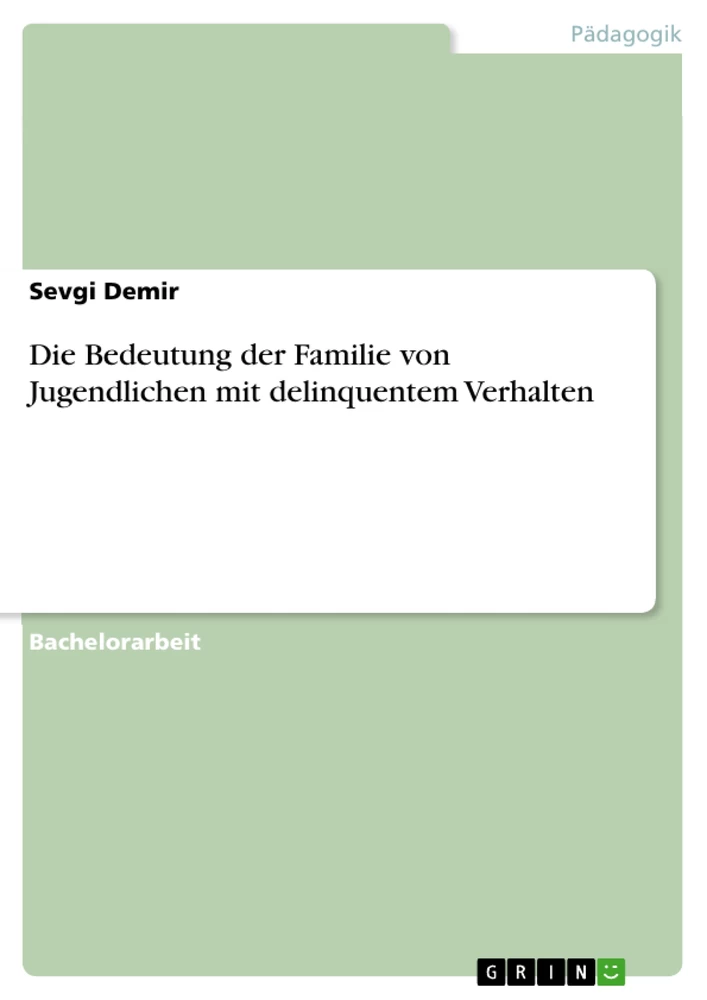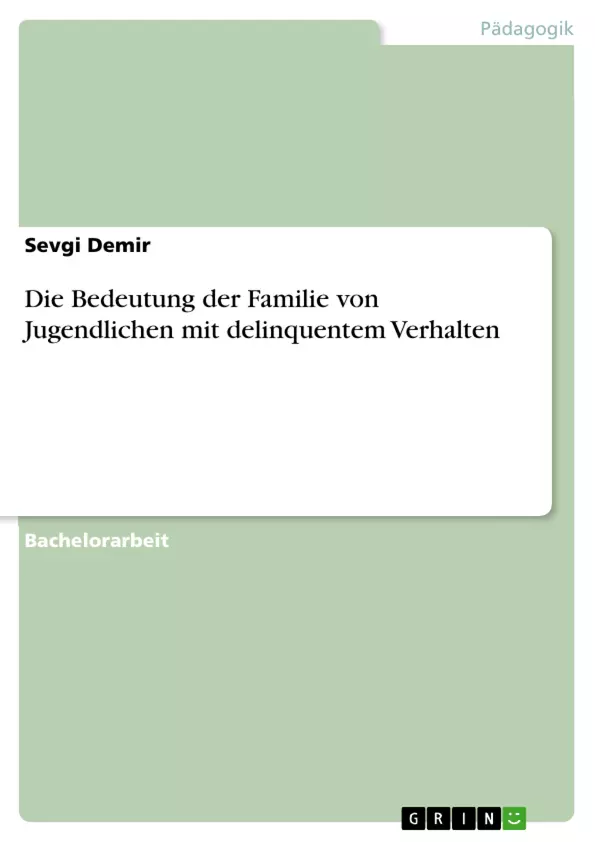Ziel dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung ist es, herauszufinden, welche Faktoren zu delinquentem Verhalten bei Jugendlichen beitragen. In erster Linie soll jedoch die Bedeutung der Familie von Jugendlichen mit delinquentem Verhalten untersucht werden. Die Forschungsfrage lautet: „Welche Einflüsse hat die Familie auf die Entstehung von delinquentem Verhalten bei Jugendlichen?“
Der Familie als Einflussfaktor wird hierbei die meiste Betrachtung geschenkt, da die Annahme vertreten wird, dass hauptsächlich die Familie, in der das Kind aufwächst, zur Prägung bestimmter Verhaltensmuster beiträgt. Obwohl der Fokus auf den Einflussfaktor Familie gesetzt wird, werden noch weitere Aspekte aus dem Bereich der Soziologie, dem der Biologie und der Kriminalpsychologie in die Arbeit mit eingebunden, da es bei diesem Thema unmöglich ist, die Ursachen dissozialen Verhaltens mit einer einzigen Erklärung zu versehen.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil
- 1. Einleitung
- 1.1. Motivation und Hintergründe
- 1.2. Forschungsfrage und Zielsetzung
- 1.3. Methodologie
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. Delinquenz/ Jugenddelinquenz
- 2.2. Delinquenz in Abgrenzung zu Kriminalität
- 3. Erklärungsansätze für Delinquenz im Jugendalter
- 3.1. Familie als Sozialisationsinstanz
- 3.1.1. Sozialisation
- 3.1.2. Die soziale Kontrolle in der Familie
- 3.2. Elterliche Einstellungen und Erziehungshaltungen
- 3.3. Soziogenese und Biologische Prädispositionen
- 3.4. Gewaltausübung aus Sicht der Hirnforschung und der Neuropsychologie
- 4. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse
- Empirischer Teil
- 5. Literaturreview
- 5.1. Vorgehensweise der Literaturrecherche
- 5.2. Beschreibung der Studien
- 5.3. Interpretation der Studien - Gemeinsamkeiten der Studien und die Verbindung zur Theorie
- 6. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit den Faktoren, die zu delinquentem Verhalten bei Jugendlichen beitragen, wobei der Fokus auf der Bedeutung der Familie liegt. Die Zielsetzung besteht darin, die Einflüsse der Familie auf die Entstehung von delinquentem Verhalten bei Jugendlichen zu untersuchen.
- Die Rolle der Familie als Sozialisationsinstanz und deren Einfluss auf die Entwicklung sozialer Kompetenzen bei Jugendlichen.
- Der Zusammenhang zwischen elterlichen Einstellungen und Erziehungshaltungen und dem Auftreten von delinquentem Verhalten.
- Die Bedeutung von soziogenetischen und biologischen Faktoren für die Entstehung von Delinquenz im Jugendalter.
- Die Relevanz von Hirnforschung und Neuropsychologie für das Verständnis von Gewaltausübung und delinquentem Verhalten.
- Die Analyse empirischer Studien zur Untersuchung der Beziehung zwischen Familie und delinquentem Verhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Motivation und den Hintergrund der Arbeit vor. Es werden die Forschungsfrage und die Zielsetzung formuliert sowie die Methodologie und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Begriffsbestimmungen: In diesem Kapitel werden die Begriffe Delinquenz und Jugenddelinquenz definiert und die Abgrenzung von Delinquenz zur Kriminalität beleuchtet.
- Kapitel 3: Erklärungsansätze für Delinquenz im Jugendalter: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten im Jugendalter. Es werden die Familie als Sozialisationsinstanz, elterliche Einstellungen und Erziehungshaltungen, soziogenetische und biologische Prädispositionen sowie die Rolle der Hirnforschung und Neuropsychologie in Bezug auf Gewaltausübung behandelt.
- Kapitel 4: Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse: Kapitel 4 bietet eine Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse, die in den vorherigen Kapiteln dargelegt wurden.
- Kapitel 5: Literaturreview: Im empirischen Teil wird ein Literaturreview durchgeführt, um die Forschungsfrage anhand realer Befunde aus der Praxis zu untersuchen. Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Literaturrecherche, die Analyse der Studien und die Interpretation der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Jugenddelinquenz, Familie als Sozialisationsinstanz, elterliche Einstellungen und Erziehungshaltungen, soziogenetische und biologische Prädispositionen, Hirnforschung und Neuropsychologie, sowie empirische Studien zur Entstehung von delinquentem Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die Familie auf Jugendkriminalität?
Die Familie gilt als primäre Sozialisationsinstanz. Erziehungsstile, mangelnde emotionale Zuwendung oder fehlende soziale Kontrolle in der Familie sind Hauptfaktoren für die Entstehung von Delinquenz.
Was ist der Unterschied zwischen Delinquenz und Kriminalität?
Delinquenz wird oft für abweichendes Verhalten Jugendlicher verwendet, das noch nicht zwingend die Schwere schwerer Straftaten erreicht, aber gegen soziale Normen oder Gesetze verstößt.
Spielen biologische Faktoren bei Aggression eine Rolle?
Ja, die Arbeit bezieht Erkenntnisse der Hirnforschung und Neuropsychologie ein, die zeigen, dass biologische Prädispositionen in Kombination mit sozialen Einflüssen das Gewaltpotenzial erhöhen können.
Wie wirkt sich der Erziehungsstil der Eltern aus?
Sowohl ein extrem autoritärer als auch ein vernachlässigender Erziehungsstil können die Entwicklung sozialer Kompetenzen stören und delinquentes Verhalten begünstigen.
Gibt es eine einzige Erklärung für dissoziales Verhalten?
Nein, die Arbeit betont, dass es ein Zusammenspiel aus soziologischen, biologischen und kriminalpsychologischen Faktoren ist, wobei die familiäre Prägung jedoch zentral bleibt.
- Quote paper
- Sevgi Demir (Author), 2015, Die Bedeutung der Familie von Jugendlichen mit delinquentem Verhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358864