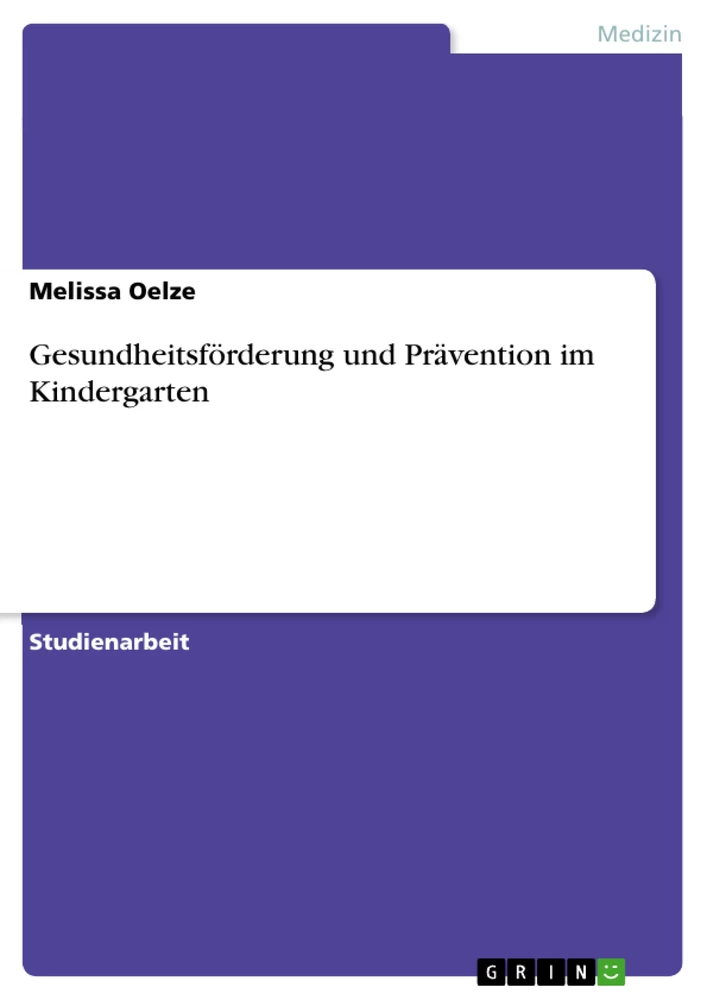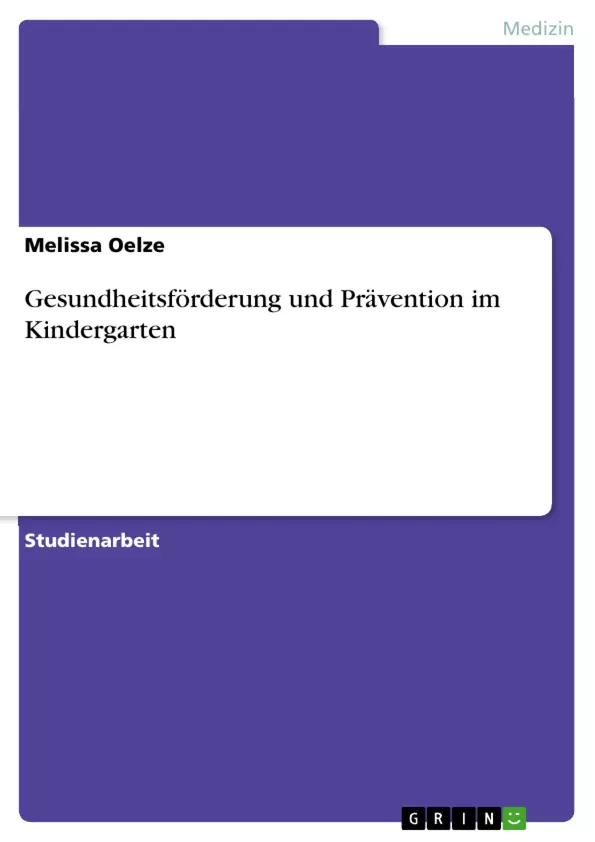Im Setting Kindergarten wird eine Analyse durchgeführt und auf Basis der Ergebnisse ein praxisrelevanter Handlungsansatz zur Gesundheitsförderung konzipiert. Hierbei liegt der Fokus auf den Erzieherinnen und den Kindern.
Inhaltsverzeichnis
- ANALYSE DER AUSGANGSSITUATION...
- Rahmenbedingungen.....
- Personengruppen im gewählten Setting...
- Analyse gesundheitsbezogener Daten.....
- Gesundheitsbezogene Daten für Erzieherinnen und Erzieher
- Gesundheitsbezogene Daten der Kinder
- Ableitung von Handlungsschwerpunkten........
- SCHWERPUNKTTHEMA FÜR EIN PROJEKT ZUR GESUNDHEITS- FÖRDERUNG IM GEWÄHLTEN SETTING
- RECHERCHE MODELLPROJEKT.……………………
- LITERATURVERZEICHNIS………………………………...
- ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....
- Tabellenverzeichnis.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Ausgangssituation einer Kindertageseinrichtung und identifiziert relevante Handlungsansätze zur Gesundheitsförderung. Der Fokus liegt dabei auf den spezifischen Bedürfnissen der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder, die sich in dieser Einrichtung befinden. Ziel ist es, den aktuellen Gesundheitszustand der beiden Personengruppen zu analysieren und daraus konkrete Handlungsschwerpunkte für ein mögliches Projekt zur Gesundheitsförderung zu entwickeln.
- Analyse der Rahmenbedingungen und Personengruppen in der Kindertageseinrichtung
- Bewertung von gesundheitsbezogenen Daten der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder
- Identifizierung von Handlungsschwerpunkten zur Gesundheitsförderung im Setting
- Entwicklung eines Projektkonzepts für die Gesundheitsförderung in der Kindertageseinrichtung
- Relevanz von Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Analyse der Ausgangssituation in der Kindertageseinrichtung. Es werden die Rahmenbedingungen, die beteiligten Personengruppen und die relevanten gesundheitsbezogenen Daten betrachtet.
Im zweiten Kapitel werden die Handlungsschwerpunkte für ein Projekt zur Gesundheitsförderung im gewählten Setting abgeleitet. Diese Schwerpunkte basieren auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen und berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Kinder.
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, Kindertageseinrichtung, Erzieherinnen, Kinder, Handlungsschwerpunkte, Projekt, Gesundheitsbezogene Daten, Analyse, Rahmenbedingungen, Setting, Lebenswelten
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Gesundheitsförderung im Kindergarten wichtig?
Der Kindergarten ist ein zentrales Setting, um frühzeitig gesunde Lebensweisen bei Kindern zu etablieren und die Arbeitskraft der Erzieher zu erhalten.
Welche Belastungen haben Erzieherinnen im Alltag?
Häufige Belastungen sind Lärm, ergonomisch ungünstige Arbeitshaltungen sowie psychischer Stress durch hohe Verantwortung und Zeitdruck.
Wie werden gesundheitsbezogene Daten im Setting analysiert?
Durch die Auswertung von Krankheitsständen, Befragungen und Beobachtungen der Rahmenbedingungen in der Einrichtung.
Was sind typische Handlungsschwerpunkte für Kinder?
Schwerpunkte liegen oft in den Bereichen gesunde Ernährung, ausreichende Bewegung und Förderung der psychischen Resilienz.
Was versteht man unter dem Begriff „Setting-Ansatz“?
Gesundheitsförderung setzt direkt in der Lebenswelt der Menschen an (hier der Kindergarten), um Strukturen und Verhalten nachhaltig zu verbessern.
- Quote paper
- Melissa Oelze (Author), 2017, Gesundheitsförderung und Prävention im Kindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358886