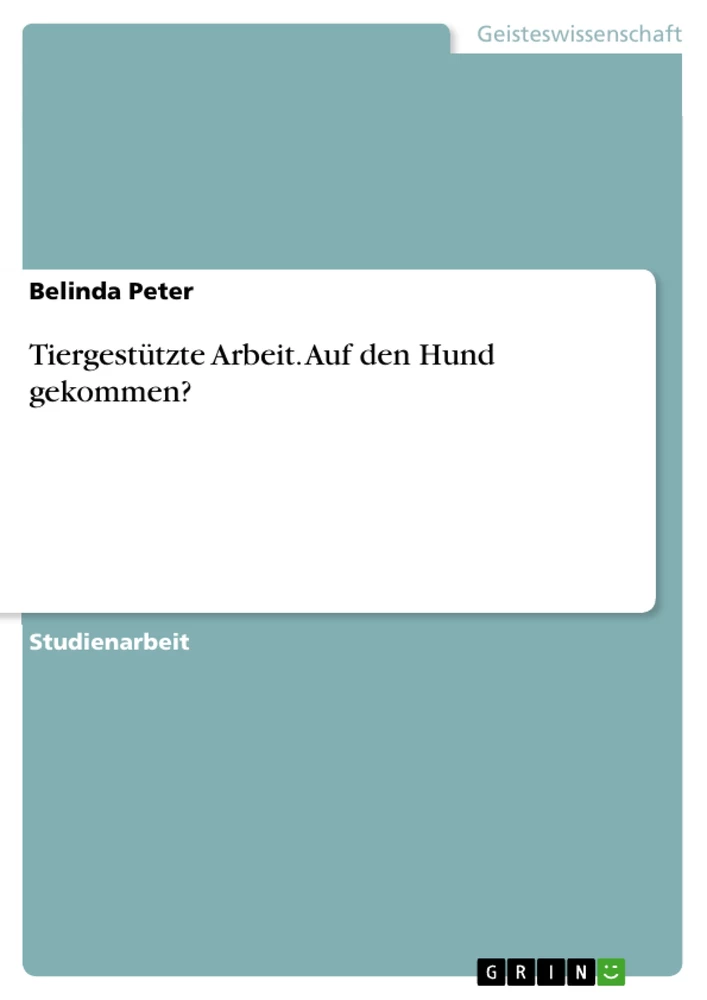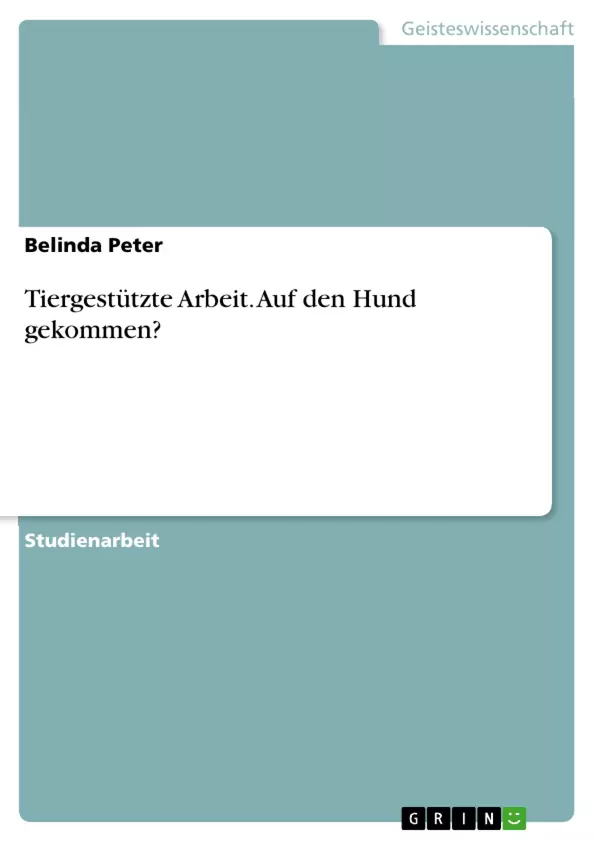In dieser Arbeit möchte ich einen Einblick geben, welche Wirkung und welchen Einfluss Tiere auf uns Menschen haben. Im Vordergrund steht hier die Mensch-Tier-Beziehung insbesondere als Familienmitglied. Doch wie und warum kam der Mensch eigentlich zum Tier? Und was ist eigentlich dran, an der These, der Affe sei dem Mensch am nächsten?
Tiere begleiten uns in vielen Bereichen unseres Lebens und sind mittlerweile in fast allen gesellschaftlichen Bereichen präsent. Knapp 8,2 Millionen Katzen und 5,3 Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Tiere sind für uns heute verlässliche Arbeitskollegen, authentisches Kumpantier, Ersatz für vermisste menschliche Beziehungen oder elementarer Nahrungsbestandteil.
Tiere faszinieren uns in Naturfilmen durch ihre Überlebensstrategien oder auch als animierte Kunstfiguren und Akteure in Kinderfilmen. Weit darüber hinaus sind sie eine wahrhaftige Hilfe unserer Forschung. Menschen beobachten schon lange tierische Fähigkeiten und versuchen, diese mithilfe der Technik für sich nutzbar zu machen. Beispielsweise die Dynamik des Fliegens oder unter Wasser die Art und Weise der Fortbewegung. Das aus der Natur gewonnene Wissen für den Menschen zu entdecken und so umzustrukturieren, dass es für uns selbst nutzbar wird, ist mit Abstand eine der größten Errungenschaften der Menschheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie alles begann...
- Pat Facilitated Therapy
- Domestikation - Leben neben dem Menschen oder mit ihm?
- Erste Züge der tiergestützten Heilung und Erziehung
- Die Intelligenz von Hunden und unser Art mit ihnen zu kommunizieren
- Chaser the Border Collie
- Die Begabungen des Hundes, den Mensch zu verstehen
- Einfluss eines Tieres auf die zwischenmenschlichen Begegnungen
- Einfluss eines Tieres auf die Gesundheit des Menschen
- Hund oder Katze - Welcher Typ sind Sie?...
- Wahrnehmung eines Hundes von Hypoglykämie beim Menschen
- Der Einfluss des Haustieres bei Depression
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der vielseitigen Beziehung zwischen Mensch und Tier und beleuchtet den Einfluss von Tieren auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Mensch-Tier-Beziehung im familiären Kontext und der Bedeutung tiergestützter Arbeit, speziell im Hinblick auf die Kommunikation zwischen Mensch und Hund.
- Entwicklung und Historie der tiergestützten Arbeit
- Kognitive Fähigkeiten von Hunden und ihre Fähigkeit zur Kommunikation mit Menschen
- Positive Auswirkungen von Tieren auf die menschliche Gesundheit, insbesondere bei Depressionen und Diabetes
- Der Einsatz von Tieren in der Therapie und Pädagogik
- Die Rolle von Tieren in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung bietet einen Überblick über die vielfältige Rolle von Tieren in unserem Leben und die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung. Sie stellt die zentralen Themen der Arbeit vor, darunter die Entstehung der tiergestützten Arbeit, die Kommunikation mit Hunden und der Einfluss von Tieren auf die Gesundheit des Menschen.
- Wie alles begann...: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der tiergestützten Arbeit. Es beschreibt die frühen Anwendungsgebiete von Tieren in der Therapie und die Entstehung des Begriffs "pet facilitated therapy".
- Die Intelligenz von Hunden und unser Art mit ihnen zu kommunizieren: Der Abschnitt beschäftigt sich mit den kognitiven Fähigkeiten von Hunden und deren Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren. Es werden Beispiele wie Chaser the Border Collie genannt und der Einfluss von Tieren auf zwischenmenschliche Begegnungen erläutert.
- Einfluss eines Tieres auf die Gesundheit des Menschen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Haustieren auf die menschliche Gesundheit, mit besonderem Fokus auf die Wahrnehmung von Hypoglykämie bei Diabetikern und den Einfluss von Haustieren auf die Behandlung von Depressionen.
Schlüsselwörter
Mensch-Tier-Beziehung, tiergestützte Arbeit, Kommunikation, Hunde, Gesundheit, Depression, Diabetes, Pat Facilitated Therapy, Therapie, Pädagogik, Sozialwesen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Pat Facilitated Therapy“?
Es handelt sich um eine Form der tiergestützten Therapie, bei der Haustiere gezielt eingesetzt werden, um Heilungsprozesse und die Erziehung zu unterstützen.
Warum sind Hunde besonders gut für die Kommunikation mit Menschen geeignet?
Hunde besitzen die besondere Begabung, menschliche Gestik und Mimik zu verstehen und darauf zu reagieren, was sie zu idealen Partnern im Sozialwesen macht.
Wie können Hunde Menschen mit Diabetes helfen?
Speziell ausgebildete Hunde können eine Hypoglykämie (Unterzuckerung) beim Menschen wahrnehmen und ihren Besitzer rechtzeitig warnen.
Welchen Einfluss haben Tiere auf Menschen mit Depressionen?
Tiere wirken oft als „Eisbrecher“, spenden Trost, mindern das Gefühl der Einsamkeit und können die soziale Interaktion sowie die Tagesstruktur fördern.
Was bedeutet „Bionik“ im Zusammenhang mit Tieren?
Menschen nutzen tierische Fähigkeiten (z. B. Fliegen oder Fortbewegung unter Wasser) und versuchen, diese durch Technik für den menschlichen Gebrauch nutzbar zu machen.
- Quote paper
- Belinda Peter (Author), 2017, Tiergestützte Arbeit. Auf den Hund gekommen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365346