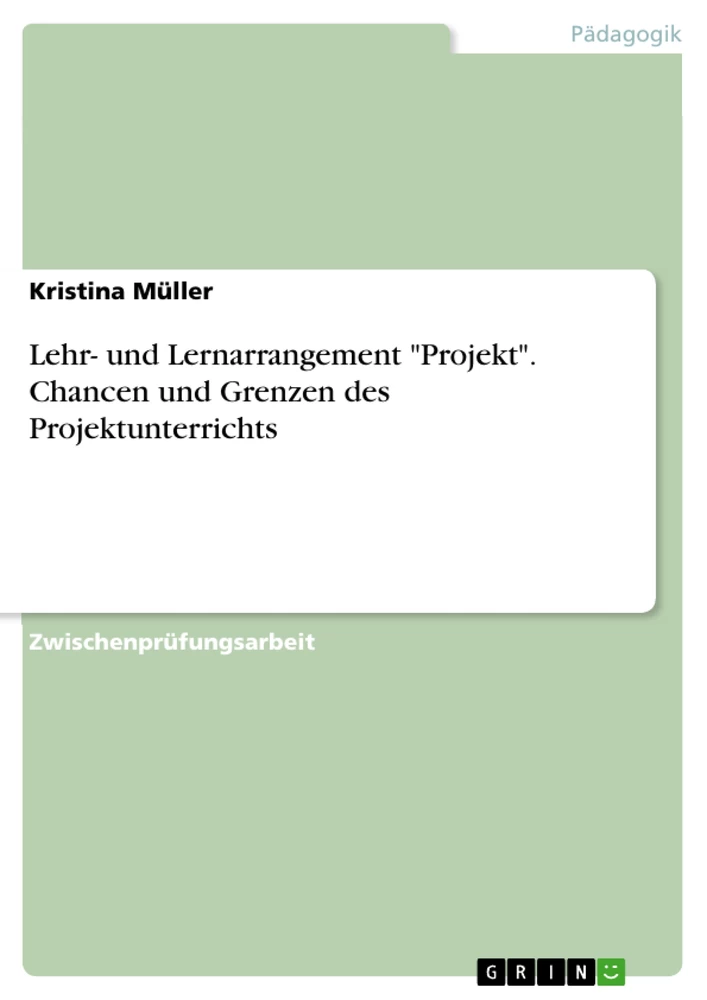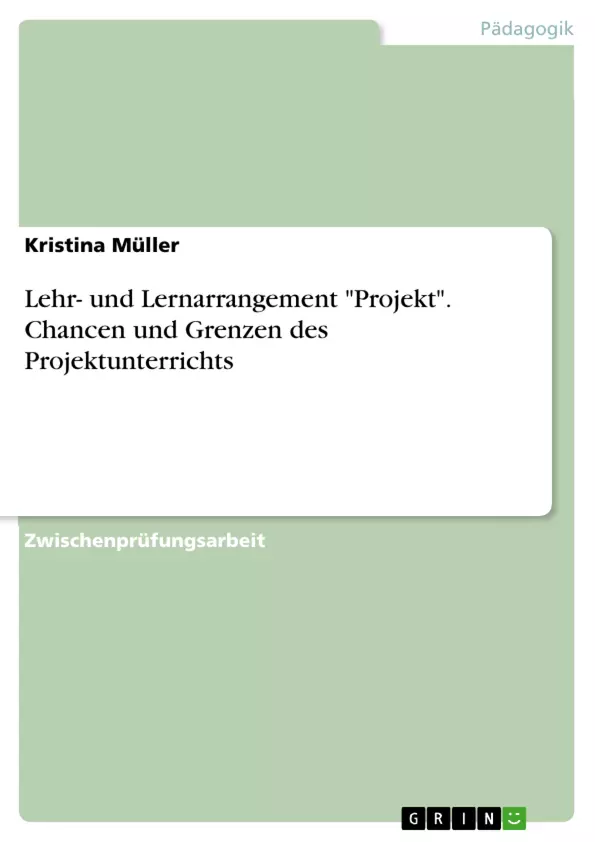Der Begriff „Projekt“ hat seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „projicere“, was so viel bedeutet wie „entwerfen, planen, sich vornehmen“. Er findet in vielen Sparten Anwendung und erhält, je nach Fachgebiet, meist eine individuelle Note in der Begriffsdefinition.
Im schulischen Kontext wird die Projektmethode oft als Lückenfüller vor den Sommerferien degradiert. Dementgegen wertet Meyer das Projekt als „eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Formen methodischen Handelns“.
Letztlich bleibt es der Lehrkraft (L.) selbst überlassen, mit welchen Methoden er oder sie im jeweiligen Schuljahr arbeiten möchte. Allgemein bekannt ist jedoch auch wie knapp bemessen die Zeit innerhalb einer solche Jahresplanung, für die im Bildungsplan festgelegten Inhalte, oftmals ist. Daher ist die Evaluation der verschiedenen Methoden im Vorfeld essentiell, um eine effiziente Planung durchführen zu können.
Die folgende Arbeit soll als kurze Handreichung dienen, um sich mit dem Begriff des „Projektunterrichts“ vertraut zu machen. Es wird zunächst ein kleiner Einblick in die diversen Definitionen des Wortes „Projekt“ gegeben. Weiterhin ist die Projektarbeit ein wichtiger Bestandteil des offenen Unterrichts und findet daher ihre Anwendung auch in unterschiedlichen Dimensionen. Diese kurz zu skizzieren und gegenüberzustellen ist Aufgabe des in Kapitel 3 beschriebenen Sachverhalts. Nachfolgend wird auf die zehn Merkmale nach Gudjons eingegangen. Der idealtypische Ablauf, nach Freys sieben Komponenten, gewährt weiterführend einen groben Überblick zu den einzelnen Schritten. Nachfolgend soll eine kurze Diskussion darüber Aufschluss geben, ob und inwiefern eine Leistungsbewertung für diese Unterrichtsform erfolgen kann. Im letzten Kapitel werden dann die nicht nur in der Fachliteratur so vielfach gelobten Chancen der Methodik aufgeführt, sondern auch deren Grenzen beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diverse Ansätze zur Begriffsdefinition „Projekt“
- Projektunterricht in Abgrenzung zu ähnlichen Unterrichtsmethoden
- Merkmale des Projektunterrichts nach Gudjons
- Idealtypischer Ablauf eines Projekts
- Leistungsbewertung im Projektunterricht
- Chancen und Grenzen der Projektmethode im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit soll einen Überblick über das Konzept des Projektunterrichts geben. Sie zielt darauf ab, den Begriff „Projekt“ zu definieren und die Projektmethode im Kontext von anderen Unterrichtsformen zu positionieren. Weiterhin werden die charakteristischen Merkmale des Projektunterrichts, die einzelnen Phasen des Ablaufs sowie die Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Fokus stehen. Abschließend werden die Chancen und Grenzen der Projektmethode im Unterricht diskutiert.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Projekt“
- Merkmale und Prinzipien des Projektunterrichts
- Der ideale Ablauf eines Projekts
- Leistungsbewertung in Projektphasen
- Potenziale und Herausforderungen des Projektunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Projekt“ ein und erläutert die Relevanz der Projektmethode im Bildungskontext. Es werden unterschiedliche Sichtweisen auf den Begriff „Projekt“ beleuchtet und die Ziele der vorliegenden Arbeit vorgestellt.
- Diverse Ansätze zur Begriffsdefinition „Projekt“: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen des Begriffs „Projekt“ aus unterschiedlichen Bereichen wie der Betriebswirtschaftslehre und dem Schulkontext. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Definitionen herausgestellt und die Besonderheiten des Begriffs im Bildungsbereich beleuchtet.
- Projektunterricht in Abgrenzung zu ähnlichen Unterrichtsmethoden: Dieses Kapitel behandelt die Abgrenzung des Projektunterrichts zu ähnlichen Unterrichtsformen wie dem fächerübergreifendem Unterricht, dem fächerverbindenden Unterricht oder dem handlungsorientierten Unterricht. Es werden die spezifischen Merkmale des Projektunterrichts im Vergleich zu anderen Methoden dargestellt.
- Merkmale des Projektunterrichts nach Gudjons: Dieses Kapitel stellt die zehn Merkmale des Projektunterrichts nach Gudjons vor. Es wird näher auf die einzelnen Merkmale eingegangen und deren Bedeutung für die Umsetzung des Projektunterrichts erläutert.
- Idealtypischer Ablauf eines Projekts: Dieses Kapitel behandelt den idealtypischen Ablauf eines Projekts anhand der sieben Komponenten nach Frey. Die einzelnen Phasen des Projektablaufs werden beschrieben und ihre Bedeutung für den Erfolg des Projekts hervorgehoben.
- Leistungsbewertung im Projektunterricht: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, inwiefern eine Leistungsbewertung im Projektunterricht sinnvoll ist. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Leistungsbewertung in Projektphasen vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des Projektunterrichts und beleuchtet verschiedene Aspekte dieser Unterrichtsform. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen: Projektdefinition, Projektmethoden, Projektunterricht, Merkmale des Projektunterrichts, Projektphasen, Leistungsbewertung, Chancen und Grenzen der Projektmethode, Gudjons, Frey, offener Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Projektunterricht?
Projektunterricht ist eine handlungsorientierte Lehrmethode, bei der Schüler ein Thema eigenständig planen, bearbeiten und die Ergebnisse präsentieren.
Was sind die Merkmale nach Gudjons?
Gudjons nennt zehn Merkmale, darunter Situationsbezug, Selbstorganisation, Interdisziplinarität und Produktorientierung.
Wie läuft ein Projekt idealerweise ab?
Nach Frey umfasst ein Projekt sieben Komponenten: von der Projektschulung und Initiative über die Planung bis zur Durchführung und zum Abschluss.
Kann man Leistungen im Projektunterricht bewerten?
Ja, allerdings erfordert dies neue Bewertungsformen, die nicht nur das Endprodukt, sondern auch den Prozess und die Teamarbeit berücksichtigen.
Was sind die Grenzen dieser Methode?
Grenzen sind der hohe Zeitaufwand, die Schwierigkeit der Stoffabdeckung laut Lehrplan und die hohen Anforderungen an die Selbstdisziplin der Schüler.
- Quote paper
- Kristina Müller (Author), 2016, Lehr- und Lernarrangement "Projekt". Chancen und Grenzen des Projektunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/365976