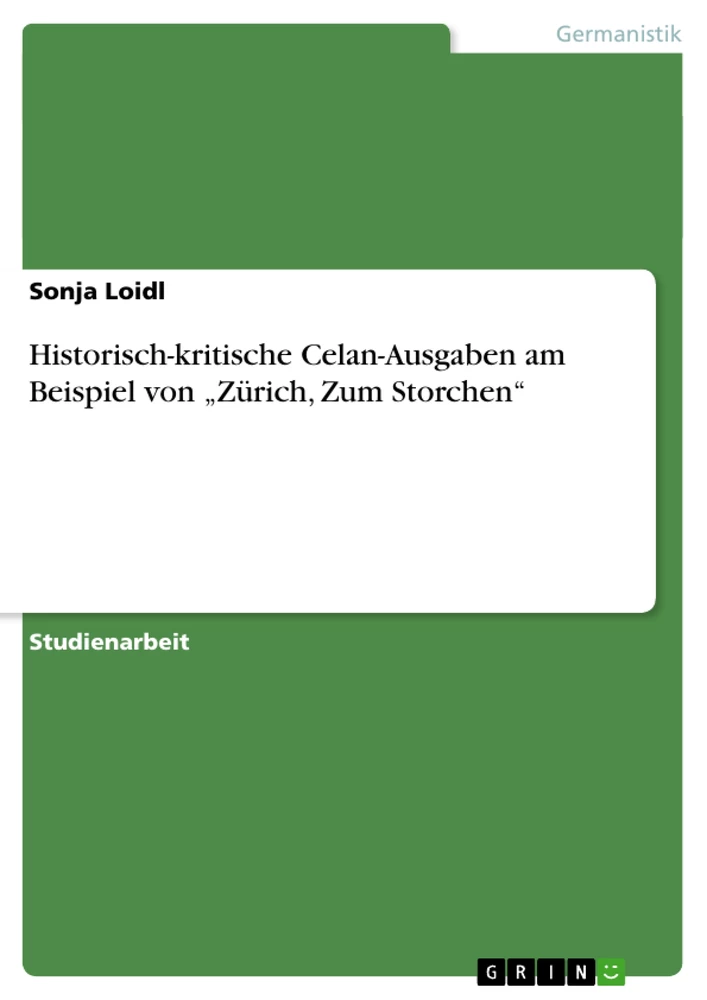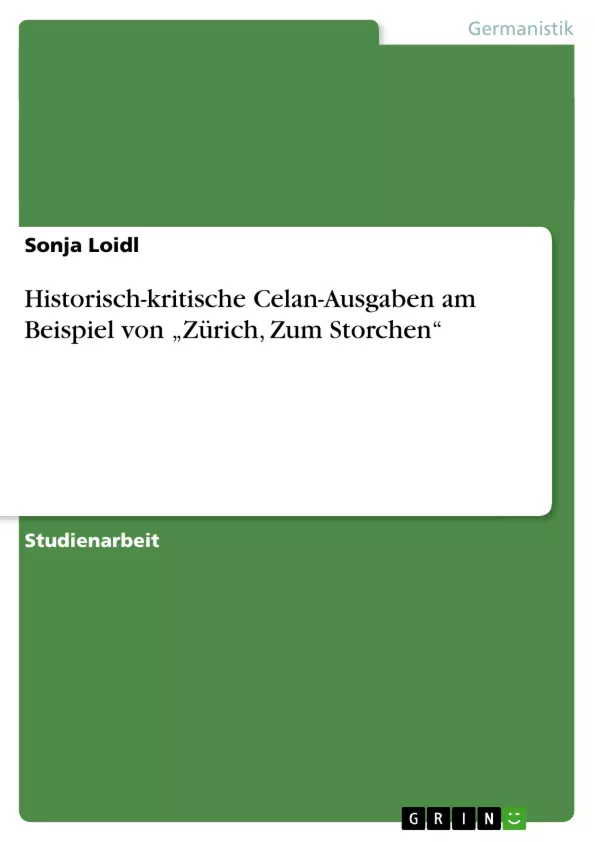Die vorliegende Untersuchung nimmt einen Vergleich zweier historisch-kritischer Celan-Ausgaben am Beispiel des Gedichtes „Zürich, Zum Storchen“ vor: Die Tübinger Ausgabe und die Bonner Ausgabe.
Das Konzept der Tübinger Ausgabe besteht aus Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit für den Leser. Der Akzent liegt auf Anschaulichkeit und nicht auf „photographischer Objektivität“ , wobei die Art der Eingriffe im Vorwort erläutert wird.
Die Bände erschienen aufeinander folgend, allerdings sind sie nicht Celans Werkchronologie
entsprechend geordnet.
Die Reihenfolge der Bände entspricht im Fall der Bonner Ausgabe der Werkchronologie. Allerdings sind die Bände nicht ihrer Reihenfolge nach erschienen. Bislang liegt kein Band zur Büchner-Preis-Rede vor. Daher sind die Anforderungen an alle Bände in etwa dieselben.
Die diakritischen Zeichen der Tübinger Ausgabe sind eindeutiger, wenn auch sie ebenfalls nicht alle Zweideutigkeiten vermeiden können.
Die Darstellung der Bonner Ausgabe ist wissenschaftlich genauer und vollständiger als die der Tübinger Ausgabe. Allerdings sind die diakritischen Zeichen nicht immer eindeutig und in mancher Hinsicht muss der Leser ein Suchspiel veranstalten, um die eine oder andere Unklarheit zu beseitigen.
Ein „Pluspunkt“ der Tübinger Ausgabe ist die Beigabe von ausgewählten Faksimiles,
während die detaillierte Beschreibung von Zeugengruppen die Bonner Ausgabe positiv hervorhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Niemandsrose
- Celans Arbeitsweise
- Die Tübinger Celan-Ausgabe
- Die Bände
- Die Bonner Celan-Ausgabe
- Vergleich
- Zürich, Zum Storchen
- Zusammenfassung
- Anhang
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich einer umfassenden Analyse der historisch-kritischen Ausgaben von Paul Celans Gedichten, speziell am Beispiel des Gedichts „Zürich, Zum Storchen“. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Herangehensweisen und Ergebnisse der Tübinger und Bonner Ausgaben aufzuzeigen und so einen Einblick in die komplexen Herausforderungen der Edition von Celans Werk zu gewinnen.
- Die Herausforderungen der Edition von Celans Werk
- Die Arbeitsweise Celans und deren Auswirkungen auf die Edition
- Vergleich der Tübinger und Bonner Celan-Ausgaben
- Die Bedeutung von „Zürich, Zum Storchen“ im Gesamtwerk Celans
- Die Rolle von Celans Textzeugen und Entwürfen für die Editionsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Zur Niemandsrose: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in den Gedichtband „Die Niemandsrose“, der das Gedicht „Zürich, Zum Storchen“ beinhaltet. Es werden die Entstehungszeit, die Struktur und die Konzeption des Bandes erläutert.
- Celans Arbeitsweise: Dieses Kapitel beleuchtet die Arbeitsweise Celans, insbesondere seine intensive Auseinandersetzung mit der Textgestalt und seine vielfältigen Arbeitsmaterialien. Es wird deutlich, dass die Bearbeitung seiner Manuskripte und Entwürfe eine besondere Herausforderung für die Editionsarbeit darstellt.
- Die Tübinger Celan Ausgabe: In diesem Kapitel wird die Tübinger Celan Ausgabe vorgestellt, einschließlich ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Struktur und ihrer wichtigsten Merkmale. Die Ausgabe basiert auf der Edition von Beda Allemann und Stefan Reichert von „Die Niemandsrose“ aus dem Jahr 1983.
Schlüsselwörter
Paul Celan, „Die Niemandsrose“, „Zürich, Zum Storchen“, historisch-kritische Ausgabe, Tübinger Ausgabe, Bonner Ausgabe, Textgenese, Textzeugen, Entwürfe, Editionsarbeit, Arbeitsweise, Textgestalt, Zeilenumbruch, graphische Anordnung, Lehrstellen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die Tübinger von der Bonner Celan-Ausgabe?
Die Tübinger Ausgabe setzt auf Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit für den Leser, während die Bonner Ausgabe wissenschaftlich genauer und vollständiger in der Dokumentation der Textzeugen ist.
Warum ist die Edition von Paul Celans Werk so schwierig?
Celan arbeitete sehr intensiv an der Textgestalt, hinterließ viele Entwürfe und legte großen Wert auf die graphische Anordnung und Zeilenumbrüche, was hohe Anforderungen an die Editorik stellt.
Worum geht es in dem Gedicht „Zürich, Zum Storchen“?
Es ist ein zentrales Gedicht aus dem Band „Die Niemandsrose“, das oft im Kontext von Celans Begegnung mit Nelly Sachs und seiner Auseinandersetzung mit jüdischer Identität interpretiert wird.
Welchen Vorteil bieten Faksimiles in der Tübinger Ausgabe?
Sie erlauben es dem Leser, die handschriftliche Entstehung und die physische Gestalt von Celans Entwürfen direkt nachzuvollziehen.
Wie gehen die Ausgaben mit Celans Chronologie um?
Die Bonner Ausgabe folgt strikt der Werkchronologie, während die Bände der Tübinger Ausgabe nicht zwingend in der chronologischen Reihenfolge der Entstehung erschienen sind.
- Quote paper
- Sonja Loidl (Author), 2005, Historisch-kritische Celan-Ausgaben am Beispiel von „Zürich, Zum Storchen“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36677