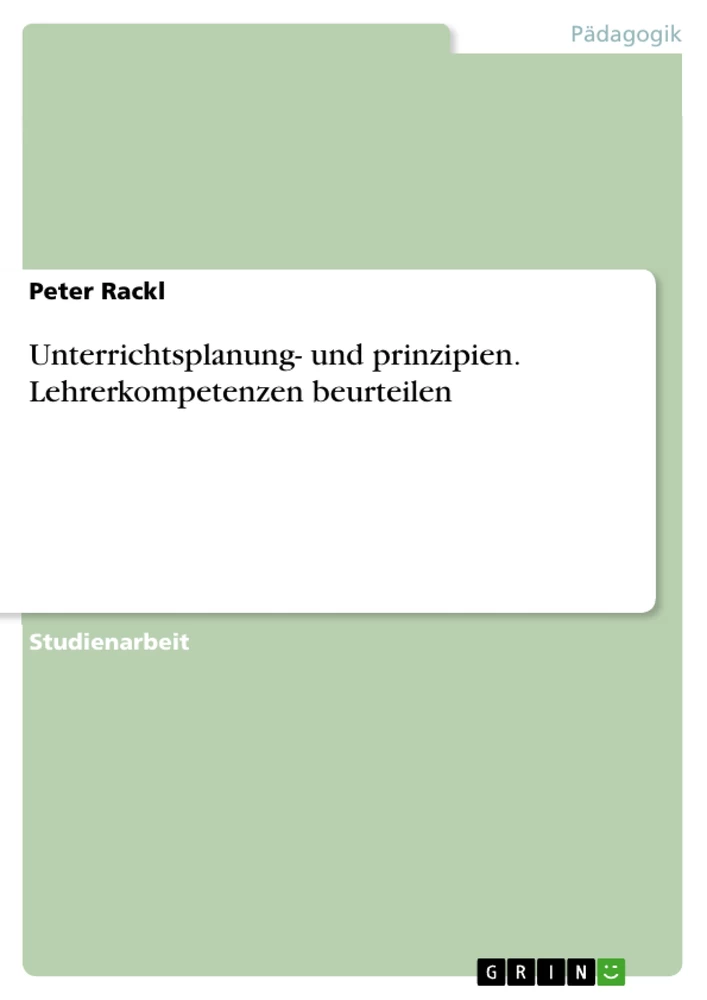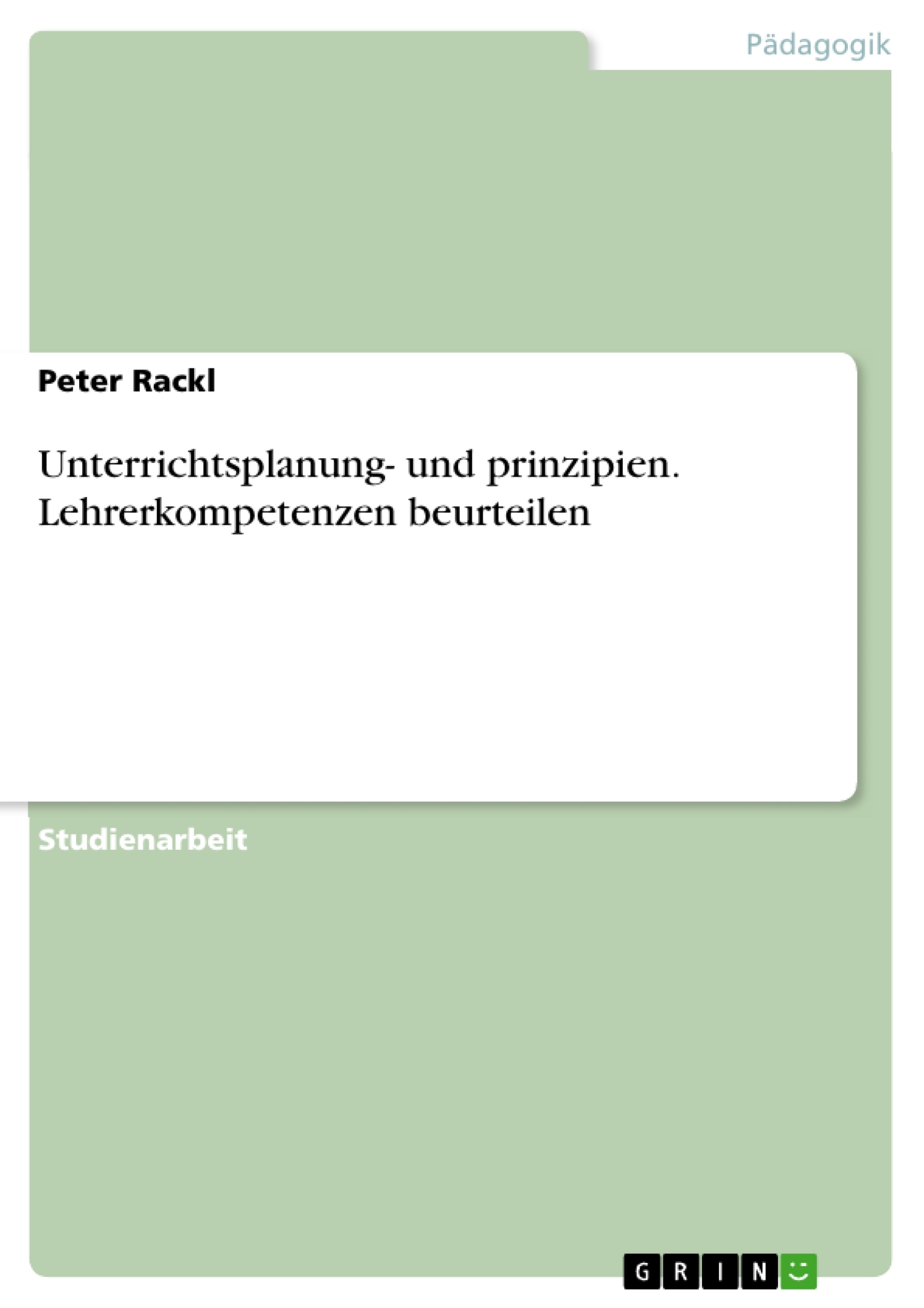Bei den Behandelten Themengebiet der Hausarbeit handelt es sich um „Unterrichtsplanung – Lehrerkompetenz Beurteilen – Unterrichtsprinzipien“. Zunächst wird auf die Unterrichtsplanung eingegangen. Dieses Thema wird als erstes gewählt, da die Lehrkraft auch am Vortag zunächst seinen Unterricht planen muss und dies den ersten Schritt des Unterrichts darstellt. Um also eine logische Abfolge der Themen zu garantieren wird mit diesen Teilbereich der Hausarbeit beginnen. Um die chronologische Reihenfolge beizubehalten folgt nun als zweiter Bereich die Beurteilung der Lehrerkompetenz. Nun folgen die Unterrichtsprinzipien. Gegliedert in allgemeine Begrifflichkeiten und konstitutive bzw. methodische Prinzipien.
Als Unterrichtsplanung oder Unterrichtsvorbereitung werden alle dem Unterricht vorausgehenden Maßnahmen bezeichnet, die das Lehren und Lernen im Unterricht selbst optimieren sollen. Da das Unterrichten eine zentrale Lehrerkompetenz ausmacht, muss jeder angehende Lehrer in der Lage sein, Unterricht selbstständig zu planen und schließlich auch dieses Schema durchzuführen und zu kontrollieren. Beginnt man sich als Lehrkraft an die Unterrichtplanung zu machen, erkennt man schnell die Vielfalt der Möglichkeiten Unterricht zu gestalten, aber auch, dass keine Methode allein effektiven Unterricht ausmacht. Ebenso muss man sich im Voraus klar darüber sein, dass eine sorgfältige Planung nicht immer aufgehen muss, sondern durch unerwartete Prozesse im Unterrichtsverlauf ins Wanken geraten kann. Für eine gute Planung sind deshalb Alternativen unablässig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teilbereiche der Arbeit
- Unterrichtsplanung
- Lehrerkompetenz Beurteilen
- Unterrichtsprinzipien
- Allgemeine Begrifflichkeit
- Konstitutive Unterrichtsprinzipien
- Prinzipien der methodischen Gestaltung des Unterrichts
- Zusammenhang der einzelnen Teilbereiche
- Reflexion des eigenen erfolgten Lernprozess
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themengebieten Unterrichtsplanung, Lehrerkompetenz Beurteilen und Unterrichtsprinzipien. Ziel ist es, diese drei Bereiche in ihrem Zusammenhang zu beleuchten und deren Bedeutung für die Gestaltung effektiven Unterrichts zu analysieren. Dabei werden die jeweiligen Konzepte und Prinzipien vorgestellt und anhand von Beispielen illustriert.
- Die Bedeutung von Unterrichtsplanung für die Gestaltung effektiven Unterrichts
- Die verschiedenen Aspekte der Lehrerkompetenz Beurteilen und deren Relevanz für die Lehrerausbildung
- Die verschiedenen Kategorien von Unterrichtsprinzipien und deren Anwendung in der Praxis
- Der Zusammenhang zwischen den drei Teilbereichen und deren Bedeutung für die Qualität des Unterrichts
- Die Reflexion des eigenen Lernprozesses im Kontext der behandelten Themen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die drei Themenbereiche der Hausarbeit vor: Unterrichtsplanung, Lehrerkompetenz Beurteilen und Unterrichtsprinzipien. Es wird die Relevanz der Themen für die Lehrerausbildung und die Praxis des Unterrichts beleuchtet.
2. Teilbereiche der Arbeit
2.1 Unterrichtsplanung
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Unterrichtsplanung und erläutert die Bedeutung der Planung für effektiven Unterricht. Es werden verschiedene Planungsgrundsätze und Modelle vorgestellt, sowie die Rolle der Schülerbeteiligung bei der Planung hervorgehoben.
2.2 Lehrerkompetenz Beurteilen
Der zweite Teilbereich widmet sich der Lehrerkompetenz Beurteilen. Es werden die verschiedenen Bereiche der Beurteilung, wie z.B. die Leistungsbeurteilung von Schülern, betrachtet und verschiedene Bezugsnorm-Modelle vorgestellt. Zudem werden die Bedeutung von Gütekriterien bei der Beurteilung von Tests und die Rolle der Beurteilung für die Qualität des Unterrichts betont.
2.3 Unterrichtsprinzipien
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Kategorien von Unterrichtsprinzipien. Es werden die allgemeine Begrifflichkeit, konstitutive Prinzipien und Prinzipien der methodischen Gestaltung des Unterrichts vorgestellt.
3. Zusammenhang der einzelnen Teilbereiche
Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen den drei Teilbereichen Unterrichtsplanung, Lehrerkompetenz Beurteilen und Unterrichtsprinzipien. Es wird gezeigt, wie die einzelnen Bereiche miteinander verzahnt sind und gemeinsam zur Gestaltung effektiven Unterrichts beitragen.
4. Reflexion des eigenen erfolgten Lernprozesses
In diesem Kapitel reflektiert der Autor seinen eigenen Lernprozess im Kontext der Hausarbeit. Es werden die Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen zusammengefasst und die Relevanz für die eigene zukünftige Tätigkeit als Lehrer beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Unterrichtsplanung, Lehrerkompetenz, Beurteilen, Unterrichtsprinzipien, Didaktik, Lernziele, Methoden, Unterrichtsmittel, Interaktion, Kommunikation, Leistungsbeurteilung, Bezugsnorm, Gütekriterien, Effektivität, Qualität, Gestaltung, Reflexion.
- Arbeit zitieren
- Peter Rackl (Autor:in), 2010, Unterrichtsplanung- und prinzipien. Lehrerkompetenzen beurteilen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/367222