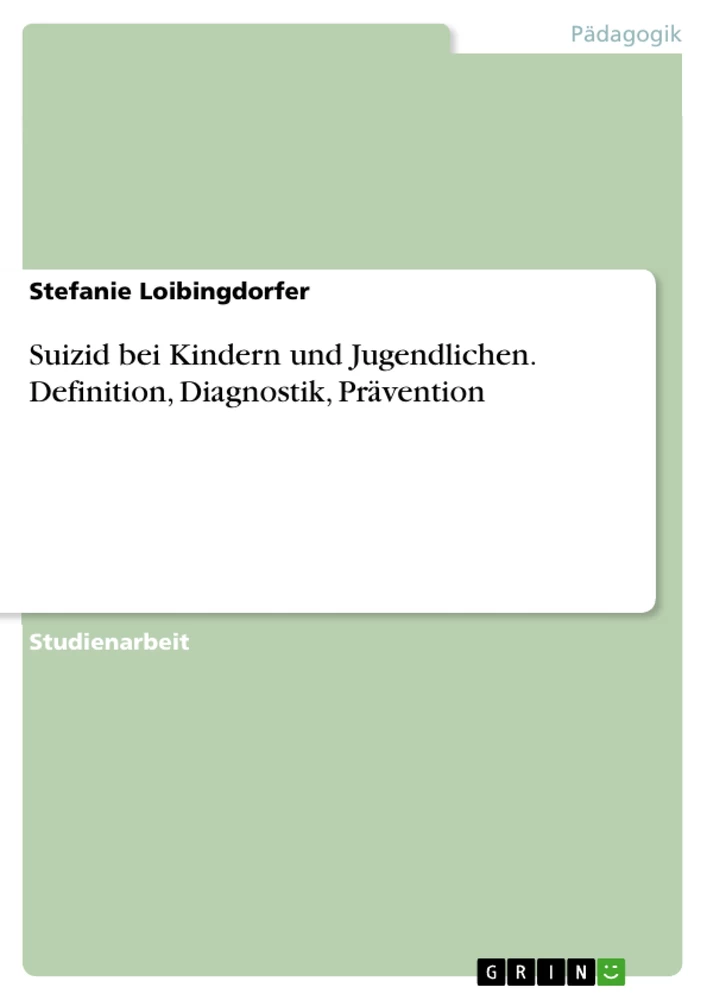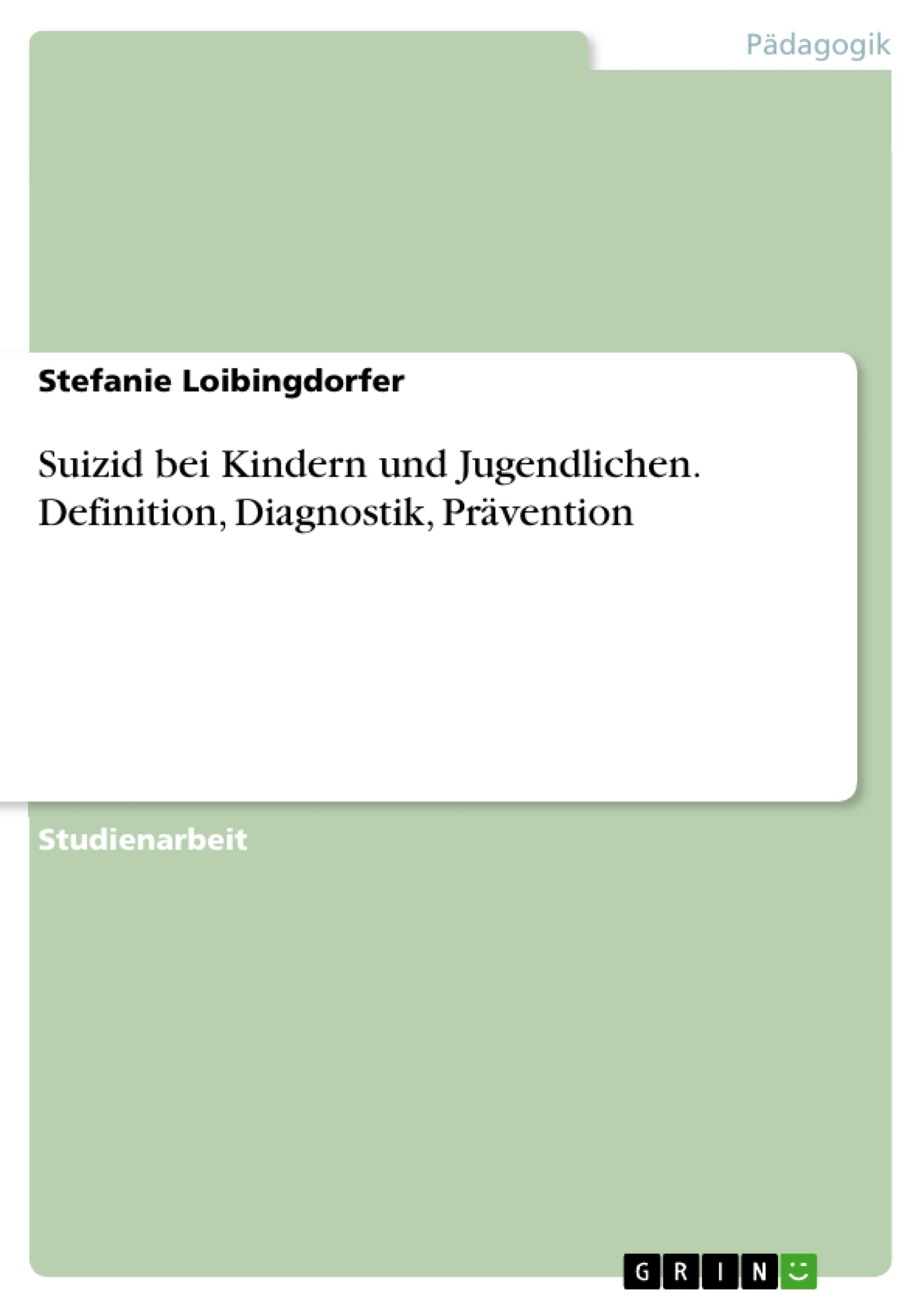Diese Arbeit ist inhaltlich in zwei Großkapitel unterteilt. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, was unter Suizid verstanden wird, sowie mit der gesellschaftlichen Sichtweise diesem Thema gegenüber. Außerdem werden die statistische Häufigkeit von Suiziden, die verwendeten Formen, die Psychodynamik und Ursachen, als auch der Verlauf eines Suizidversuches bzw. Suizides behandelt. Das zweite Kapitel widmet sich der Diagnostik, den Hilfen und der Prävention im sozialpädagogischen Rahmen. Den Abschluss der Seminararbeit bildet eine Reflexion mit persönlicher Stellungnahme.
Das Thema "Suizid" ist in unserer heutigen Gesellschaft allgegenwärtig. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um ein "modernes" Phänomen, sondern es kam bereits in früheren Zeiten oft zu Selbsttötungen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Kronprinz Rudolf von Österreich, der sich vermutlich mit seiner Stellung als Thronfolger und den damit verbundenen Erwartungen an seine Person nicht identifizieren konnte und aus diesem Grund den Freitod wählte. Selbigen Entschluss fasste wahrscheinlich auch der berühmte russische Komponist Peter Iljitsch Tschaikowski, der sich angeblich aufgrund seiner Homosexualität das Leben genommen haben soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines
- 1.1 Begriffsdefinition „Suizid“ und Abgrenzung
- 1.2 Suizid in unserer Gesellschaft
- 1.3 Häufigkeit verübter Selbsttötungen
- 1.4 Formen der Suizidalität
- 1.5 Psychodynamik und Ursachen
- 1.6 Verlauf eines Suizidversuches bzw. Suizides
- 2. Diagnostik, Hilfen und Prävention im sozialpädagogischen Rahmen
- 2.1 Diagnostik suizidaler Tendenzen
- 2.2 Pädagogische Hilfen
- 2.3 Suizidprävention
- 3. Reflexion und persönliche Stellungnahme
- 4. Quellenverzeichnis
- 4.1 Literaturquellen
- 4.2 Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Suizid bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, einen Überblick über die Thematik zu geben, von der Begriffsdefinition über die gesellschaftlichen Aspekte und Häufigkeit bis hin zu diagnostischen Möglichkeiten und präventiven Maßnahmen im sozialpädagogischen Kontext. Die Arbeit verzichtet auf eine umfassende Darstellung der Ursachen und konzentriert sich auf einen pragmatischen Zugang zu Hilfsmöglichkeiten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Suizid
- Soziokulturelle Aspekte und die Geschichte des Suizids
- Statistische Daten zur Häufigkeit von Suiziden bei Kindern und Jugendlichen
- Methoden und Formen suizidaler Handlungen
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in das Thema Suizid. Es beginnt mit der Definition des Begriffs "Suizid" und grenzt ihn von ähnlichen Konzepten wie Suizidalität und Parasuizid ab. Der historische und gesellschaftliche Kontext des Suizids wird beleuchtet, wobei Beispiele aus der Geschichte (z.B. Kronprinz Rudolf) und Literatur (z.B. "Die Leiden des jungen Werthers") die Vielschichtigkeit der Ursachen verdeutlichen. Die häufige Tabuisierung des Themas und die damit verbundenen Schwierigkeiten für Betroffene und Angehörige werden ebenfalls angesprochen. Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansichten und die historische Rolle der Kirche in der Wahrnehmung von Suizid werden diskutiert.
1.3 Häufigkeit verübter Selbsttötungen: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit von Suiziden in Österreich, mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Es hebt die Geschlechterunterschiede hervor und zeigt, dass Suizid bei Männern deutlich häufiger vorkommt. Die Altersabhängigkeit der Suizidrate wird detailliert dargestellt, mit einer klaren Unterscheidung zwischen Suiziden bei Kindern unter zehn Jahren (relativ selten) und Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren (deutlich höher). Der Rückgang der Suizidrate in den letzten Jahrzehnten wird erwähnt und mit verbesserten Hilfesystemen in Verbindung gebracht.
1.4 Formen der Suizidalität: In diesem Abschnitt werden die unterschiedlichen Methoden der Selbsttötung dargestellt, wobei ein Schwerpunkt auf die Unterschiede zwischen den Methoden bei männlichen und weiblichen Jugendlichen gelegt wird. Männer greifen häufiger auf "härtere" Methoden zurück, während die im Text genannten Methoden bei Frauen nicht explizit erwähnt werden.
2. Diagnostik, Hilfen und Prävention im sozialpädagogischen Rahmen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Aspekte der Diagnostik, der pädagogischen Hilfen und der Prävention von Suizid im sozialpädagogischen Bereich. Es werden wichtige diagnostische Instrumente und Methoden erwähnt. Weiterhin werden pädagogische Interventionsmöglichkeiten und präventive Strategien umrissen, ohne jedoch explizit auf konkrete Maßnahmen einzugehen.
Schlüsselwörter
Suizid, Suizidalität, Selbsttötung, Kinder, Jugendliche, Prävention, Diagnostik, Sozialpädagogik, Gesellschaft, Tabuisierung, Statistik, Österreich.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Suizid bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Suizid bei Kindern und Jugendlichen. Sie beinhaltet eine Einführung in den Begriff Suizid, seine gesellschaftlichen Aspekte, Häufigkeit, Diagnostik und präventive Maßnahmen im sozialpädagogischen Kontext. Der Fokus liegt auf einem pragmatischen Zugang zu Hilfsmöglichkeiten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Allgemeines (inkl. Begriffsdefinition, gesellschaftliche Aspekte, Häufigkeit, Formen der Suizidalität, Psychodynamik und Ursachen, Verlauf eines Suizidversuchs), 2. Diagnostik, Hilfen und Prävention im sozialpädagogischen Rahmen, 3. Reflexion und persönliche Stellungnahme und 4. Quellenverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung des Begriffs Suizid, soziokulturelle Aspekte und Geschichte des Suizids, statistische Daten zur Häufigkeit von Suiziden bei Kindern und Jugendlichen, Methoden und Formen suizidaler Handlungen sowie Möglichkeiten der Prävention und Intervention.
Welche statistischen Daten werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit von Suiziden in Österreich, mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Es werden Geschlechterunterschiede und die Altersabhängigkeit der Suizidrate detailliert dargestellt, inklusive eines Vergleichs zwischen Suiziden bei Kindern unter zehn Jahren und Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren. Der Rückgang der Suizidrate in den letzten Jahrzehnten wird ebenfalls thematisiert.
Wie werden die verschiedenen Formen der Suizidalität behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Selbsttötung und hebt Unterschiede zwischen den Methoden bei männlichen und weiblichen Jugendlichen hervor. Es wird darauf hingewiesen, dass Männer häufiger auf "härtere" Methoden zurückgreifen, während die Methoden bei Frauen nicht explizit genannt werden.
Wie wird der sozialpädagogische Kontext behandelt?
Kapitel 2 konzentriert sich auf die Diagnostik suizidaler Tendenzen, pädagogische Hilfen und Prävention im sozialpädagogischen Bereich. Es werden wichtige diagnostische Instrumente und Methoden erwähnt sowie pädagogische Interventionsmöglichkeiten und präventive Strategien umrissen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Suizid, Suizidalität, Selbsttötung, Kinder, Jugendliche, Prävention, Diagnostik, Sozialpädagogik, Gesellschaft, Tabuisierung, Statistik, Österreich.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich im HTML-Code der ursprünglichen Datei. Es umfasst detaillierte Unterpunkte zu jedem Kapitel.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet Kapitelzusammenfassungen, die die wesentlichen Inhalte jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Stefanie Loibingdorfer (Author), 2016, Suizid bei Kindern und Jugendlichen. Definition, Diagnostik, Prävention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368026