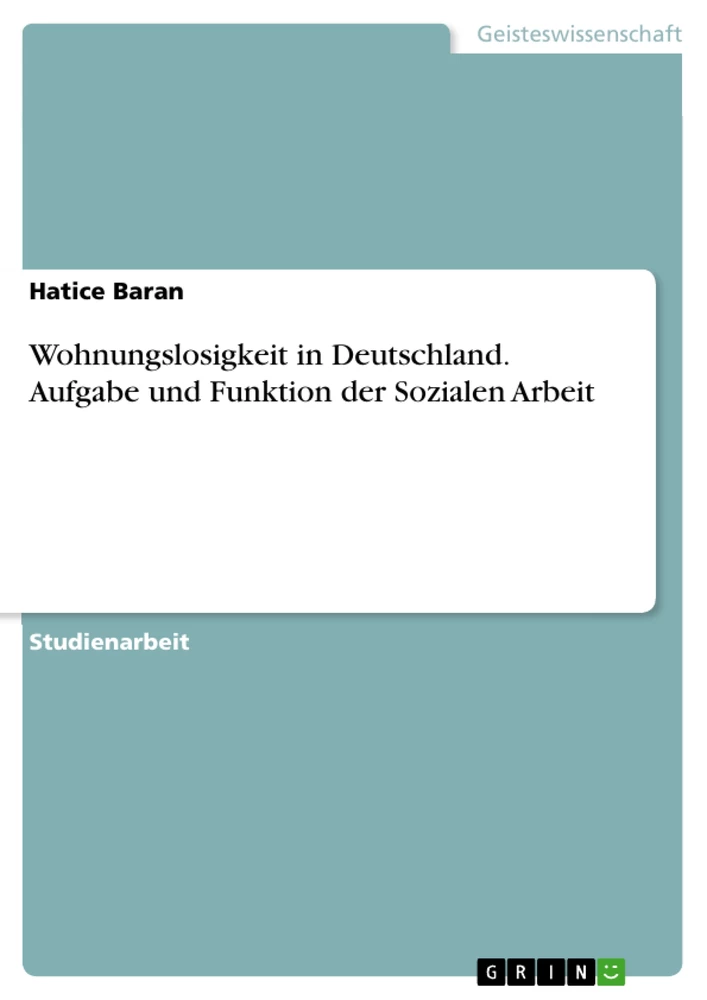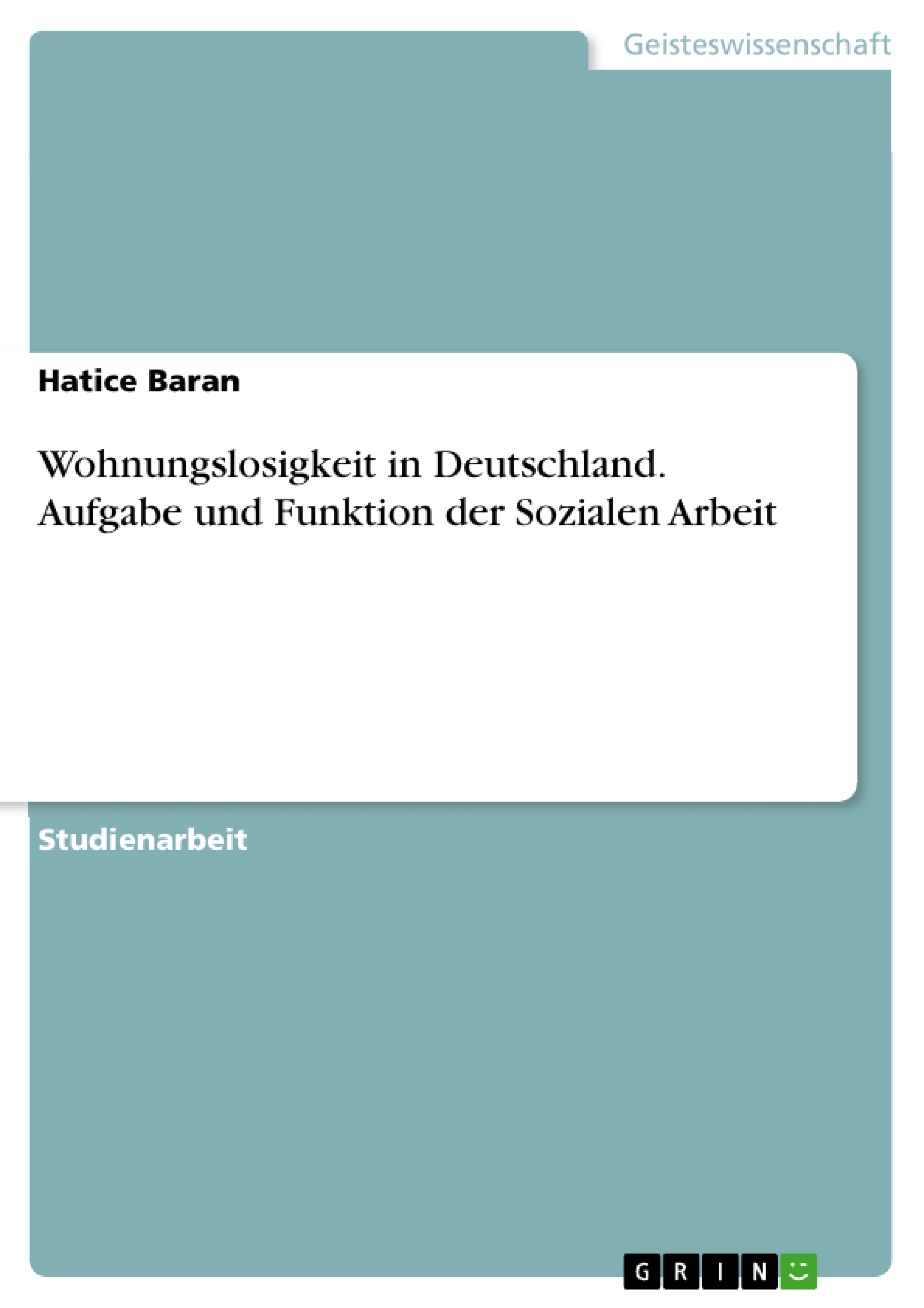Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit wohnungslosen Menschen in Deutschland, da trotz sozialer Unterstützungen in verschiedenster Form und vermeintlich guter Absicherung das Problem der Wohnungslosigkeit weiter besteht. In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen, wie z. B. die, wo die Problematik liegt, in welcher Lebenslage sich die von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen tatsächlich befinden und inwieweit sich die Soziale Arbeit mit diesem Thema als Gegenstand befasst. Auf diese und weitere Fragen wird in dieser Arbeit eingegangen.
Es gibt keine wohnungslosen Menschen, die ihre Arbeit und ihre Wohnung selbstverschuldet verlieren und ihre Zuflucht im Alkohol o. Ä. suchen und finden. Jeder Mensch hat seinen individuellen Lebensverlauf und befindet sich in einer individuellen Lebenslage, die wiederum individuell bewältigt werden muss. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, den von sozialen Problemlagen betroffenen Menschen professionelle Hilfe zu bieten, die sich nach den Betroffenen selbst und ihren Bedürfnissen richtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit
- Was ist Soziale Arbeit und was sind ihre Aufgaben?
- Der Gegenstand der Sozialen Arbeit
- Die Entstehung der sozialen Probleme
- Die soziale Ungleichheit und das soziale Problem
- Armut als soziales Problem
- Wohnungslosigkeit - Gegenstand der Sozialen Arbeit
- Begriffsdefinition Obdachlosigkeit / Wohnungslosigkeit
- Der Weg in die Wohnungslosigkeit und seine Ursachen
- Wohnungslosenhilfe
- Präventive Hilfen
- Träger der Wohnungslosenhilfe
- Finanzierung der Wohnungslosenhilfe
- Hilfesystem
- Hilfeprozess
- Soziale Arbeit im Kontext mit Wohnungslosigkeit
- Hilfen und Hilfsangebote für Wohnungslose durch Sozialarbeiter
- Der Beratungsprozess
- Streetwork in der Wohnungslosenhilfe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Thema Wohnungslosigkeit in Deutschland und untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Sie beleuchtet die vielfältigen Ursachen und Faktoren, die zur Wohnungslosigkeit führen können, und zeigt die Herausforderungen und Aufgaben der Sozialen Arbeit auf, um betroffene Menschen zu unterstützen.
- Definition und Entstehung von Wohnungslosigkeit
- Soziale Ungleichheit und Armut als Ursachen für Wohnungslosigkeit
- Die Aufgaben und Funktionen der Sozialen Arbeit im Umgang mit Wohnungslosigkeit
- Hilfsangebote und -systeme für Wohnungslose
- Der Beratungsprozess und die Bedeutung von Streetwork in der Wohnungslosenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Wohnungslosigkeit in Deutschland vor und verdeutlicht die Relevanz der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Kapitel 2 definiert den Begriff der Sozialen Arbeit, erläutert ihre Aufgaben und Ziele und beleuchtet den Gegenstand der Sozialen Arbeit, der sich mit sozialen Problemen auseinandersetzt. Kapitel 3 behandelt das Thema Wohnungslosigkeit als Gegenstand der Sozialen Arbeit und definiert den Begriff, untersucht die Ursachen für Wohnungslosigkeit und analysiert den Weg in die Wohnungslosigkeit. Kapitel 4 befasst sich mit der Wohnungslosenhilfe, beleuchtet präventive Hilfen, die Träger der Wohnungslosenhilfe und die Finanzierung sowie das Hilfesystem und den Hilfeprozess. Kapitel 5 analysiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext mit Wohnungslosigkeit, untersucht Hilfen und Hilfsangebote für Wohnungslose durch Sozialarbeiter, den Beratungsprozess und den Einsatz von Streetwork in der Wohnungslosenhilfe.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Wohnungslosigkeit, Soziale Arbeit, soziale Ungleichheit, Armut, Hilfesysteme, Beratung, Streetwork und Prävention.
- Quote paper
- Hatice Baran (Author), 2016, Wohnungslosigkeit in Deutschland. Aufgabe und Funktion der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/368600