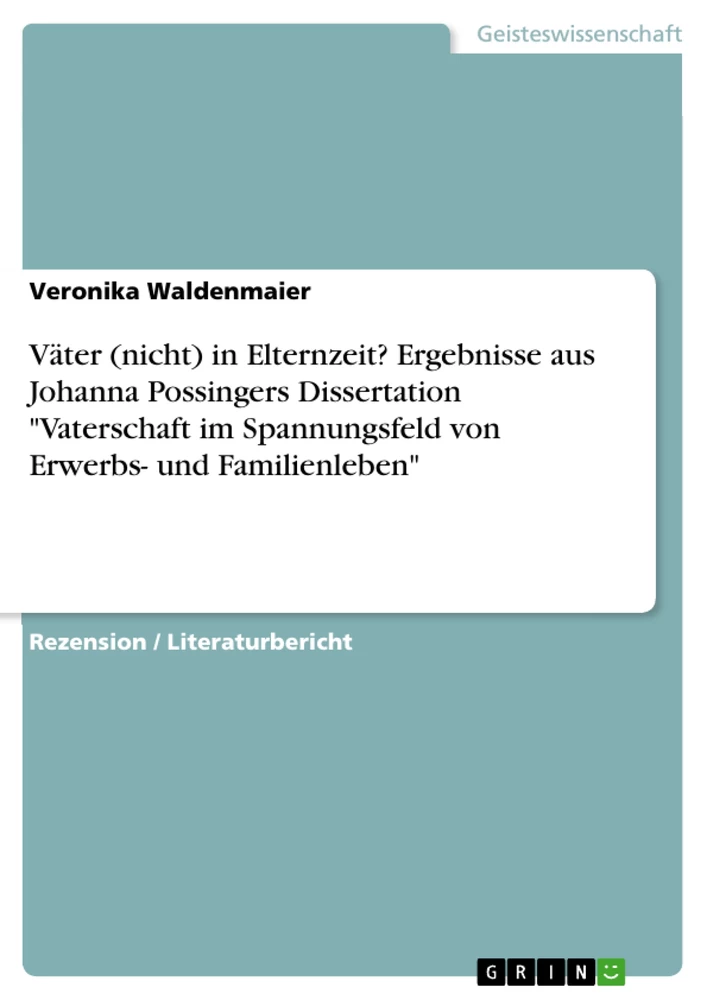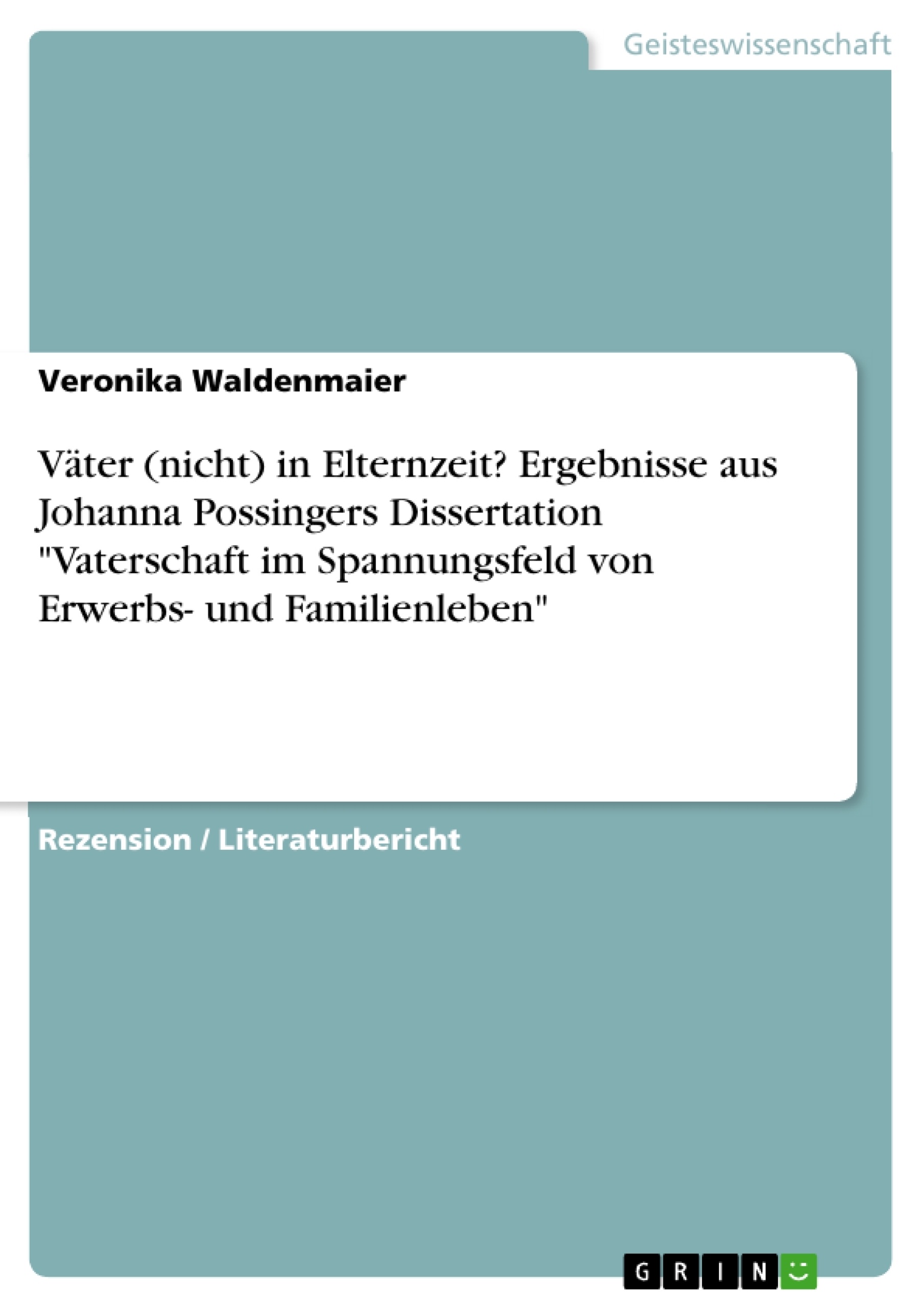Johanna Possinger untersucht in ihrer 2013 veröffentlichten Dissertation „Vaterschaft im Spannungsfeld von Erwerbs- und Familienleben – „neuen Vätern auf der Spur“ die Gründe für den Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit gelebter Vaterschaft. In ihrer qualitativen Studie beleuchtet Possinger aus einer mikrosoziologischen Perspektive heraus, wie sich Väter an der Fürsorgearbeit ihrer Kinder beteiligen und wie sie die Verpflichtungsbalance zwischen Beruf und Familie organisieren und hierbei auftretende Hindernisse bewältigen.
In der vorliegenden Rezension wird Johanna Possingers Studie beschrieben, nach positiven und negativen Aspekten analysiert und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse im aktuellen Forschungsstand eingeordnet und bewertet.
Väter wollen mehr sein als nur die finanziellen Ernährer ihrer Familie und Verantwortung bei den direkten Sorgearbeiten ihrer Kinder übernehmen. Dieser gesellschaftliche Wandlungsprozess führt vermehrt auch bei Vätern zu einem Vereinbarkeitsdilemma zwischen Beruf und Familie. Als positiver Anreiz zur beidseitigen Beteiligung der Eltern an der Sorgearbeit ihrer Kinder wurde 2007 das Elterngeld mit den Partnermonaten eingeführt. Elterngelt- und Zeit steht allen zu, die sich in einem Arbeitsverhältnis befinden und kann bis zu vierzehn Monate in Anspruch genommen werden. Im Laufe der Jahre stieg die der Anteil der Väter, die sich familienbedingt eine Auszeit von der Erwerbsarbeit genommen haben. Das Erziehungsgeld, welches 2007 durch das Elterngeld abgelöst wurde, nahmen 2006 lediglich etwa 3 Prozent Väter in Anspruch, während 2007 der Anteil bereits auf 15 Prozent gestiegen ist. Bei den 2011 geborenen Kindern betrug die Väterbeteiligung beim Elterngeld schon 27,3 Prozent, während jedoch bei den Müttern der Anteil bei 95 Prozent lag. Trotz dieser positiven Zahlen zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass die Dauer der Inanspruchnahme relativ gering ausfällt, da 77 Prozent dieser Väter lediglich für maximal zwei Monate Elterngeld in Anspruch genommen haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltliche Betrachtung
- Hinführung
- Theorie
- Methodik
- Ergebnisse
- Schlussfolgerung
- Rezensierende Betrachtung
- Betrachtung der Hinführung
- Betrachtung der Theorie
- Betrachtung der Methodik
- Betrachtung der Ergebnisse
- Betrachtung der Schlussfolgerung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Väter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Kontext der modernen Gesellschaft bewältigen und inwiefern sie sich aktiv an der Fürsorgearbeit ihrer Kinder beteiligen. Die Autorin analysiert die Herausforderungen, die Väter im Spannungsfeld zwischen Erwerbsarbeit und Familiensorge erleben und untersucht die Gründe, warum die tatsächliche Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter trotz gestiegener Akzeptanz und sozialer Veränderungen weiterhin begrenzt ist.
- Entwicklung und Definition von Vaterbildern im historischen Kontext
- Analyse von strukturellen Barrieren und gesellschaftlichen Normen, die eine gleichberechtigte Teilhabe von Vätern an der Kinderbetreuung behindern
- Bedeutung der Erwerbsarbeit und ihre Auswirkungen auf die Gestaltung der familiären Rollenverteilung
- Einfluss von sozialen Geschlechterkonstruktionen auf die Wahrnehmung von Vaterrolle und Familienverantwortung
- Möglichkeiten und Herausforderungen der Implementierung eines egalitären Familienmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Inhaltliche Betrachtung
- Hinführung: Die Autorin beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel hin zu einer stärkeren Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung und zeigt gleichzeitig die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach einer gleichberechtigten Familienrolle und der tatsächlichen Lebensrealität auf. Sie kritisiert die traditionelle Rollenverteilung und hebt die Bedeutung der Arbeitgeberrolle bei der Realisierung eines modernen Vaterbilds hervor.
- Theorie: Possinger stellt das Konzept „Care“ vor und erläutert die verschiedenen Formen der Sorgearbeit, die sowohl immateriell-direkte als auch materiell-indirekte Aufgaben umfassen. Sie betrachtet verschiedene Konzepte von Vaterschaft im historischen Kontext und hebt die Unterschiede zwischen „traditioneller“, „generativer“ und „egalitärer“ Vaterschaft hervor. Im Rahmen des aktuellen Forschungsstands analysiert sie Bedingungen und Hindernisse für eine gelebte egalitäre Vaterschaft und zeigt die Bedeutung von ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren auf.
- Methodik: In diesem Kapitel wird die Forschungsmethodik der Dissertation vorgestellt, die auf einer qualitativen Studie basiert.
- Ergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und bietet Einblicke in die Lebenserfahrungen der befragten Väter.
Schlüsselwörter
Vaterschaft, Familienleben, Erwerbsarbeit, Care, Sorgearbeit, Familienpolitik, Elterngeld, Geschlechterrollen, egalitäre Vaterschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, qualitative Forschung, mikrosoziologische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Warum nehmen Väter oft nur zwei Monate Elternzeit?
Obwohl die Väterbeteiligung steigt, nehmen 77 % der Väter lediglich die zwei "Partnermonate" in Anspruch. Gründe liegen oft in strukturellen Barrieren, ökonomischen Faktoren und traditionellen Rollenbildern.
Was ist der Unterschied zwischen traditioneller und egalitärer Vaterschaft?
Traditionelle Väter sehen sich primär als Ernährer, während egalitäre Väter eine gleichberechtigte Teilhabe an der direkten Sorgearbeit (Care) und Kinderbetreuung anstreben.
Welche Rolle spielt das Elterngeld seit 2007?
Das Elterngeld schuf durch die Partnermonate einen finanziellen Anreiz für Väter, sich an der Sorgearbeit zu beteiligen. Die Väterquote stieg dadurch von ca. 3 % (2006) auf über 27 % (2011).
Was versteht man unter dem "Vereinbarkeitsdilemma" bei Vätern?
Es beschreibt den Widerspruch zwischen dem Wunsch, ein präsenter Vater zu sein, und den Anforderungen der Erwerbswelt, die oft noch auf dem Modell des vollzeitbeschäftigten "Idealarbeitnehmers" basieren.
Was sind "neue Väter" laut Johanna Possinger?
Sie untersucht Väter, die aktiv versuchen, die Balance zwischen Beruf und Familie neu zu organisieren und Hindernisse bei der Beteiligung an der Familienarbeit zu überwinden.
- Quote paper
- Veronika Waldenmaier (Author), 2015, Väter (nicht) in Elternzeit? Ergebnisse aus Johanna Possingers Dissertation "Vaterschaft im Spannungsfeld von Erwerbs- und Familienleben", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369258