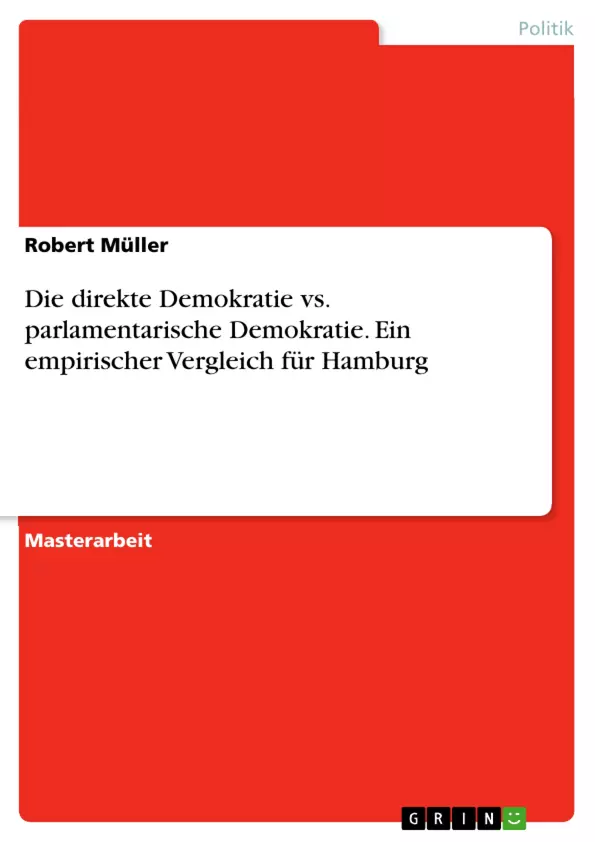In dieser Arbeit soll ein Schwerpunkt auf mögliche kritische Fragen in Bezug auf direkte Demokratie gelegt werden, ohne damit die Ergänzung des repräsentativen Systems durch entsprechende Elemente als im Grundsatz falsch einzuordnen. Eine ausgewogene, demokratietheoretische Betrachtung des Themas verlangt aber auch das Stellen kritischer Fragen: Ist es möglich, dass die Erweiterung eines repräsentativen Systems um Elemente der direkten Demokratie emokratische Entscheidungen eher behindert? Könnte die Qualität der Entscheidungen gemindert, die parlamentarische Demokratie damit geschwächt werden? Es stellt sich dann die Folgefrage, welche Dosierung solcher Intsrumente auf welcher Ebene die richtige ist, um für das demokratische System unter normativen Gesichtspunkten den größten Mehrwert zu bringen.
Der Unmut über die Politik, über die parlamentarischen Vertreter und die Regierung wächst stetig. Seit einem Höhepunkt Anfang der 1970er Jahre nimmt das Ansehen der Politik und die Meinung über Berufspolitiker bei den Bürgern kontinuierlich ab, was sich aus Umfragen und Erhebungen ableiten lässt. Grobe gegenseitige Angriffe unter oppositionellen, zuletzt auch koalierenden Politikern, ständige Streitereien und tatsächliches oder empfundenes Nicht-Einhalten von Versprechungen haben ihre Spuren hinterlassen. Dies führt zu einer stetig sinkenden Unterstützung der Regierenden und der Volksvertreter in der Bevölkerung. Politiker, Parteien und parlamentarische Institutionen werden kritisch bis ablehnend bewertet, das parlamentarische System in Deutschland, die traditionellen Formen politischer Beteiligung, scheint in einer Krise zu stecken. Es ist eine abnehmende Bereitschaft der Bürger festzustellen, sich innerhalb des klassischen, repräsentativen Systems politisch zu beteiligen. Dies zeigt sich etwa im langfristigen Trend der seit Jahrzehnten sinkenden Beteiligung bei Landtags- und Bundestagswahlen. Die bei den Landtagswahlen 2016/2017 zu verzeichnende signifikante Steigerung der Wahlbeteiligung könnte zwar ein Zeichen für eine Trendumkehr sein, ändert aber zunächst noch nichts an dem über Jahrzehnte zu beobachtenden Langfristtrend. Ein weiteres Beispiel der abnehmenden Bereitschaft der Partizipation am repräsentativen System ist die stetig sinkende Zahl von Parteimitgliedschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratietheorien
- Historischer Blick
- Demokratie bei Aristoteles
- Demokratie bei Locke
- Demokratie bei Rousseau
- Demokratietheorie in der Moderne
- Empirische Demokratietheorien
- Normative Demokratietheorien
- Die komplexe Demokratietheorie
- Historischer Blick
- Direktdemokratische Instrumente in Deutschland
- Direkte und indirekte Demokratie auf Bundesebene
- Die Instrumente direkter Demokratie
- Die Volksinitiative
- Das Volksbegehren
- Der Volksentscheid
- Instrumente direkter Demokratie im weiteren Sinne
- Die Geschichte der Direkten Demokratie in Hamburg
- Durchführung von Volksabstimmungen in Hamburg
- Volksinitiative in Hamburg
- Volksbegehren in Hamburg
- Volksentscheid in Hamburg
- Empirische Erhebung
- Direkte Demokratie im Ländervergleich
- Fallbeispiel 1: „Gesundheit ist keine Ware\" - Hamburgischer Volksentscheid
- Fallbeispiel 2: „Rettet den Buchenwald-Hof❝ - Bürgerentscheid im Bezirk Altona
- Fallbeispiel 3: „Hamburg Seilbahn – ich bin dafür“ - Bürgerentscheid im Bezirk Hamburg-Mitte
- Einordnung der empirischen Ergebnisse
- Beteiligungsquoten
- Anspruch der Beteiligungsform
- Status-Quo-Orientierung
- Output-Legitimation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Stärkung bzw. Einführung direktdemokratischer Elemente zu einer höheren politischen Partizipation und einer Stärkung der Demokratie führt. Dabei werden verschiedene Demokratietheorien beleuchtet und die direktdemokratischen Instrumente in Deutschland im Detail betrachtet. Im Fokus stehen die empirischen Ergebnisse von Fallbeispielen aus Hamburg, die Aufschluss über die Auswirkungen direkter Demokratie geben.
- Analyse der Entwicklung der politischen Partizipation in Deutschland
- Relevanz und Bedeutung direktdemokratischer Elemente für die Demokratie
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen direkter Demokratie auf die politische Beteiligung
- Bewertung der Stärken und Schwächen direktdemokratischer Verfahren
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen direkter Demokratie in einem modernen Staat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem der sinkenden politischen Partizipation in Deutschland dar und führt in die Thematik der direkten Demokratie ein. Kapitel 2 skizziert verschiedene Demokratietheorien, beginnend mit einem historischen Überblick und anschließend mit der Vorstellung empirischer und normativer Theorien. Abschließend wird die komplexe Demokratietheorie von Fritz Scharpf erläutert. Kapitel 3 widmet sich den direktdemokratischen Instrumenten in Deutschland, sowohl auf Bundesebene als auch in Hamburg. Im Fokus stehen die Volksinitiative, das Volksbegehren, der Volksentscheid und weitere Formen der direkten Demokratie. Kapitel 4 präsentiert empirische Erhebungen, die den Ländervergleich und drei Fallbeispiele aus Hamburg betrachten. Die Einordnung der empirischen Ergebnisse in Kapitel 5 konzentriert sich auf die Beteiligungsquoten, den Anspruch der Beteiligungsform, die Status-Quo-Orientierung und die Output-Legitimation. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, politische Partizipation, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerentscheid, politische Beteiligung, Demokratietheorien, Empirische Forschung, Fallbeispiele, Hamburg, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen direkter und parlamentarischer Demokratie?
In der parlamentarischen Demokratie wählen Bürger Vertreter, während sie in der direkten Demokratie unmittelbar über Sachfragen entscheiden (z. B. durch Volksentscheide).
Welche direktdemokratischen Instrumente gibt es in Hamburg?
Die drei zentralen Instrumente sind die Volksinitiative, das Volksbegehren und der Volksentscheid.
Führt direkte Demokratie zu höherer Wahlbeteiligung?
Die Arbeit untersucht anhand von Fallbeispielen aus Hamburg die Beteiligungsquoten und prüft, ob diese Instrumente die Krise der politischen Partizipation lösen können.
Schwächt direkte Demokratie das Parlament?
Dies ist eine der kritischen Fragen der Arbeit. Es wird diskutiert, ob die Qualität von Entscheidungen gemindert wird oder ob sie das repräsentative System sinnvoll ergänzen.
Was ist ein Bürgerentscheid?
Ein Bürgerentscheid ist das Instrument der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene (z. B. in den Hamburger Bezirken Altona oder Mitte).
Was bedeutet "Output-Legitimation"?
Es beschreibt die Akzeptanz eines politischen Systems durch die Qualität und Wirksamkeit der Ergebnisse, die es für die Bürger erzielt.
- Quote paper
- Robert Müller (Author), 2017, Die direkte Demokratie vs. parlamentarische Demokratie. Ein empirischer Vergleich für Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/369924