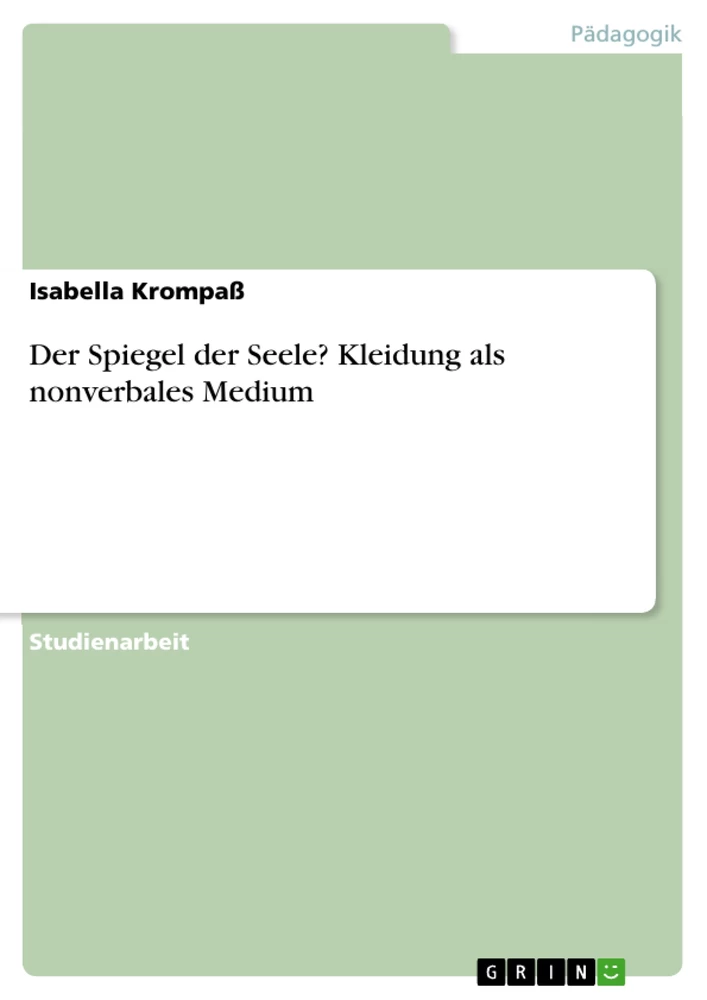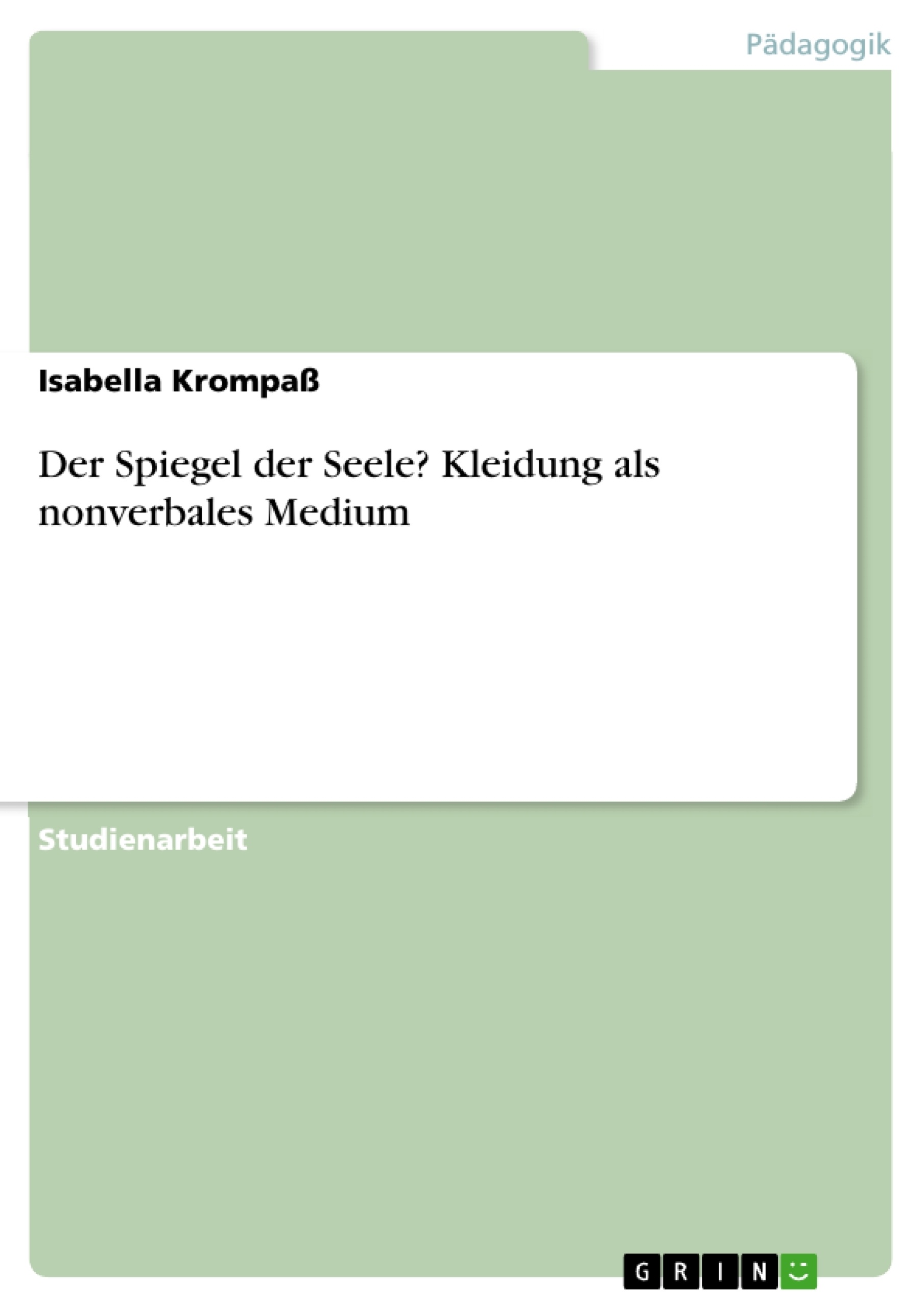Die Tatsache, dass wir das Äußere eines Menschen unmittelbar als positiv oder negativ bewerten oder ihm zumindest eine gewisse Tendenz in eine der beiden Richtungen zuweisen, liegt in dem sogenannten universe of appearence, welches uns alle umgibt und automatisch eine, gewollte oder ungewollte, Wirkung auf unsere Mitmenschen erzeugt. Denn der erste Eindruck der äußeren Erscheinung, der sich bei einer Kontaktaufnahme unmittelbar ergibt, entscheidet über jene Meinungsbildung hinsichtlich des Gegenübers, die anschließend meist nur wenig revidiert wird. Die Signifikanz dieser einmaligen wichtigen, rein visuellen, Begegnung wird also durch die „Dominanz des ersten Eindrucks“ bestimmt. Schließlich beeinflusst das universe of appearence – die erste visuelle Konfrontation mit einem bisher unbekannten Menschen – die Art und Weise der sich anschließenden Interaktion, vor allem im privaten Bereich und entscheidet möglicherweise darüber, ob überhaupt ein universe of discourse zustande kommt. Das heißt, dass bei mangelnder Sympathie aufgrund des allerersten optischen Eindrucks, welcher maßgeblich von der Kleidung geprägt wird, die Möglichkeit besteht, dass keine weitere, sprachliche Kommunikation zustande kommt.
Doch wo lassen sich die Ursprünge dieser sich innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft deckenden Voreinstellungen gegenüber der Optik und der sich dahinter verbergenden Lebensentwürfe von fremden Menschen finden? Und welche Rolle spielt dabei der mediale Charakter sowie die geschichtliche Entwicklung von kulturell alternierenden Bekleidungsnormen?
Diesen Fragen wird in nachfolgender Arbeit auf den Grund gegangen.
Es soll aber auch in besonderer Weise der Halo-Effekt bezüglich Kleidung untersucht werden, da sich unser Projekt das Ziel gesetzt hat, herauszufiltern, inwiefern die Textilien, die täglich vor dem Kleiderschrank gewählt und zusammengestellt werden, die Stimmungslage seines Trägers widerspiegeln. Ob mit Hilfe von Tagebucheinträgen der weiblichen, studentischen Versuchspersonen tatsächlich eine Korrelation von Bekleidung und Wohlbefinden nachgewiesen werden kann,welche Aspekte dabei nicht aus den Augen gelassen werden sollten und wie sich letztlich die Reaktionen der Testpersonen innerhalb des Seminars auf unserer Ergebnisse äußerten, wird den Schluss der Ausführungen darstellen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung -,,Kleider machen Leute\" !?
- 2 Theoretische Grundlagen – Kleidung als Medium nonverbaler Kommunikation
- 2.1 Voraussetzungen für medialen Charakter
- 2.1.1 Definition,,Medium"
- 2.1.2 Modell des Encoding/Decoding nach Stuart Hall
- 2.1.3,,Geschmack\" nach Pierre Bourdieu
- 2.1.4 Differenzierung in Signalräume
- 2.2 Geschichtlicher Wandel
- 2.2.1 Kleidung als Zeitindikator
- 2.2.2 Modelle des Modewandels
- 2.2.3 Mode als Collective Selection bei Herbert Blumer
- 2.3 Bedürfnisbefriedigung durch Kleidung
- 2.1 Voraussetzungen für medialen Charakter
- 3 Das Projekt – Tagebuch der Kleidungswahl
- 3.1 Vorbereitungen und Ideenfindung:
- 3.2 Konzeption der Tagebuch-Vorlage
- 3.3 Umsetzung des Projekts
- 4 Analyse
- 4.1 Auswertung der Tagebucheinträge
- 4.2 Feedback der Projekt-Teilnehmer
- 4.3 Persönliche Würdigung des Seminars
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht Kleidung als ein Medium nonverbaler Kommunikation und analysiert den Einfluss von Kleidung auf die Meinungsbildung und den Halo-Effekt in Bezug auf die Stimmungslage des Trägers. Es wird die Frage gestellt, ob die Kleidung des Einzelnen seine Stimmung widerspiegelt und wie der Prozess der Kleidungswahl mit dem persönlichen Wohlbefinden zusammenhängt.
- Kleidung als Medium nonverbaler Kommunikation
- Der Halo-Effekt in Bezug auf Kleidung
- Zusammenhang zwischen Kleidung und Stimmungslage
- Das Encoding/Decoding-Modell nach Stuart Hall
- Der Begriff "Geschmack" nach Pierre Bourdieu
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die grundlegende These auf, dass Kleidung eine wichtige Rolle im Prozess der Meinungsbildung spielt. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Kleidung als Medium nonverbaler Kommunikation und analysiert die Voraussetzungen für einen medialen Charakter von Kleidung. Dabei werden verschiedene Konzepte und Modelle, wie das Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall und der "Geschmack" von Pierre Bourdieu, herangezogen. Kapitel 3 beschreibt das Projekt "Tagebuch der Kleidungswahl", das die Beziehung zwischen Kleidung und Stimmung des Trägers untersuchen soll. Kapitel 4 widmet sich der Analyse der Tagebucheinträge und des Feedbacks der Projekt-Teilnehmer, wobei auch die persönliche Würdigung des Seminars reflektiert wird.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kleidung, nonverbal Kommunikation, Halo-Effekt, Stimmungslage, Encoding/Decoding, Stuart Hall, Geschmack, Pierre Bourdieu, Medienerziehung, Medienbildung, Tagebuch, Analyse, Projekt, Seminar.
- Quote paper
- Isabella Krompaß (Author), 2012, Der Spiegel der Seele? Kleidung als nonverbales Medium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373342