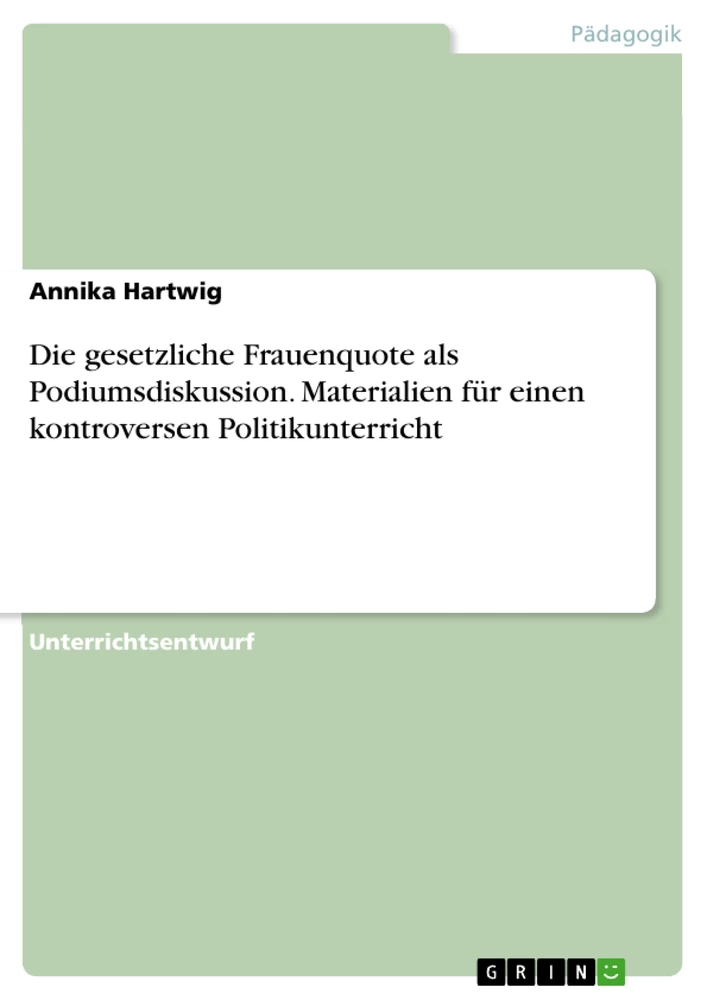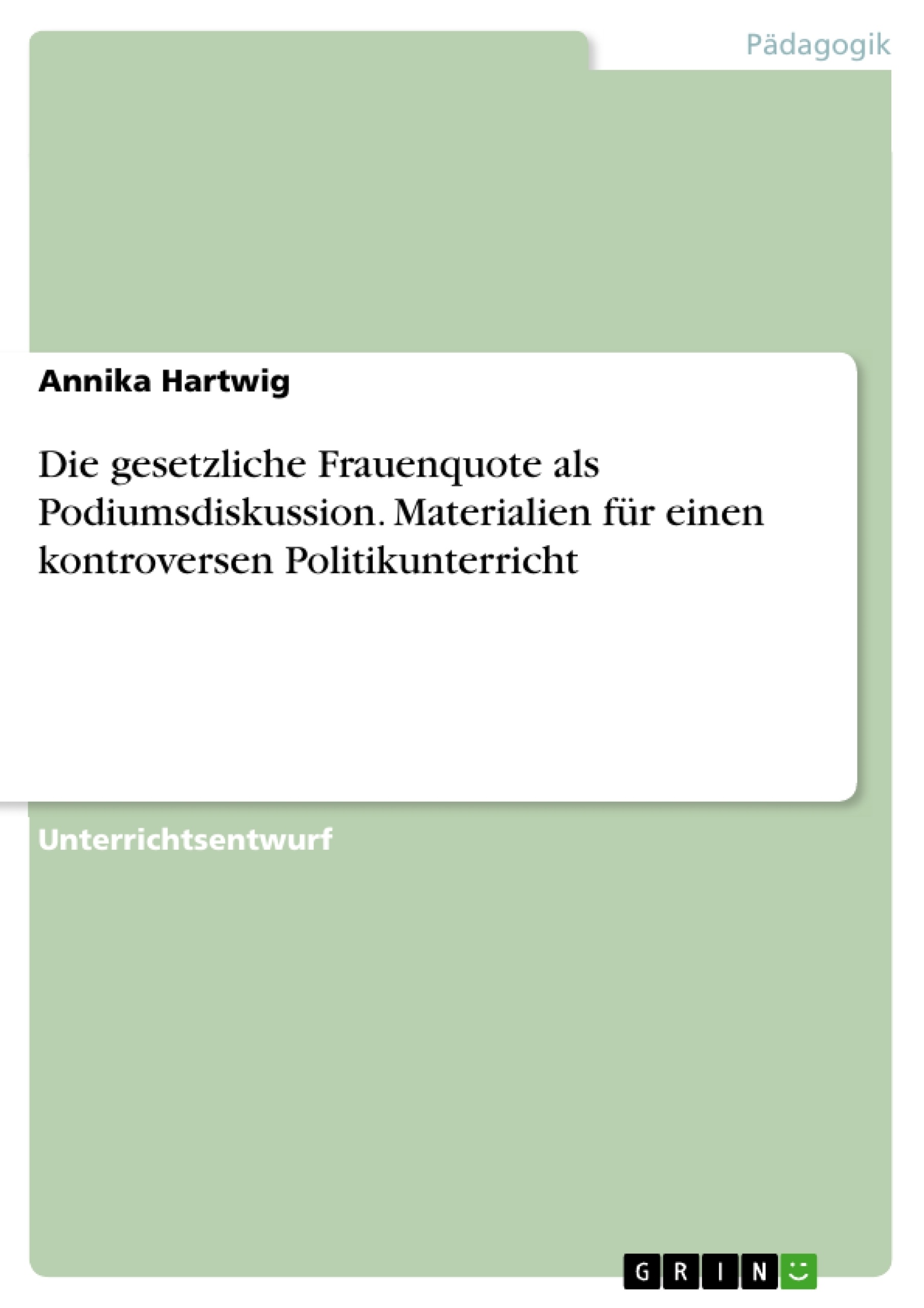Ein Beispiel für die bildungswirksame Gestaltung von Kontroversität im Politik-Wirtschaftsunterricht ist die Thematik um eine Frauenquote in deutschen Aufsichtsräten. Bereits seit der Jahrtausendwende zeigt sich anhand dieser Thematik, wie andauernd und aufwühlend eine Kontroverse in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit debattiert werden kann. Doch trotz jahrelangen Widerstandes großer Kreise aus Wirtschaft und Politik wurde das Gleichstellungsgesetz Ende 2014 beschlossen. Ab 2016 ist es voll mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Großunternehmen in Deutschland nun auferlegt, ihre Aufsichtsratspositionen bei Neuwahlen mit mindestens 30 Prozent weiblicher Kandidatinnen zu besetzen. Sollte ein Unternehmen keine geeignete Kandidatin aufweisen können, müssten solche Positionen unbesetzt bleiben, so die politische Sanktion. Doch auch wenn das Gleichstellungsgesetz längst beschlossen ist, die Thematik der Frauenquote bleibt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Brisanz sowie anhaltender Fragestellungen für den Politik-Wirtschaftsunterricht relevant. Besagte Fragestellungen umfassen dabei sowohl ethische als auch wirtschaftliche sowie politische Argumentationen. Unterstützt wird diese Relevanz zudem durch analoge Vorgaben des entsprechenden Kerncurriculums: Laut diesem sollten Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II politische wie ökonomische Thematiken anhand von spezifische Kriterien (hinsichtlich Effizienz, Legitimität und Grundrechten) beurteilen. Eben diese Kriterien werden durch die unterschiedlichen Positionen des Materials bedient, welche eine Verzahnung von ethischen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Argumenten sowie dementsprechend eine kontroverse, wie auch mehrdimensionale Diskussion bedingt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entscheidung für Thema und Methode
- 1.1 Begründung der inhaltlichen Thematik
- 1.2 Begründung der Methodenwahl
- 2. Entscheidung für Akteure und Positionen
- 3. Aufbereitung von Materialien für die Podiumsdiskussion in der Sek II
- 3.1 Basismaterial zur gesetzlichen Frauenquote in Deutschland
- 3.2 Darstellung der Diskussionssituation sowie Arbeitsaufträge für die Lernenden
- 4. Anmerkungen zur methodischen Umsetzung des Materials
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung einer Podiumsdiskussion zur Behandlung der gesetzlichen Frauenquote im Politikunterricht der Sekundarstufe II. Ziel ist es, ein didaktisches Material zu entwickeln, das die kontroverse Thematik multiperspektivisch aufarbeitet und die kommunikative und partizipative Handlungsfähigkeit der Schüler*innen fördert.
- Kontroversität im Politikunterricht und das Beutelsbacher Konsens
- Die gesetzliche Frauenquote in Deutschland: Argumente für und wider
- Methodische Gestaltung von Kontroversität im Unterricht
- Auswahl geeigneter Akteure und Positionen für die Podiumsdiskussion
- Didaktische Umsetzung und Lernziele
Zusammenfassung der Kapitel
1. Entscheidung für Thema und Methode: Dieses Kapitel begründet die Wahl der Frauenquote als Unterrichtsthema aufgrund ihrer Kontroversität und Relevanz für die politische Bildung. Es wird auf den Beutelsbacher Konsens verwiesen, der die Notwendigkeit kontroverser Auseinandersetzungen im Unterricht betont. Die Wahl der Podiumsdiskussion als Methode wird damit gerechtfertigt, dass sie Multiperspektivität ermöglicht und interaktive Kommunikation fördert, was die kommunikative und partizipative Handlungsfähigkeit der Schüler*innen stärkt. Alternative Methoden wie die Parlamentsdebatte oder Talkshow werden kritisch bewertet und abgelehnt, da sie die Komplexität des Themas nicht ausreichend abbilden.
2. Entscheidung für Akteure und Positionen: Dieses Kapitel beschreibt die Auswahl der Akteure für die Podiumsdiskussion. Es wird darauf geachtet, verschiedene relevante Positionen aus Politik und Wirtschaft repräsentativ darzustellen, um eine ausgewogene und kontroverse Diskussion zu ermöglichen. Die Auswahlkriterien beinhalten die Authentizität der Akteure und ihrer Positionen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven (z.B. die Einbeziehung eines männlichen Befürworters der Frauenquote, um die Diskussion über Geschlechterrollen hinaus zu erweitern).
Schlüsselwörter
Frauenquote, Politikunterricht, Sekundarstufe II, Kontroversität, Beutelsbacher Konsens, Podiumsdiskussion, Multiperspektivität, Kommunikative Handlungsfähigkeit, Partizipative Handlungsfähigkeit, Didaktik, Gleichstellungsgesetz, Politische Bildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Podiumsdiskussion zur Frauenquote im Politikunterricht
Was ist das Thema und der Zweck dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines didaktischen Materials für eine Podiumsdiskussion zur gesetzlichen Frauenquote im Politikunterricht der Sekundarstufe II. Ziel ist die multiperspektivische Auseinandersetzung mit dieser kontroversen Thematik und die Förderung der kommunikativen und partizipativen Handlungsfähigkeit der Schüler*innen.
Welche Methode wird verwendet und warum?
Die gewählte Methode ist die Podiumsdiskussion, da sie Multiperspektivität und interaktive Kommunikation ermöglicht und somit die kommunikative und partizipative Handlungsfähigkeit der Schüler*innen stärkt. Alternative Methoden wie Parlamentsdebatte oder Talkshow wurden kritisch geprüft und abgelehnt, da sie die Komplexität des Themas nicht ausreichend abbilden.
Welche Akteure und Positionen werden in der Podiumsdiskussion berücksichtigt?
Die Auswahl der Akteure für die Podiumsdiskussion zielt auf eine repräsentative Darstellung verschiedener relevanter Positionen aus Politik und Wirtschaft ab, um eine ausgewogene und kontroverse Diskussion zu gewährleisten. Es wird auf die Authentizität der Akteure und ihrer Positionen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven (z.B. die Einbeziehung eines männlichen Befürworters) geachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Entscheidung für Thema und Methode, 2. Entscheidung für Akteure und Positionen, 3. Aufbereitung von Materialien für die Podiumsdiskussion in der Sek II (inkl. Basismaterial zur Frauenquote und Arbeitsaufträge für Schüler*innen) und 4. Anmerkungen zur methodischen Umsetzung des Materials.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kontroversität im Politikunterricht und der Beutelsbacher Konsens, die gesetzliche Frauenquote in Deutschland (Argumente für und wider), methodische Gestaltung von Kontroversität im Unterricht, Auswahl geeigneter Akteure und Positionen für die Podiumsdiskussion sowie die didaktische Umsetzung und Lernziele.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Frauenquote, Politikunterricht, Sekundarstufe II, Kontroversität, Beutelsbacher Konsens, Podiumsdiskussion, Multiperspektivität, Kommunikative Handlungsfähigkeit, Partizipative Handlungsfähigkeit, Didaktik, Gleichstellungsgesetz, Politische Bildung.
Wie wird der Beutelsbacher Konsens in der Arbeit berücksichtigt?
Der Beutelsbacher Konsens wird als Begründung für die Wahl der Frauenquote als Unterrichtsthema und die Methode der Podiumsdiskussion herangezogen, da er die Notwendigkeit kontroverser Auseinandersetzungen im Unterricht betont.
Welche Materialien werden für die Podiumsdiskussion bereitgestellt?
Das entwickelte didaktische Material beinhaltet Basisinformationen zur gesetzlichen Frauenquote in Deutschland sowie konkrete Arbeitsaufträge für die Schüler*innen, um eine aktive Teilhabe an der Diskussion zu ermöglichen.
- Quote paper
- Annika Hartwig (Author), 2016, Die gesetzliche Frauenquote als Podiumsdiskussion. Materialien für einen kontroversen Politikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373636