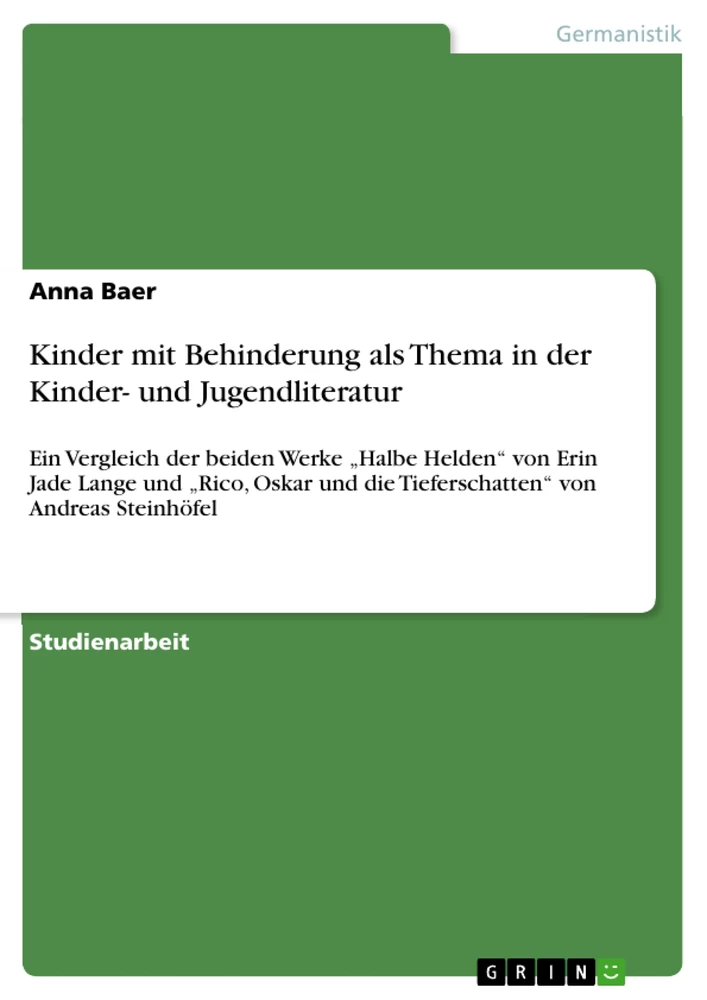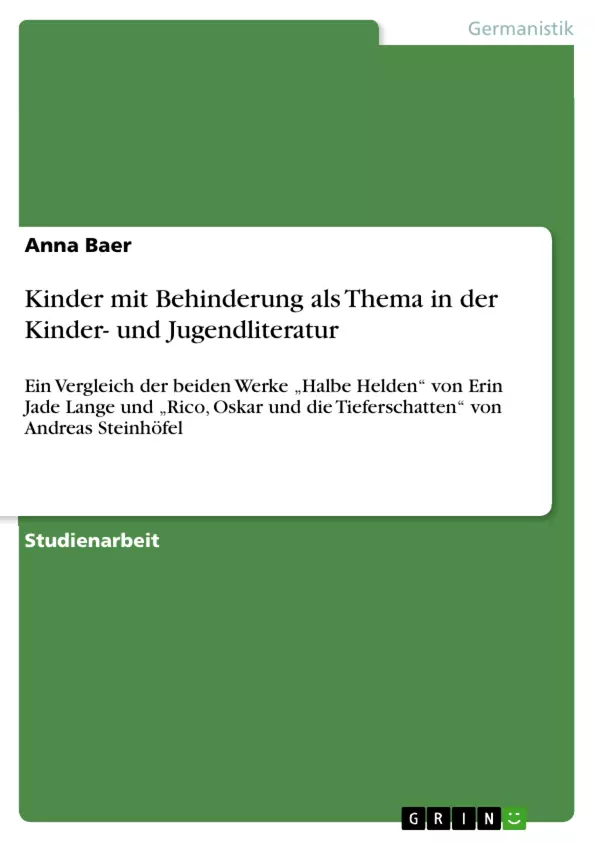Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gründet auf das Werk „Halbe Helden“ , da es kontroverse Diskussionen in Bezug auf die Behinderung einer Figur anregte. Daran anschließende Recherchen stellten heraus, dass die Forschungslage zu dem Thema Behinderung in der Literatur defizitär ist. Studien, die sich mit der Darstellung von Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur befassen, stammen aus Zeiten, in denen der Behindertenbegriff grundlegend anders ausgelegt wurde. Diese Beobachtungen gehen mit den Ausführungen Reeses konform, dass in Studien Aspekte wie Integrationsbewegung und Dekategorisierung nicht berücksichtigt werden würden.
Der Analyseteil beschäftigt sich mit zwei Werken, die sich mit geistiger Behinderung befassen – das Werk aus dem Seminar und zusätzlich das mit dem Kinder- und Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Werk „Rico Oskar und die Tieferschatten“. Durch die gleiche Thematik, die geistige Behinderung, wird ein direkter Vergleich ermöglicht. Zuvor soll eine Definition von Behinderung – und geistiger Behinderung im Speziellen – und der Forschungsstand zum Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft vorgestellt werden. Hier werden einzelne Studien dargestellt und auf den historischen Wandel des Umgangs mit Behinderung in der Gesellschaft Bezug genommen, um daraus hervorgehend die aktuelle Debatte um Inklusion zu skizzieren. Anknüpfend an diesen historischen Wandel soll die historische Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur thematisiert werden. Damit einher geht die Darlegung der in der Sekundärliteratur vorgefundenen Gründe der Intention der Darstellung von behinderten Menschen in der Kinder- und Jugendliteratur.
Auch die Ansprüche, die an Kinder- und Jugendliteratur mit dem Thema Behinderung gestellt werden, werden behandelt. Der im Vorhinein aufgebaute theoretische Rahmen dient dazu, die zwei exemplarischen Beispiele in Kapitel vier zu analysieren. Nachdem der Inhalt der beiden Werke kurz wiedergegeben wird, wird der jeweilige Protagonist mit seiner Behinderung vorgestellt und die Darstellung der Behinderung herausgearbeitet. Dabei werden schwerpunktmäßig die Aspekte aufgegriffen, die gute Kinder- und Jugendliteratur mit dem Thema Behinderung ausmachen. Das darauffolgende Kapitel vergleicht und bewertet die beiden Werke. Am Ende dieser Arbeit werden die durch die Analyse gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert, ob die Forderung nach Inklusion und andere Intentionen durch Literatur erreicht werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geistige Behinderung
- Begriffsdefinition
- Umgang mit Behinderung in der Gesellschaft
- Studien zu Einstellungen gegenüber Behinderten ....
- Historischer Wandel des Umgangs mit Behinderung.......
- Kinder- und Jugendliteratur....
- Historische Entwicklung hin zur Problemorientierung.
- Intentionen der Darstellung von behinderten Menschen in KJL.
- Ansprüche an KJL mit dem Thema Behinderung ...
- Exemplarische Beispiele.
- „Rico, Oskar und die Tieferschatten“.
- Inhaltsangabe…………………………..\n
- Darstellung Ricos und seiner „Tiefbegabtheit....
- „Halbe Helden\"\n
- Inhaltsangabe.\n
- Darstellung Billys und seines Downsyndroms.\n
- Vergleich und Bewertung der beiden Werke
- Zusammenfassung und Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Kindern mit Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur. Sie untersucht die Intentionen, die durch die Darstellung von behinderten Protagonisten verfolgt werden, insbesondere im Hinblick auf die Inklusionsforderung. Die Arbeit analysiert zwei exemplarische Werke, „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ und „Halbe Helden“, und vergleicht deren Darstellung von geistiger Behinderung.
- Darstellung von Kindern mit Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur
- Intentionen und Ziele der Inklusion in der Literatur
- Analyse von exemplarischen Werken
- Vergleich der Darstellung von geistiger Behinderung in den Werken
- Bewertung der Werke im Hinblick auf ihre literarische Qualität und ihre Fähigkeit, Inklusion zu fördern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Relevanz der Darstellung von Behinderung in der Literatur im Kontext der Inklusionsdebatte. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition von Behinderung, insbesondere geistiger Behinderung, und dem historischen Wandel des Umgangs mit Behinderung in der Gesellschaft. Kapitel 3 betrachtet die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur und die Intentionen der Darstellung von behinderten Menschen in diesem Genre. Die exemplarischen Beispiele „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ und „Halbe Helden“ werden in Kapitel 4 analysiert, wobei die Darstellung des jeweiligen Protagonisten und seiner Behinderung im Vordergrund steht. Kapitel 4.3 vergleicht und bewertet die beiden Werke. Der Abschluss der Arbeit fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und diskutiert, ob die Forderung nach Inklusion und andere Intentionen durch Literatur erreicht werden können.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, geistige Behinderung, Inklusion, Darstellung von Behinderung, Intentionen, exemplarische Beispiele, Rico, Oskar und die Tieferschatten, Halbe Helden, Vergleich, Bewertung.
- Citar trabajo
- Anna Baer (Autor), 2017, Kinder mit Behinderung als Thema in der Kinder- und Jugendliteratur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374444