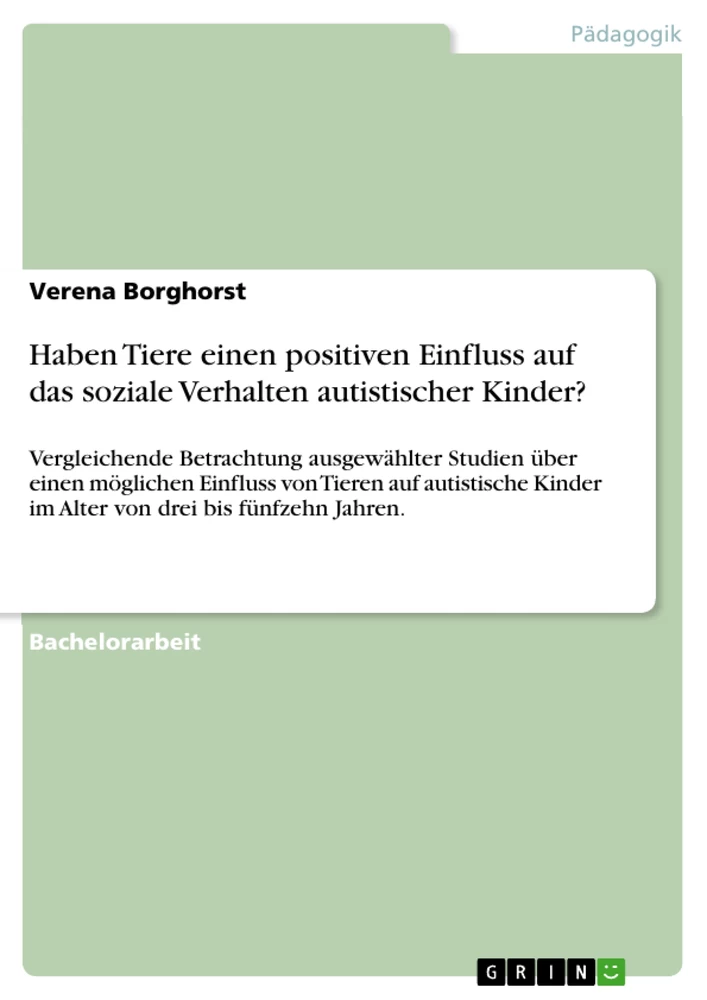Diese Arbeit möchte im Zuge einer vergleichenden Sekundäranalyse der Frage nachgehen, ob der Kontakt mit Tieren einen positiven Einfluss auf das soziale Verhalten autistischer Kinder hat. Unter Kontakt werden hierbei angeleitete Begegnungen mit Tieren im Zuge einer Therapieform (tiergestützte Interventionen) verstanden. Weiterhin wird unter einem positiven Einfluss auf das soziale Verhalten autistischer Kinder jeder Einfluss verstanden, welcher die autistischen Verhaltensstörungen im Bereich des Sozialverhaltens (d.h. Beeinträchtigung der Kommunikation und der sozialen Interaktion) positiv beeinflusst und gleichzeitig das körperliche und seelische Befinden der Kinder verbessert, um dadurch ein nach unseren Maßstäben normales Leben in einer sozialen Gemeinschaft zu erleichtern.
Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines aktuellen Querschnittüberblicks wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Autismus-Spektrums-Störung innerhalb der Mensch-Tier Forschung. Dazu werden im ersten Teil die verwendeten Fachbegriffe „autistische Kinder“ sowie „tiergestützte Intervention“ erläutert. Durch eine intensive Suche nach empirischen Studien in diesem spezifischen Fachbereich wurden im zweiten, vergleichenden Teil fünf englischsprachige Studien über autistische Kinder (im Alter von drei bis fünfzehn Jahren) und tiergestützte Interventionen (mit Hunden, Pferden, Kaninchen und Lamas) vorgestellt. Die Ergebnisse des vergleichenden Teils bilden dann im letzten Teil der Arbeit das Fundament für eine Diskussion möglicher Erklärungsansätze. Abschließend wird das grundlegende Problem der Messbarkeit in diesem Wissenschaftszweig kurz angerissen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Tiergestützter Interventionen
- Entstehung
- Begriffliche Abgrenzung
- Autismus-Spektrum-Störung (ASS) – ein Überblick
- Tiergestützter Interventionen
- Zum Einfluss tiergestützter Interventionen auf das Sozialverhalten autistischer Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren
- Ein Vergleich ausgewählter Studien
- Auswahl der Studien und Suchverfahren
- Vergleich der Hypothesen
- Datenbasis (Stichprobengröße)
- Studiendesign
- Tiergestützte Interventionen: Aktivitäten mit den Tieren
- Ergebnisse der tiergestützten Intervention bei autistischen Kindern
- Sprache und Kommunikation
- Soziale Wechselwirkung
- Autismus-Stärke (ASD Severity)
- negatives bzw. problematisches Verhalten
- Lebensqualität bzw. subjektives Wohlbefinden
- Bereitschaft für Therapieangebote
- Eltern-Kind Interaktion
- Schwachpunkte der Studien
- Zusammenfassung der vergleichenden Arbeit
- Ein Vergleich ausgewählter Studien
- Diskussion der Ergebnisse
- Erklärungsmodelle für Ergebnisse im Bereich der Kommunikation
- analoge Kommunikationsebene bzw. visuelles Denken
- Tiere als Brücke zum erlernen menschlichem Kommunikationsverhalten
- Problem der Messbarkeit
- Erklärungsmodelle für Ergebnisse im Bereich der Kommunikation
- Schlussbetrachtung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel, den Einfluss tiergestützter Interventionen auf das soziale Verhalten autistischer Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren zu untersuchen. Dabei werden ausgewählte Studien aus dem Bereich der Mensch-Tier Forschung vergleichend analysiert, um einen aktuellen Querschnittüberblick über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu liefern.
- Der Einfluss von tiergestützten Interventionen auf die Kommunikation und das Sozialverhalten autistischer Kinder
- Die Rolle von Tieren als Brücke zur Verbesserung der sozialen Interaktion und Kommunikation
- Die Herausforderungen und Limitationen der Forschung im Bereich tiergestützter Interventionen bei Autismus
- Die Bedeutung der empirischen Forschung für die Entwicklung zielgerichteter Interventionen
- Die Erforschung von Erklärungsmodellen für den positiven Einfluss von Tieren auf das soziale Verhalten autistischer Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Herausforderungen für Menschen mit autistischen Verhaltensweisen ein und stellt die These auf, dass der Kontakt mit Tieren einen positiven Einfluss auf das soziale Verhalten autistischer Kinder haben könnte. Die Begriffsbestimmungen klären die Definitionen von „tiergestützten Interventionen“ und „Autismus-Spektrum-Störung“ (ASS), sowie die Entstehung der tiergestützten Interventionen. Das dritte Kapitel analysiert ausgewählte Studien zum Einfluss tiergestützter Interventionen auf das soziale Verhalten autistischer Kinder im Alter von drei bis fünfzehn Jahren. Es werden verschiedene Aspekte wie Sprache und Kommunikation, soziale Wechselwirkung und die Lebensqualität der Kinder untersucht.
Die Diskussion der Ergebnisse im vierten Kapitel analysiert die gewonnenen Erkenntnisse aus den Studien und versucht, diese mithilfe verschiedener Erklärungsmodelle zu beleuchten. Abschließend wird das Problem der Messbarkeit im Bereich der Mensch-Tier Forschung angesprochen.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störung, tiergestützte Interventionen, Sozialverhalten, Kommunikation, soziale Interaktion, Mensch-Tier Forschung, empirische Studien, Erklärungsmodelle, Messbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Haben Tiere einen positiven Einfluss auf autistische Kinder?
Ja, Studien deuten darauf hin, dass tiergestützte Interventionen die Kommunikation, soziale Interaktion und das allgemeine Wohlbefinden autistischer Kinder verbessern können.
Welche Tiere werden in der Therapie für Kinder mit ASS eingesetzt?
Häufig werden Hunde, Pferde, Kaninchen, Lamas und Meerschweinchen in tiergestützten Interventionen eingesetzt.
Was versteht man unter einer "tiergestützten Intervention"?
Es handelt sich um gezielt angeleitete Begegnungen mit Tieren im Rahmen einer Therapieform, um soziale, emotionale oder kognitive Funktionen zu fördern.
Wie helfen Tiere bei Kommunikationsproblemen?
Tiere fungieren oft als "Brücke" oder Eisbrecher, die den Einstieg in die menschliche Kommunikation erleichtern und eine analoge Kommunikationsebene bieten.
Welche Altersgruppe wurde in den Studien untersucht?
Die untersuchten Studien bezogen sich primär auf Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis fünfzehn Jahren.
- Quote paper
- Verena Borghorst (Author), 2015, Haben Tiere einen positiven Einfluss auf das soziale Verhalten autistischer Kinder?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374898